Die dritte Sitzung des Seminars Medienaktivismus, diesmal zum Thema “Internet-Aktivismus und die Politik der Blogosphäre” fragte, welche Instrumente der Internetpolitik das demokratisch-emanzipatorische Versprechen der “digitalen Sphäre” einlösen können. Werden mit Copyright Wars, mit der Debatte um Netzneutralität Rechte zurück- oder erst gewonnen? Braucht es eine Verfassung für das Internet? Und welcher Freiheitsbegriff liegt der Internetpolitik zu Grunde? Diese Fragen wurden am 25.05.2010 in einer (wind-)erfrischenden Diskussion im The Knot auf dem Flugfeld des Flughafen Tempelhof diskutiert.
Creative Commons – Tool, Bewegung oder gar schon Internetpolitik?
Eigentum sind Machtfragen. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht Verluste der Kulturindustrie beklagt, Plagiats- und Patentverstoßvorwürfe ausgesprochen oder Verschärfung von Schutzrechten gefordert werden. War Urheberrecht ehemals Gegenstand eines rein juristischen Diskurses, so sind Fragen des Rechts am geistigen Eigentum mit und durch zunehmende Digitalisierung immer bedeutender geworden – nicht nur für die Konfiguration der digitalen Mediengesellschaft.
Aber nicht nur der Diskurs um Besitz und Eigentum im Internetzeitalter erreicht mehr und mehr Bereiche der Gesellschaft. Auch die Werkzeuge, Inhalte herzustellen und zu lizenzieren, verbreiten sich immer mehr. Oblag es in den 1980ern und 90ern einer programmierspachebeherrschenden Minderheit, sich per General Public License die potentielle Offenheit des WWW für ihre Idee des Copyleft zu nutzen, ist es seit Anfang der Nuller Jahre jedem Internetnutzer möglich, seine Werke nicht der gänzlichen Strenge des Urheberrechts zu unterstellen.
Die von Lawrence Lessig 2001 maßgeblich mitentwickelten, Creative Commons Lizenzen, stellen dem “All rights reserved” des Copyrights ein flexibleres “Some rights reserved” entgegegen. Jedem Künstler, Kreativen und Schöpfer wird es frei gestellt, eine kommerzielle Nutzung und Veränderungen am Werk zuzulassen. Nach Jahren der rasanten Verbreitung bleibt offen, ob die heilsbringerische Aufladung mit der Creative Commons, die auch von vielen Bloggern versehen wurde, einlösen kann.
Schaffen die Lizenzen eine Emanzipation von Schöpfern und Nutzern gleichermaßen? Schaffen sie neue Monetarisierungsmöglichkeiten im Netz? Für den “selbstreferentiellen Diskurs eines neuen Mediums” (Caspar Clemens Miereau) bedeutet das Phänomen Creative Commons zumindest, dass zugunsten einer Vermassung der Debatte radikale Positionen an Wirk- und Leuchtkraft verloren haben.
Netzneutralität – Recht am Zugang?
Spaltete sich die Pionierszene schnell über Eigentumsfragen, ob (Software-)Entwicklungen offen oder proprietär zu gestalten seien, ist die Diskussion um die Verankerung der Netzneutralität ein relativ junges Phänomen. Das Anliegen einiger Netzbetreiber, bestimmte Inhalte zu priorisieren und andere Inhalte durch Datenübertragung zu drosseln, rüttelt am Fundament der Chancengleichheit im Netz.
Für Blogs steht zu befürchten, dass eine verstärkte Aushebelung der Netzneutralität die Balance zugunsten finanzstarker Journalismusverlage im Netz empfindlich stören würde. Unklar ist, auf welcher institutionellen Ebene die Netzneutralität durchsetzbar ist. Bisher gehen zum Beispiel die USA und die EU getrennte Wege. Es stellt sich also die Frage, ob jenseits von Einzelaspekten der Internetpolitik eine Verfassung für das Internet benötigt wird.
Internetverfassung
Auch für eine Verfassung für das Internet ist der zentrale Knackpunkt, auf welchem Freiheitsbegriffs sie fußen soll. Berufen sich einige, wie Richard Stallman, auf das Grundrecht “free speech” und abgeleitete Rechte wie freie und offene Informationsstrukturen, predigten vor allem Vertreter der Californian Ideology eine technikgetriebene staatsferne Freiheit. Bereits 1996 verfasste John Perry Barlow eine “Declaration of the Independence of Cyberspace“, die zu dieser Zeit allerdings ihre Wirkung nur in einer internetaffinene Elite entfaltete.
Dreizehn Jahre später entfachten A-Blogger mit ihrem Internet-Manifest eine Diskussion darüber, wie Journalismus und Meinungsäußerung im Netz in Zukunft zu gestalten sind. Auch nach über einem Jahrzehnt scheint unklar, ob unverbindliche, aus der Praxis abgeleitete Regeln wie Netiquetten, Appelle durch Manifeste oder Festlegung von Grundrechten durch eine Verfassung für das Internet gegeignete Instrumente der Internetpolitik sind. Die Suche geht weiter.
(Anm. d. Red.: Die Fotos zeigen (von oben nach unten) die Seminargruppe bei der Diskussion; zufällige Gasthörer U 18; die Installation des Seminarraums auf dem Flugffeld Tempelhof (The KNOT). Eine nützliche Übersicht über die aktuelle Debatte zum Urheberrecht liefert der Reader Copy.Right.Now!.)



 MORE WORLD
MORE WORLD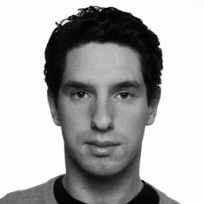

12 Kommentare zu
http://vasistas.wordpress.com/2010/05/28/sollen-blogger-anonym-bleiben/
Ausführlicher:
http://differentia.wordpress.com/2010/05/29/uber-anonymitat-und-pseudonymitat-im-internet/
Und was ist Amateuren, die journalistisch bloggen wollen? Von mir aus auch ohne kommerzielle Interesse (Schau mal in den Fuß der Seite hier: "BERLINER GAZETTE - JOURNALISMUS | KUNST | WISSENSCHAFT"). Verdienen diese elitären Verräter der reinen zk-Lehre keine Lorbeeren?
Wie gut, dass das mit der Platzverteilung letztens Endes immer noch die Leser entscheiden. Hüben wir drüben. Sorry, aber diese Grabenkämpfe sind wirklich überflüssig wie ein Kropf.
Und welchen Kampf führt dann die "Army of Davids"? Den um eine Coverstory im Spiegel oder eine Erwähnung im nächsten Blogger-Dossier der FAZ? Sorry, aber für mich klingt das nach einer ziemlich erbärmlichen Ausrede. Das Internet ist groß genug. Wenn Blogger relevante Texte schreiben, werden die gelesen. Das ist schlicht eine Frage von Qualität und oft kontinuierlicher Arbeit. Es ist so einfach, der Rest sollte dir/euch egal sein. Es sei denn, du willst eigentlich nur Autogramme schreiben und dein Gesicht in Kameras halten.
PS: Von den genannten ist einzig Niggemeier gelernter Journalist. Alle anderen sind Quereinsteiger, die mehr oder weniger ihr Ding machen und damit mehr oder weniger ihren Lebensunterhalt bestreiten.
Wenn auch oft anders vermutet schließt CC eine kommerzielle Verwertung keinesfalls aus. Selbst wenn die Lizenz mit dem Attribut "Noncommercial" versehen wird, ist es für den Werkschaffenden (und Rechteinhaber) nicht ausgeschlossen am eigenen Werk zu verdienen. Der Ausschluss bezieht sich nur auf Verwertung durch Dritte. Allerdings ist dieses Attribut wohl das umstrittenste. Dazu eine Studie: http://creativecommons.org/weblog/entry/17127
Es gibt prominente Beispiele für einen zweigleisigen Umgang mit den Rechten am eigenen Werk, also parallele Veröffentlichung unter Copyright/ Urheberrecht und CC-Lizenz, die verkausfördernd wirken. Inwieweit der awareness-effect bei Werkschaffenden greift, die nicht auf sichere Abnehmerkreise (z.B. Corry Doctorow) setzen können, ist allerdings fraglich.