Heidi revisited
von bardolaWelcher Schweizer Schriftsteller hat das Bild des Alpenlandes im Ausland am stärksten geprägt? Conrad Ferdinand Meyer, Gottfried Keller, Friedrich Dürrenmatt oder Max Frisch?
Die Frage ist falsch gestellt. Das Land der patriarchalisch denkenden Eidgenossen wird bis heute in aller Welt am stärksten durch den Roman einer Frau repräsentiert. Spontan fallen allerdings nicht einmal den Schweizern selbst in dem von männlichen Autoren literarisch-dominierten Helvetien Namen bekannter schreibender Landsfrauen ein; die weltweit berühmteste ist Johanna Spyri.
Fünfundsechzig Jahre vor Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf, also bereits 1880, erschien der erste Heidi-Band Heidis Lehr- und Wanderjahre; der zweite, weniger originelle aber vertiefende und ebenso lesenswerte Band Heidi kann brauchen, was es gelernt hat, kam ein Jahr später heraus. Ein naturverbundenes Mädchen, das lernt, sich ohne Eltern durchzusetzen, das die Erwachsenen beeinflusst und sich Autoritäten widersetzt und das respektlos seinen Kopf durchsetzt, wenn die Umstände es erfordern, ist als Protagonistin einer Kindergeschichte in der Mitte des 20. Jahrhunderts (Pippi) erstaunlich, am Ende des 19. Jahrhunderts (Heidi) jedoch geradezu sensationell.
Die Geschichten für Kinder und auch für Solche, die Kinder lieb haben (so lautet der Untertitel aller Spyri-Kinderbücher) führen heute noch zu heftigen Diskussionen zwischen Lehrern und Leseförderern, zwischen Soziologen und Literaturwissenschaftlern. Darf man diese Geschichte Kindern des 21. Jahrhunderts noch empfehlen? „Johanna Spyris Heidi sollte nur noch literaturhistorische Bedeutung haben“, schrieb Klaus Doderer schon 1969 im Feuilleton der ZEIT als engagierter Vertreter einer problemorientierten, aufklärerischen und „aktuellen“ Kinderliteratur. „Wenn wir bedenken, wie wenig fundiert, beziehungsweise auf welchen zweifelhaften Weltvorstellungen und Lebensmaximen die Existenz Heidis beruht, müssen wir uns fragen, ob das Buch sich für Mädchen und Jungen heute noch eignet … Was hat der Leser von einem heutigen Roman zu erwarten, aus dem heraus sich auf Grund der immer wieder zum Vorschein kommenden einseitigen Hochschätzung der abgeschlossenen Bergwelt leicht Antipathien gegen unsere technisierte Umgebung sammeln lassen?“
Diese technikverliebte Argumentation im Jahr eins nach der Studentenrevolte aus der Feder eines der renommiertesten Kinderliteraturexperten weckt heute Widerspruch. Sollte Kinder- und Jugendliteratur etwa Sympathien für die technisierte Umgebung wecken? Doderers heftige Ablehnung Heidis kam damals einem Bann gleich: Kein ernstzunehmender Pädagoge wagte es noch, diese Lektüre allein schon wegen ihrer „zuweilen bedenklichen Nähe zur Sentimentalität“ (Kindlers Literaturlexikon) zu empfehlen. Doch trotz Internet und Multimedia kennt heute noch – über dreißig Jahre nach Doderers Verriss – jedes Kind Heidis Schicksal. Vielleicht muss man im entscheidenden Augenblick noch näher an den Kindern dran sein, um ihr manchmal paradox erscheinendes Leseverhalten zu verstehen und um nachzuvollziehen, wie groß ihr Einfühlungsvermögen ist, wenn es darum geht, in (alten) Büchern das Nichtvorhandensein von Fernsehern, Playstations, PCs und anderen technischen Geräten zu akzeptieren. Spyri schreibt von Tintenfass statt Laptop, von Hausglocke statt elektrischer Klingel, von Haube statt Dauerwelle, von Kutsche statt Taxi, von Briefen statt E-Mails …
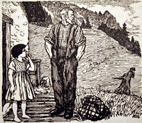
Die Naturschilderungen der „abgeschlossenen Bergwelt“ mögen klischeehaft sein, die Heimatliebe Spyris kitschig, ihre protestantische Frömmigkeit penetrant, die vor allem durch den Alm-Öhi, den Geißenpeter und Heidi repräsentierte Zivilisationsfeindlichkeit in der Nachfolge Rousseaus unzeitgemäß – und doch gehört Johanna Spyris in rund fünfzig Sprachen übersetzte Heidi mit einer Gesamtauflage von rund fünfzig Millionen zu den bedeutendsten Kinderbuchklassikern und zu den erfolgreichsten Büchern überhaupt. Und jede Generation entdeckt darin aufs Neue die zeitlosen Elemente, die dafür sorgen, dass der Heidi-Mythos wohl auch noch in ferner Zukunft wirken wird. Hingegen sind normative Werkbetrachtungen heute weniger gefragt. Es hat sich vielmehr im Verlauf der letzten dreißig Jahre seit Doderers Ge- und Verbot die Erkenntnis durchgesetzt, dass Leseerlebnisse in der Kindheit und Jugend anarchisch sein dürfen: Sowohl Spannung, Humor und rein vordergründige Unterhaltung als auch Kitsch, Klischees und hoffnungslos Antiquiertes – ja sogar Unglaubwürdiges, Unrealistisches und Unliterarisches sind erlaubt und tragen manchmal mehr zur Lesemotivation bei als die preisgekrönte, anspruchsvolle, aktuelle aber vielleicht überfordernde Lektüre.
Unabhängig davon hätte es Doderer (er steht hier stellvertretend für alle unduldsamen und dogmatischen Kinderliteraturkritiker der 60er und 70er Jahre) überrascht, wären 1969 die des in Prag geborenen, seit 1933 in der Schweiz lebenden und leider im Sommer dieses Jahres in Bern verstorbenen Publizisten Sergius Golowin in akribischer Kleinarbeit gesammelten Geständnisse der amerikanischen Blumenkinder bis zu ihm vorgedrungen: „Von 40 amerikanischen Hippies, welche ich von 1966 bis 1968 ‚über die für ihre heutige Ablehnung der industriellen Zivilisation entscheidenden Jugendeindrücke’ befragen konnte, nannten mir nicht weniger als acht Spyris Heidi … Mehrfach wurde mir erzählt, wie sehr jetzt auch einheimische junge Anhänger der ‚Hippie-Philosophie’ bei Spyri ‚sozusagen alle für uns wichtigen Sinnbilder’ wiederfinden, ‚von der Freude an den Blumen bis zu Ablehnung jedes äußeren Zwanges bei der Erziehung’.“
Wieder einmal gilt Prousts Erkenntnis „Jeder Leser, wenn er liest, ist nur ein Leser seiner selbst.“ Heidi-Land muss nicht nur heiles Land sein. Heidi muss nicht als Entwicklungs- Bildungs- oder Erziehungsroman, sondern kann ebenso gut als ein Roman der Regression, der Rückkehr zu infantilen Wünschen und damit zu einem gewaltigen Phantasiereservoir gelesen werden. Heidi war vielen 68ern eine Sehnsuchtsgestalt, eine starke Protagonistin in einem antipädagogischen Roman, der den Lesern die Lizenz zum Rückgriff auf den kindlichen Kampf für Freiheit vermittelt: Wenn Heidi in Frankfurt zur „kleinen Schweizerin Adelheid“, zum „ungewaschenen Straßenkäfer“, ja sogar zur „Barbarin“ wird, und wenn das gestrenge Fräulein Rottenmeier alle Hebel in Bewegung setzt, um das von Heimweh geplagte Mädchen zu züchtigen, dann schwillt der rebellische Geist der Kinder bis zu einem so heftigen Grad an, dass sie noch als Erwachsene die Erschütterungen spüren, die das Schicksal des selbstbewussten Mädchens in ihnen ausgelöst hat.
Die unglaubliche Erfolgsstory Heidis hat wie jeder Longseller zahlreiche Ursachen. Natürlich liegt heute noch der Charme Heidis darin, dass sie die Erziehungsfunktion der Erwachsenen aushebelt. Die Autorin stellt sich konsequent hinter die Wünsche ihrer Heldin und lässt die Leser ihre Parteinahme deutlich spüren. Wenn Heidi in Frankfurt vor Heimweh fast zugrunde geht, wenn Klaras strenge Erzieherin, das grausame Fräulein Rottenmeier, nicht das geringste Verständnis für den Kulturschock zeigt, den Heidi erleidet und zudem die Mädchen ständig schikaniert, dann sichert Spyri damit den Lesern zu, dass sie berechtigt sind, diese Erziehungsperson von Herzen zu hassen. Allen Zorn gegen pädagogische Zwänge dürfen die Leser in Aversionen dem schrecklichen Fräulein Rottenmeier gegenüber abladen. Dieser Ventilfunktion gegenüber steht die Anteilnahme für das Schicksal Heidis, die in Frankfurt schier verzweifelt und nachts schlafwandelnd durch das Haus geistert. Kompensiert wird das Mitleid der Leser mit der Erfüllung eines Traumes, dem robinsonähnlichen Leben Heidis in der Hütte; mit ihrer Beziehung zu Tieren, ihrer rousseauistische Naturbegeisterung und ihrer Freundschaft mit einem Jungen, der zwar älter, aber doch deutlich unterlegen ist. Schließlich scheint die gutherzige Heidi den Wunsch jedes Kindes zu bestätigen, ein gutes Kind zu sein.
Doch diese Elemente allein machen noch keinen Welterfolg aus: Ohne die Ambiguität Heidis, ohne ihren Doppelcharakter, der zwischen Angepasstheit und Widerstand gegen die Erwachsenenwelt oszilliert, wäre der fortwährende Reiz des Romans nicht denkbar. Heidi ist genau betrachtet ein psychisch labiles Mädchen und nicht etwa das unverwüstliche Naturkind. Heidi ist nicht, wie oft fehlinterpretiert wurde, die „edle Wilde“, die an der bösen Zivilisation erkrankt. Da ihre Mutter mondsüchtig war, bringt sie schon eine Disposition zur Depression mit. Aus zahlreichen Briefwechseln geht hervor, dass Spyri aus eigener, leidvoller Erfahrung wusste, worüber sie schrieb. Dementsprechend vermied sie eine allzu platte Gegenüberstellung der natürlichen, gesunden Alpenwelt und der krankmachenden, großstädtischen Zivilisation. Jedoch konnte Spyri im zweiten Band der Versuchung nicht widerstehen, Heidi als Synthese von Stadt und Land zu stilisieren: Am Ende des Romans verkörpert Heidi jeweils das Positive der beiden Gegensätze, wird zu einem Artefakt, zum zivilisierten Naturkind.
Die Laufbahn als Schriftstellerin der 1827 in Hirzel geborenen Johanna Spyri begann erst 1871, mit 44 Jahren (ihr Sohn war damals bereits 16 Jahre alt), auf Drängen des Bremer Pastors Vietor (dem Vater einer Freundin Spyris, die in Zürich als Au-pair-Mädchen gearbeitet hatte). Vietor ermunterte Spyri zum Schreiben, da er ihr Talent entdeckt hatte und für seine diversen Publikationen literarisches Material brauchte. Spyris erste Erzählung Ein Blatt auf Vrony’s Grab erschien 1871 im Verlag des Bremer Kirchenblattes. Damit war Spyri, die zunächst nur für Erwachsene schrieb, zur religiösen Schriftstellerin geworden.
Erst 1878 erschien mit Heimatlos der erste Titel für Kinder. Spyri brachte ihre Bücher weiterhin in Deutschland, nicht etwa in der Schweiz heraus. Ihr Briefwechsel mit Vietor belegt, dass dies schon damals eine bewusste Entscheidung für den größeren Buchmarkt war. Hinzu kam die Überlegung, dass Leser, die die Schweiz selber nicht kannten, die alpenländische Atmosphäre noch stärker goutieren und zwischen übertriebener Idylle und der harten, der Autorin durchaus bewussten Realität (die Armut der Bergdörfer wird in den Romanen Spyris nur vorsichtig gestreift), nicht unterscheiden konnten. Die erste Schweizer Heidi-Ausgabe erschien erst 1918, lange nach dem Tod der Autorin.
Zum Welterfolg des Heidi-Romans trug die erstaunlich früh einsetzende mediale Verwertung der Geschichte und das große Interesse im Ausland bei: Bereits 1882 kam die erste französische Übersetzung heraus und 1884 die erste englische in Boston. 1920 entstand der erste (noch stumme) Heidi-Film in den USA. Spätestens nach der Verfilmung mit Shirley Temple 1937 setzte Heidis weltweiter Siegeszug ein, worauf Heidi vor allem in Japan Kultcharakter annahm: Der Comic mit dem unverwüstlichen Spring-ins-Feld Heidi wird heute noch von verschiedenen deutschen Fernsehsendern ausgestrahlt. Er ermuntert manche Zuschauer, den Original-Text zur Hand zu nehmen. „Das schönste Kapitel ist wohl der erste Tag auf der Alm“, schrieb Conrad Ferdinand Meyer. Und wer das gelesen hat, der hört nicht mehr auf.
27. November 2006Stichwörter:
Bardola, heidi, Kinderliteratur, spyri7 Kommentare
RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.


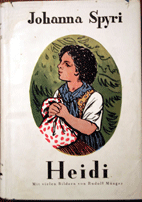
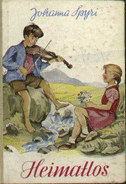
Willi Stroband schrieb am December 1, 2006:
Herzlichen Dank für diese warmherzige Einführung in das schriftstellerische Leben der Johanna Spyri und ihrem berühmtesten Roman…
Viele Grüße Willi Stroband
Paul Grotowski schrieb am December 2, 2006:
Den Kommentar kann ich nicht lesen, da er schwarz überlegt ist. Warum?
E. Sheridan-Quantz schrieb am December 4, 2006:
Ich habe “Heidi” als 6-jährige in einer ungekürzten englischen Übersetzung bei meinen Großeltern gelesen; für mich als irisches Kind war die Schweizer Bergwelt absolut exotisch, die Geschichte fand ich spannend und fesselnd. Fast 30 Jahre später habe ich die ungekürzte deutsche Fassung meinen kleinen Söhnen vorgelesen, ihnen gefiel es genauso gut. Für mich hat die Geschichte genau die richtige Mischung aus Charakterdarstellung, dramatischen Situationen, Nachdenklichkeit und einfach guter Erzöhlkunst, um ein wichtiger Kinderklassiker zu bleiben. Schade nur, dass so viele Kinder nur die total verkitschten, gekürzten Billigausgaben und Trickfilme kennen.
Claudia Jost schrieb am January 5, 2007:
Warum erscheint gerade jetzt eine Buchbesprechung unter einem Titel, der an das Buch “Hannah Arendt revisited” erinnert? Man hat den Eindruck, als ob dieser Besprechung eine zweite Sprache unterlegt ist, die absichtlich verbirgt und darum eher verdunkelt, statt zu erhellen. Dies gilt insbesondere für die – allzu allgemein gehaltenen Aussagen zur – Technik. Anspielungsarme Sprache wäre zumindest ehrlich.
Ekkehard Pölert schrieb am January 6, 2007:
An Paul Grotowski :
Das war bestimmt dieser Doderer… 😉
…ist ihm aber nicht gelungen.
Etwas wirklich Gutes lässt sich eben nicht mit ein paar Strichen aus dem akademischen “Blackpott” auslöschen.
Ekkehard
Gisela Hirschberg schrieb am February 15, 2007:
Man könnte noch ergänzen, dass es im Buch auch sehr komische Szenen gibt, bei denen Kinder von Herzen lachen, wie die Katzen im Haus Sesemann,
und sehr rührende Stellen, wie die Bekehrung des Großvaters an Heidis Bett,
bei der meine Freundin ihr ganzes Kopfkissen nassgeweint hat; dazu gibt es echte Spannung, wie die Szenen mit der immer wieder geöffneten Haustür.
Übrigens war Johanna Spyri Katholikin.
Alte Kinderbücher - Erinnerungen an vergangene Zeiten › Bücher Antiquitäten schrieb am May 26, 2013:
[…] eine Brücke zur eigenen Vergangenheit darstellen. Alte Kinderbücher, meist Klassiker wie “Heidi“, “Der Struwwelpeter” oder Abenteuerromane wie “Robinson Crusoe” […]