Rudolf Borchardt – Einzelgänger, Spracherneuerer und Symbol der Zerrissenheit der literarischen Moderne
von tergast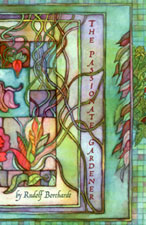
„Er war ein Mann des Privatdrucks“.
Die Sprache, das Rohmaterial der Dichter, war ihm das wichtigste, und trieb ihn sein Dichterleben lang um.
Rudolf Borchardt, 1877 geboren, mitten hinein in eine der intensivsten Epochen der deutschen Literatur, kommt heute in den Literaturgeschichten höchstens noch als Randbemerkung vor. Zu unzugänglich und abseitig erscheint sein Werk auf den ersten Blick.
Bereits der zweite Blick jedoch bemerkt eine ungeheure Vielfalt an Lyrik, Prosa, Essayistik, Übersetzungen, Reden, die in einem 68jährigen Leben (Borchardt starb 1945) kaum unterzubringen zu sein scheint.
Borchardt, eng befreundet mit einem der ganz großen Namen, Hugo von Hofmannsthal, versuchte das quasi Unmögliche: Die Restauration deutscher Sprachtraditionen von der Antike bis zur Klassik und Romantik in einem eigenen schöpferischen Prozess. Programmatisch dafür seine Rede von 1927 eben unter jenem Titel „Schöpferische Restauration“.
Jedes Werk sollte Borchardt, der an seinem Heimatland litt, wie wenig andere und viel Lebenszeit in Italien verbrachte, als Musterbeispiel seiner Gattung gelten können. Er selbst versuchte diesen Anspruch an Versepen wie dem „Buch Joram“ einzulösen und in einer Anthologie wie „Ewiger Vorrat deutscher Poesie“ vorzuführen, welche Traditionslinien ihm vorschwebten. Heute würde die Literaturkritik sein Werk wohl als „hermetisch“ klassifizieren. Wer sein Wissen über die Literatur der Moderne komplettieren möchte, sollte trotzdem zu Borchardt greifen und sich von seiner Sprachmacht inspirieren lassen. Es lohnt sich.
Die einen warfen ihm vor, ein blutrünstiger Kriegspropagandist zu sein (Fritz Brügel 1937 in einer Rezension von „Durch den Feind hindurch“). Die anderen wussten durchaus sein Konzept einer Poetik, die sich an der Tradition der Antike und Dantes orientierte, zu würdigen. Theodor Adorno schrieb 1968: „Die Widersprüche durchdringen sich […], werden nicht geschlichtet; ihn bestätigt, dass er den Konflikt bis zum Untergang austrug.“
Der, um den es hier geht, ist Rudolf Borchardt , geboren 1877 in Königsberg als Sohn des Kaufmanns und Bankiers (Borchardts Vater war kurzzeitig Besitzer der Privatbank „Breest und Gelpke“ in Berlin) Robert Martin Borchardt und seiner Frau Rose.
Borchardt gehört heute zu den Vergessenen der Literaturgeschichte, sein Werk war in jeder Beziehung einzigartig und mit einem umfassenden Anspruch ausgestattet, der letztlich nicht nur zeitgenössische und spätere Leser überforderte, sondern auch Borchardt selbst zugrunde gehen ließ.
Der junge Borchardt war, vor allem durch seine Freundschaft zu Rudolf Alexander Schröder, früher Mitarbeiter der Zeitschrift Die Insel, die letzterer gemeinsam mit Otto Julius Bierbaum und Alfred Walter Heymel ab 1899 in München herausgab und die die Keimzelle des Insel-Verlages werden sollte. Gleichwohl findet sich Borchardt heute kaum erwähnt, wenn es um Darstellungen der frühen Insel-Jahre geht, ein Umstand, der seiner latenten Schwierigkeit geschuldet ist, Bindungen einzugehen und durchzuhalten. Selbst die tiefen Freundschaften zu Schröder und zu Hugo von Hofmannsthal sind bis zuletzt immer wieder heftigen Krisen ausgesetzt, weil Borchardt sich als Eigenbrötler par excellence erweist, der sich ausschließlich seinem Projekt einer „Wiederherstellung der deutschen Überlieferung aus ihren Trümmern nach ihrem Zusammenbruch“ widmet, wie er 1927 schreibt.
Diesem Anliegen widmet er sich auf unterschiedliche literarische Art und Weise. Eigene poetische Werke wie die Verserzählungen Das Buch Joram (zuerst 1905 unter anderem Titel, dann 1907), Der Durant (1920) oder Der unwürdige Liebhaber (1929) zeugen ebenso von Borchardts hohem sprachlichen Anspruch wie die berühmte Anthologie Ewiger Vorrat Deutscher Poesie (1926) oder die landschaftshistorischen Monographien wie vor allem Villa (1908).
An Villa lässt sich auch am besten die ideengeschichtliche Position Borchardts zeigen, die in missliebiger Fehldeutung schließlich auch Interpretationen wie die eingangs erwähnte von Fritz Brügel hervorbrachte.
Borchardt steht mit seinem Werk für den Begriff der „Schöpferischen Restauration“ (so auch der Titel einer Rede, die Borchardt 1927 an der Universität München hielt), eine Idee, die beispielsweise auch Hofmannsthal propagierte, so etwa mit einer Anthologie wie Wert und Ehre deutscher Sprache, deren Erstausgabe ebenso wie Borchardts „Ewiger Vorrat“ im Verlag der Bremer Presse erschien. Auch der Essay Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation (1927) hat die gleiche Intention.
Stoßrichtung der „Schöpferischen Restauration“ ist letztlich, deutsche Kultur aus dem Erbe abendländischen Geistes von Antike bis Klassik zu erneuern und sie gegen zersetzerische Tendenzen zu verteidigen. Borchardt bewegte sich damit bewusst außerhalb dessen, was wir heute unter Literatur der Moderne verstehen und vom Naturalismus über die Jahrhundertwende bis zum Expressionismus zu recht als avantgardistisch und künstlerisch bedeutend bewundern.
Doch war es gerade dieses Einzelgängertum, dieser unbedingte Wille zur Form und zur Wahrung künstlerischen und vor allem sprachlichen höchsten Anspruchs, der ihn heute wieder lesenswert macht. Denn nur ein Phänomen wie Borchardt kann einem die Zerrissenheit der Literatur an der Wiege des individualistischen Zeitalters wirklich deutlich machen.
Borchardts Bindeglied zur zeitgenössischen Literatur ist zweifelsohne Hofmannsthal, einst der „Star“ unter den großen Wiener Literaten. In jungen Jahren war dieser von ästhetizistischen Tendenzen beseelt, deren Wiederkehr der Versuch der späten Jahre ist, im Programm der Schöpferischen Restauration zurück zu einer Reinheit der Sprache und der Form zu finden, die letztlich das künstlerische Erbe der deutschen Klassik bewahrt.
Rudolf Borchardts Anspruch war es letztlich, jedes einzelne literarische Werk zu einem Muster der jeweiligen Gattung werden zu lassen, diesem Anspruch ist sowohl sein umfangreiches lyrisches Werk zuzuordnen, wie auch die bereits erwähnten Verserzählungen, unter denen noch Die Beichte Boccino Belfortis (1923) zu erwähnen ist, die formengeschichtlich in ihrer Entstehung seit 1905 eng mit dem Projekt einer definitiven deutschen Dante-Übersetzung zusammenhängt. Diese Übertragung der divina comedia, 1930 als Dante. Deutsch abgeschlossen, zeigt wohl am eindringlichsten Borchardts intensive eigenständige Sprachleistung.
Borchardt war, mit einem weiteren Wort Adornos, „sein Leben lang der Mann der Privatdrucke“, für den Liebhaber antiquarischer Bücher erschließt sich hier also ein breites Sammelfeld von frühen, kaum noch auffindbaren Drucken etwa seiner Lyriksammlungen bis zu späten Ausgaben der bekannteren Werke.
Rudolf Borchardt, der den Begriff des „poeta doctus“ lebte, wie kaum ein anderer, starb 1945 in Trins in Tirol.
Rudolf Borchardt im ZVAB:
Geschichte des Heimkehrenden (Das Buch Joram ) (1905)
Das Gespräch über Formen und Platons Lysis deutsch (1905)
Rede über Hofmannsthal (1905)
Das Buch Joram (1907)
Villa(1908)
Hesperus. Ein Jahrbuch (gemeinsam mit Hofmannsthal und Schröder, 1909)
Der Krieg und die deutsche Selbsteinkehr (1915)
Der Krieg und die deutsche Verantwortung (1916)
Swinburne. Deutsch (1919)
Der Durant. Ein Gedicht aus dem männlichen Zeitalter (1920)
Die Päpstin Jutta. Ein dramatisches Gedicht (1920)
Schriften. Prosa I (1920)
Die halbgerettete Seele. Ein Gedicht (1920)
Dante: Vita nova (1922)
Krippenspiel (1922)
Poetische Erzählungen (1923)
Die geliebte Kleinigkeit. Ein Schäferspiel in einem Akte und in Alexandrinern (1923)
Die Schöpfung aus Liebe (1923)
Über den Dichter und das Dichterische. Rede (1924)
Vermischte Gedichte. 1906-1916 (1924)
Altionische Götterlieder unter dem Namen Homers (1924)
Der ruhende Herakles (1924)
Klage der Daphne (1924)
Die großen Trobadors (1924)
Deutsche Denkreden (1925)
Gartenphantasie (1925)
Hartmann von Aue: Der arme Heinrich (1925)
Ausgewählte Werke 1900-1918 (1925)
Ewiger Vorrat deutscher Poesie (1926)
Der Deutsche in der Landschaft (1927)
Handlungen und Abhandlungen (1928)
Die Aufgaben der Zeit gegenüber der Literatur (1929)
Pindarische Gedichte (1929)
Das hoffnungslose Geschlecht. (1929)
Dante. Deutsch (1930)
Führung. Rede (1931)
Deutsche Literatur im Kampfe um ihr Recht (1931)
Deutsche Reisende – Deutsches Schicksal (1932)
Pamela. Komödie in drei Akten. Neu erfunden (1934)
Schriften (1934)
Englische Dichter (1936)
Staufer. Tragische Pentalogie (1936)
Vereinigung durch den Feind hindurch (1937)
Pisa. Ein Versuch (1938)
Der leidenschaftliche Gärtner. Ein Gartenbuch (1951)
Seiten über Rudolf Borchardt im Internet:
Rudolf Borchardt-Archiv
Daten zu Leben und Werk
Thomas Anz zur Borchardt-Kritik von Fritz Brügel
Stichwörter:
Deutsche Sprache, Literarische Moderne, Lyrik, Rudolf Borchardt, tergast, Zu gut zum Vergessen3 Kommentare
RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.


David Falstaff schrieb am June 28, 2007:
„Borchardt bewegte sich damit bewusst außerhalb dessen, was wir heute unter Literatur der Moderne verstehen und vom Naturalismus über die Jahrhundertwende bis zum Expressionismus zu recht als avantgardistisch und künstlerisch bedeutend bewundern.“ schreibt Carsten Tergast. Das hört sich nicht nur wie aus einem Hausaufsatz für die gymnasiale Oberstufe an, es zeigt auch eine völlige Verkennung des Anspruches von Borchardt und kann so natürlich nur die langweilig soziologische Sicht auf das Phänomen Borchardt und Moderne nur unterstützen. Borchardt, und – George, und – Robert Walser, und – Kafka, und – Karl Kraus, und Hiller und Hoddis und …und: alle diese wollten wirken in ihrer Zeit. Keiner von denen hat „sich bewußt außerhalb dessen, was wir heute unter Literatur der Moderne verstehen“ bewegt. Sie, George, Hofmannsthal, Rilke, die Mitarbeiter der Zeitschrift Die Insel waren die Moderne. Daher auch die Polemik, die Bündnisse, Zerwürfnisse u.ä., der literarische Diskurs wird von diesen Wertphilologen ignoriert. Wenn C.T. eine Aufwertung der Bedeutung Borchardts bei der Betrachtung des Insel-Kreises wünscht, ist zu befürchten, daß diese Aufwertung zu lasten von anderen geht, Robert Walser oder Franz Blei oder Kurt Schwitters etwa.
Borchardts Wannsee, programmatisch im ersten Heft der programmatischen Zeitschrift Die Weißen Blätter erschienen, ist Hipphopp. Seine leidenschaftlichen Polemiken sind Kritik der Literaturbetriebsamkeit der Moderne, auch hier in diesem Kampf war er „alles, nur nie gemütlich, niemals kleinlich und niemals käuflich“ (Alewyn)
Die streitbare Poetik (Poelemik) der Kraus, Borchardt, George, Hiller, Scheerbart, Hofmannsthal war nicht zu korrumpieren, sie wenden sich immer gegen die herrschenden Meinungen. Heidegger, Benn, Pound waren korrumpierbar.
Dem militanten Humanismus werden die „Immerseligen“ kaum nachfühlen können, sie wären das dann nicht mehr, immerselige Tröpfe. Es gibt einen Text von Paul Scheerbart, in dem er 1909 eine Raketentechnik propagiert, die den letzten Vorstellungen eines Raketenabwehrsystems (SDI oder neuere) des 21. Jahrhunderts ganz und gar entspricht. Die Windmühlen, gegen die Paul Scheerbart 1909 anzukämpfen suchte, waren die beispiellos gewachsenen See- und Landheere. Als Konsequenter Flugmilitarist forderte er die Abschaffung dieser Heere, aller, nicht nur der gegnerischen. In diesem Sinne war auch Borchardt militant.
„Der Bogen seines beschwörenden Gestus schwang so weit über alles Heimelige, über das falsch mittlere Glück von Stallwärme und deutscher Idylle hinaus, daß er bei Konservativen nicht weniger anstieß als sein Konservatismus bei der Linken und der literarischen Avantgarde.“ (Adorno über Borchardt) „Was alle an ihm schmähen; worin der Allerweltshumanismus, der den Menschen wie sie sind nach dem Munde redet, und das hinter allgemeinem Einverständnis verschanzte Privileg gegen ihn sich zusammenfanden, ist an ihm zu verteidigen.“ (Adorno). Ich bin neugierig, ob es diesem treudoofen Allerweltshumanismus, „der den Menschen wie sie sind nach dem Munde redet“ und gierig nach allgemeinen Beifall nur das Privileg des Blog-Warts suchen, gelingt, diese prächtig Irren in ihrem Stumpfsinn einzubinden und so lahm zu legen.
David Falstaff schrieb am June 29, 2007:
Der letzte Satz ist zu berichtigen: “Ich bin neugierig, ob es diesem treudoofen Allerweltshumanismus, „der den Menschen wie sie sind nach dem Munde redet“ und gierig nach allgemeinem Beifall nur das Privileg des Blog-Warts sucht, gelingt, diese prächtig Irren in ihrem normalen Stumpfsinn einzubinden und so lahm zu legen.”
Antiquariat Marcus Haucke Berlin schrieb am December 2, 2007:
Borchardt hat wie kaum einer, Brecht vielleicht noch, die schärfste dichterische Abgrenzung gegen die Nazis gesucht und in seinen politischen Jamben Mitte der 30er Jahre gefunden. Als Ausdruck des Protestes gegen die Zunahme von trüben Nationalgesinnungen unter den Anbietern des zvab u.a. möchte ich aus seiner nomina odiosa (schlechte Namen) hier zitieren
…..dies ist schlechterdings
Dreck. Trockener, angemachter, aufgeweichter Dreck,
Zerfallener Dreck, gepreßter Dreck,
Gedruckter, Scheißdreck, Dreckgesinnung, dreckige
Visage, frech wie Straßendreck,
Dreckseelen, Selbstverdreckung, Schund und darum Dreck,
Halbecht, einen Dreck wert, nachgemacht,
Gepatzt, gekitscht, gepfuscht, gestohlen, falschgemünzt,
Mit Dreck zu Dreck und wieder Dreck.
Oh wol auf Gleich geschaltet, wol auf Rasse sind
Die Steißgesichter, daß sie zwar
Sich wie die Hintern gleichen, nicht wie Antlitze
…
Einige von diesen Anbietern sind auch auf anderen Buchdatenbanken zu finden, die haben nur keinen Blog. Ich will keine Aufseher über das Angebot, doch vielleicht kann man deutlich machen, daß diese Angebote nicht willkommen sind, in dem ein Forum für den Widerwillen geöffnet wird. Die einfache Titelaufnahme muß noch kein Anlas für Unwillensäußerungen geben, ausschlaggebend ist für mich die propagandistische Ausgestaltung von Titelaufnahmen.