Russische Schriftsteller der Emigration(en)
von wietekOhne die vielen russischen Dichter, Komponisten, Musiker und Künstler aus dem 18. und 19. Jahrhundert ist die europäische und besonders die deutsche Kultur nicht denkbar – und selbst danach, zu Beginn bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, haben die verschiedenen Emigrantenwellen ungeheuer befruchtend auf unser Geistesleben gewirkt, – wieweit das auch für die neueren Wellen gilt, wird man erst rückblickend sagen können.
In Russland waren Politik und Literatur schon immer eng miteinander verquickt; Dichter waren weit mehr als im Westen das soziale Gewissen der Nation. Schon Puschkin, der für den Beginn der russischen Literatur steht, musste leidvolle Erfahrungen hinnehmen. Es gab aber auch niemanden, der diese Aufgabe in einem absolutistischen Staat hätte erfüllen können. Ganz offensichtlich wurde dies bei den Revolutionären Majakowski, Fürst Kropotkin, Gorki (der differenzierter zu beurteilen ist) und vielen mehr. Viele Dichter gingen, auch ohne Revolutionär geworden zu sein, in die Verbannung nach Sibirien oder wurden im günstigsten Fall aus den Metropolen und damit aus der Gesellschaft verbannt.
Das heißt, Politik ist in Russland (bis heute) aus der Literatur nicht weg zu denken und wird daher auch immer wieder Thema sein.
Als nolens-volens Angehöriger der 68er Generation stehen mir bestimmte Schriftsteller näher als andere. Insbesondere sind dies die Schriftsteller, Musiker und Künstler der vier Emigrantenwellen. Viele von Ihnen verstanden sich ursprünglich nicht als Emigranten, denn sie wollten wieder zurück in „ihr“ Russland – weshalb die Begriffsbestimmung „Emigrant“ manchmal schwierig ist und man von unterschiedlich vielen Emigranten-Generationen spricht. Wir assoziieren heute (meist unbewusst) mit Emigranten: Wirtschaftsflüchtling, kostet uns Geld, ist anders, fremd, vielleicht Feind – heute gar potenzieller Terrorist – stört ganz allgemein unsere Ruhe. Dass auch Menschen aus Angst um Leib und Leben flüchten, akzeptieren wir zwar, sind jedoch unbesehen der Meinung, dass diese weit in der Minderzahl sind. Was Emigration für den Einzelnen jedoch bedeutet, versuchen wir selten nachzuvollziehen.
Russen bedeutet die Verwurzelung in ihr Land, ihre Erde („Mütterchen Russland“) bedeutend mehr als anderen Völkern, selbst wenn diese eine starke Bindung an ihre Heimat haben. Ein Russe fern seiner Heimat ist wie ein aufs Trockene geratener Fisch. Emigration ist daher das schlimmste Schicksal.
Und die russischen Emigranten damals mussten um Leib und Leben fürchten. Heute ist das vielleicht differenzierter zu sehen, damals jedoch war es der „worst case“ (um etwas moderner zu klingen).
Zu der ersten Emigrantenwelle gehörten die um die Jahrhundertwende und kurz danach vor dem Zaren geflohenen Antimonarchisten, Sozialdemokraten und Revolutionäre, Schriftsteller und Künstler.
Beispiele: Gorki (1906), Lenin (1900), Kandinsky (1897), Werefkin und Jawlenski (1896), Ilja Ehrenburg (1908), Sergej Diaghilew (1914) und viele andere. Ein Teil von ihnen kehrte nach der Oktober-Revolution 1917 wieder nach Russland zurück, einige flohen dann erneut vor den Bolschewiken.
Die zweite Generation flüchtete aus Russland einige Jahre vor der Oktoberrevolution; dies waren Adelige, hohe Beamte und Militärs des Zaren, Gutsbesitzer, Monarchisten; für manche war es nur ein Umzug an ihren Zweitwohnsitz in Berlin, Paris, Nizza oder andere Kurorte.
In der dritten Welle vor und nach der Machtübernahme der Bolschewiki – sehr viele flohen um das Jahr 1922 – waren die schon einmal geflohenen Sozialdemokraten (die Menschewiki), die Offiziere der Weißen Armee, die mit Unterstützung des Westens gegen die Rote Armee gekämpft hatten, und wieder Wissenschaftler, Schriftsteller und Künstler.
Einige Namen: Gorki (1921 zum zweiten Mal – auf „freundliches“ Betreiben Lenins), der weißrussische General Denikin (1920), Ilja Ehrenburg (1921 zum zweiten Mal), Nikolai Berdiajew (1922), der Menschewikiführer Martow (1920), Lydja Cederbaum (1922), Nina Berberowa (1922), Wladimir Nabokov (1919), der von Lenin gestürzte Ministerpräsident Russlands Kerenski (1918), Sergej Prokofieff (1919), der weltberühmte Sänger Fjodor Schaljapin (1922), Boris Saizew (1922), das Schriftstellerehepaar Sinaida Hippius und Dmitri Mereschkowski (1919), Sergej Bulgakow (1922), Marina Zwetajewa (1922), Iwan Bunin (1922), der Jugendfreund von Lenin Nikolai Wolski (1928) und, und, und – die Liste ergäbe ein Buch.
Zur letzten Generation gehören dann alle, die vor Stalin und allgemein vor dem Sowjetregime bis in die 60er und 70er Jahre geflohen sind (was dann nicht immer leicht war), die Ausgewiesenen und die Ausgebürgerten und die „displaced persons“ (das waren die während des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland verschleppten Arbeitssklaven und von der Wehrmacht Gefangene, die sich vor der Rückführung durch die Amerikaner verstecken konnten, denn sie wussten um Stalins Verurteilung aller Gefangenen und Verschleppten als Feiglinge, Deserteure und Spione.
Beispiele: Der durch einen Prozess berühmt gewordene hohe sowjetische Funktionär Wiktor Krawtschenko (1944), Jewgeni Samjatin (1932 sogar mit Erlaubnis Stalins), Iwan Jelagin (1940) und viele tausend Unbekannte.
Am Ende dieser Wellen war Russland kulturell ausgeblutet.
Bevorzugtes Ziel der Emigranten war Berlin (nur bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges) und Paris.
Das Kulturleben Berlins erlebte durch die Emigranten geradezu eine Blütezeit – ein spannendes, aber eigenes Thema –, hier traf sich alles was Rang und Namen hatte in Literatur, Musik und Malerei; aber auch ehemalige Adelige, reiche mit viel Geld, und solche, die sich jetzt als Taxichauffeur, Kellner oder sonstwie durchs Leben schlugen. Es waren derer soviel, dass es in vielen Gebieten Berlins schwer war überhaupt ein deutsches Wort zu hören (wie sich die Zeiten doch gleichen!)
Eine sehr gute Beschreibung dieser Zeit liefert Karl Schlögel mit »Berlin Ostbahnhof Europas. Russen und Deutsche in diesem Jahrhundert«
Paris stand Berlin nicht viel nach, wurde aber erst mit Beginn der NS-Zeit die Welthauptstadt der Emigranten. Durch die Besetzung Frankreichs und die Vichy-Regierung nahm aber auch dies ein abruptes und schmerzvolles Ende, es folgte – so sollte man glauben – die letzte Emigrationswelle in die USA. Weit gefehlt!
Nach dem Krieg war die französische Regierung stark kommunistisch geprägt (ein Drittel der Franzosen stimmten für die kommunistische Partei) und außerdem war sie extrem sowjetfreundlich – man denke nur an die Schriftsteller und Philosophen, die ihren Kotau vor Stalin machten.
Die sowjetische Regierung (sprich Stalin) stellte Auslieferungsanträge („Repatriierung“ war das Losungswort), und die französische Regierung schickte Emigranten eifrig zurück ins „gelobte“ Land, wo sie dann ins Jenseits oder den Gulag befördert wurden. Frankreich wollte mit den Exilrussen nichts zu tun haben, wies sie außer Landes und war froh, dass viele schnellstmöglich freiwillig sich auf und davon machten – wohin? Es blieb nur noch die USA, manche flohen nach Lateinamerika.
Einige dieser Schriftsteller werden in den nächsten Monat an dieser Stelle aus dem Exil des Vergessens zurückgeholt, um ihnen den gebührenden Platz zuzuweisen, den sie verdienen: Im Licht der Öffentlichkeit. Den Anfang wird im nächsten Monat Nina Berberowa machen.
Literatur: (Literatur-, Kultur- und Geschichte)
Schlögel, Karl: Berlin Ostbahnhof Europas (oder neu: Das Russische Berlin)
Berberowa, Nina: Ich komme aus St. Petersburg (Autobiographie)
Schramm, Godehard: Russland ist mit dem Verstand nicht zu begreifen
Figes, Orlando: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1917
Figes, Orlando: Nataschas Tanz Eine Kulturgeschichte Russland
Lauer, Reinhard: Geschichte der russischen Literatur Von 1700 bis zur Gegenwart
Ingold, Felix Philipp: Der grosse Bruch Russland im Epochenjahr 1913
Hosking, Geoffrey: Russland Nation und Imperium 1552 – 1917
Jakowlew, Alexander: Die Abgründe meines Jahrhunderts Eine Autobiographie
Jakowlew, Alexander: Ein Jahrhundert der Gewalt in Sowjetrussland
Schmemann, Serge: Ein Dorf in Russland Zwei Jahrhunderte russischer Geschichte
Stichwörter:
Berberowa, Emigration, Gorki, Kulturgeschichte, Nabokov, Revolution, Russland, Sowjetunion, Wietek16 Kommentare
RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.



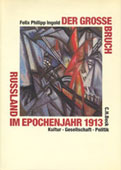
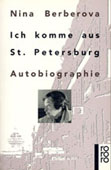
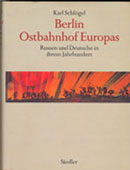
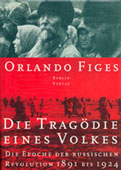
CMG schrieb am September 15, 2007:
das ist ein sehr gutes Thema, und auch eine gute Liste…
obwohl ich Frau Berberowas Erinennerungen immer als aufdringlich egozentrisch empfunden habe…
Herrn Schmemanns Erinnerungen waren in den frühen 90er Jahren sehr aufschlußreich, aber diese Epoche, die er beschreibt, ist auch schon vergessen, vorbei …
Aber Ingold! Und Schlögl!
Hanns-Martin Wietek schrieb am September 16, 2007:
Danke Frau CMG.
Frau Berberowa war – schon von Haus aus, aber auch durch die Zeitumstände geprägt – eine starke Persönlichkeit, was natürlich zu spüren ist. Aber zu dieser “Grande Dame” komme ich demnächst.
Schmemanns “Ein Dorf in Russland” ist wahrlich ein aufschlussreicher und nostalgischer Genuss; vielleicht können wir an dieser Stelle diese vergangene Epoche wenigstens literarisch wieder aufleben lassen – aber, wie Sie wissen, existiert sie in den Weiten Russlands noch mancher Orts ein bisschen.
Zu Ingold und Schlögel kann man wirklich nichts hinzufügen, außer vielleicht auf zwei weitere faszinierende Titel von Schlögel hinzuweisen:
Karl Schlögel: Go East oder die zweite Entdeckung des Ostens (vorgestellt hier)
und
Karl Schlögel: Moskau lesen. (vorgestellt hier).
Wie einen packenden Krimi habe ich gelesen “Figes, Orlando: Nataschas Tanz Eine Kulturgeschichte Russlands”; (vorgestellt hier) leider antiquarisch bisher nur in englischer Sprache zu erhalten.
Danke, bis bald,
Hanns-Martin Wietek
Anne Edelhoff schrieb am September 17, 2007:
Danke, Herr Wietek, aber eine sehr wichtige Schriftstellerin haben Sie nicht erwähnt:Lydia Tschukowskaja.Sie hat leider nur zwei Bücher verfasst(Untertauchen und Ein leeres Haus),aber kaum eine/r beschreibt den stalinistischen Terror eindringlicher als sie.Falls nicht bekannt, bitte lesen!!!
Hanns-Martin Wietek schrieb am September 17, 2007:
Tja, liebe Frau Edelhoff,
nicht alles kann man wissen – Mut zur Lücke. Aber ich habe mein Versäumnis nachgeholt und beide Bücher schon – raten Sie mal wo. Richtig – bestellt.
Beste Grüße
hmw
Ralf Walter schrieb am September 19, 2007:
Hallo Herr Wietek,
auch meinerseits danke für Ihre Ausführungen. Als Jemand, der selbst russisch liest und sich auch (hobbymässig) stark für russische Literatur interessiert, möchte ich gerne noch auf zwei meiner Meinung nach wichtige Quellen verweisen:
F Mieraus “Russen in Berlin” (Quadriga 1988), in dem es freilich nicht nur um Literaten geht, aber auch; sowie
M Schischkin “Die russische Schweiz” Limmat Verlag, 2003).
Natürlich gibt es unendlich mehr.
Und: ich bin auch gespannt auf die Vorstellung der egozentrischen Berberowa.
Noch ein P.S. zur Anmerkung von Frau Edelhoff: Phantastisch sind von L Tschukowskaja ihre Aufzeichnungen über Anna Achmatowa, die aber leider (soweit mir bekannt) noch nicht ins Deutsche übersetzt sind.
Liebe Grüsse aus Luzern in die Runde
Hanns-Martin Wietek schrieb am September 19, 2007:
Seien Sie gegrüßt, Herr Walter.
Der Zuspruch tut mir natürlich gut; und wenn ich mir die Leserzahlen meines Beitrags anschaue, bin ich guten Mutes – das Thema scheint doch weit mehr Lesern wichtig zu sein, als ich zu hoffen gewagt hatte.
Nun zu Tschukowskajas Aufzeichnungen über Anna Achmatowa: die gibt es auch auf Deutsch, und sogar hier
Ich finde es hervorragend, dass unsere Literaturliste unentwegt erweitert wird; irgendwann demnächst werde ich alle Anregungen in einer Liste zusammenfassen.
Hier schon einmal der Link auf Mierau, Russen in Berlin
und auf
Schischkin, Die russische Schweiz, ein Thema, das allein schon eines eigenen Beitrags wert ist – man denke nur an die Maler Jawlenski, Werefkin und viele andere berühmte mehr (ich will hier nicht kunstgeschichtlich werden, dafür ist meine Frau zuständig).
Dass Nina Berberowa so einen schlechten Ruf hat, erstaunt mich etwas – aber “wir werden sehen” wie man in Russland sagt.
Herzliche Grüße nach Luzern und in die offensichtlich weite Runde
hmw
Ralf Walter schrieb am September 19, 2007:
Guten Abend Herr Wietek,
ohne besserwisserisch sein zu wollen und ohne eine Tschukowskaja-Serie zu starten: Ich meine die dreibändige Ausgabe aus dem Verlag “Soglasije” von 1997- wenn Raissa Kopelewa etwas übersetzt hat, dann können es (nach dem Erscheinungsdatum) nur Auszüge sein.
Ich freue mich auch auf die beginnende Diskussion und möchte nur noch fragen, ob Sie auch auf die “vierte Welle” der Emigration eingehen wollen- ich rede von den frühen Neunzigern, da sich (u.a.) in Berlin eine interessante Szene herausbildete- einerseits wurden “Alte” wie F Gorenstein integriert, andererseits gab es auch Bestrebungen, eine literarische Enklave in Gestalt eigener Zeitschriften (Studia, Ostrow, Zerkalo Zagadok…) zu schaffen. Ich habe damals interessiert teilgenommen- vielleicht auch interessant?
Einen schönen Abend noch wünscht
Ralf Walter
Hanns-Martin Wietek schrieb am September 20, 2007:
Lieber Herr Walter,
keine Sorge, das hat nichts mit Besserwisserei zu tun; im Gegenteil, wir alle sind über zusätzliche Informationen froh.
Zur Welle Anfang der Neunziger will ich mal noch keine Versprechungen machen. Da gibt es vorher noch viel zu tun. Obwohl natürlich sehr interessant – auch im Zusammenhang mit der Perestroika-Literatur (z.B. Ogonjok, 1988-1990)
Herzliche Grüße
Ihr
hmw
Hanns-Martin Wietek schrieb am September 23, 2007:
Seien Sie gegrüßt, Frau Edelhoff.
Nochmal zu Ihrem Kommentar vom 17.09.
Es ist eine Unsitte vieler Verlage bei der Wiederauflage eines Buches, sich einen neuen Titel auszudenken – und ich bin zum (ich weiß nicht wievielten Mal) darauf hereingefallen.
Tschukowskajas “Opustelyi Dom” zu deutsch “Geleertes Haus” erschien 1967 im Diogenes Verlag unter “Ein leeres Haus” (was dem russischen Titel nur in etwa nahe kommt) und 1990 im selben Verlag unter “Sofia Petrowna”; das Buch habe ich 2003 hier vorgestellt. Ich werde in Zukunft bei Buchbesprechungen den Originaltitel in der jeweiligen Sprache mit aufnehmen.
Und ich gebe Ihnen Recht: Es ist ein wirklich ganz wichtiges Buch zu dieser Zeit; insbesondere wenn man auch den persönlichen Hintergrund erfährt.
Nochmals Danke für Ihren Hinweis.
Mit besten Grüßen
hmw
Anne Edelhoff schrieb am September 25, 2007:
Guten Tag, Herr Wietek,
es tut mir leid, dass ich nicht darauf hingewiesen habe.Es war mir bekannt, dass das Buch unter zwei Titeln erschienen ist.(Eine Unsitte,wie ich auch finde!)Mit dem zweiten Buch meinte ich auch “Untertauchen”.
Aber es ist ja nie verkehrt, ein gutes Buch,welches man zweimal besitzt, zu verschenken, oder?
Schöne Grüße!
Peter Nink schrieb am September 27, 2007:
Guten Tag,
wenn es Ihnen um eine aussagekräftige Literaturliste geht, möchte ich folgende Werke empfehlen:
Dmitri S. Lichatschow, Erinnerungen. Der 1906 geborene Mediävist beschreibt die Ereignisse während seiner Lebensspanne bis zur Ära Gorbatschow
Wladimir Schalamow. Endlich wird es eine Ausgabe seines Gesamtwerkes in deutscher Sprache geben.
André Sinjawski. Die Übersetzerin S.Geier fungiert als Herausgeberin der Werke dieses ungemein gebildeten Literaten. Als Beispiel sei hier nur der Essay über den Sozialistischen Realismus genannt, den er bereits in den Jahren vor seiner Verhaftung schieb.
Ansonsten möchte ich allen Interessierten an der russischen/sowjetischen Literatur, die die Erfahrungen und Leiden des vergangenen Jahrhunderts zum Thema haben, meine große Wertschätztung ausdrücken. Diese Werke sind für die ganze Menschheit von großer Bedeutung. Dazu gehören aber selbstverständlich auch Autoren anderer osteuropäischer Länder wie Gustaw Herling aus Polen oder Alexander Tisma aus Serbien.
Freundliche Grüße
Hanns-Martin Wietek schrieb am September 28, 2007:
Lieber Herr Nink,
es ist wunderbar, immer wieder diesen Zuspruch zu erfahren, und gleichzeitig wertvoll für mich und alle Leser unserer Kolumne, immer wieder auf Zusätzliches hingewiesen zu werden.
Ich stimme Ihnen in jedem Punkt zu.
Zu Sinjawski und Frau Geier: Das Gesamtwerk von Sinjawski liegt vollständig von Frau Geier übersetzt vor und beim S. Fischer Verlag “auf Halde”. Noch scheinen sich die Vertreter der ideellen und der kommerziellen Seite nicht einig zu sein.
Es sind wohl die üblichen Argumente wie “wer kennt schon ……..?” und “wie wird sich das rechnen?”
Dass das die 84jährige Grande Dame der Russisch-Übersetzer, Ehrendoktorin der Universität Freiburg und Preisträgerin der Leipziger Buchmesse 2007 in der Kategorie Übersetzung nicht glücklich stimmt, ist verständlich.
Wir sollten sie unterstützen, wobei ich mir alle Mühe geben werde.
Herzliche Grüße
Ihr
hmw
Hanns-Martin Wietek schrieb am September 28, 2007:
Ps.
Dmitri S. Lichatschows Erinnerungen, deutscher Titel “Hunger und Terror” herausgegeben 1997 im Verlag Edition Tertium ist weder im ZVAB noch im Handel erhältlich, beim Verlag aber noch gelistet; müsste dort bestellt werden.
Grüße
hmw
Liliana Kern schrieb am October 18, 2007:
Lieber Herr Wietek,
als eine kleine Ergänzung zu Ihrer Liste möchte ich ebenfalls ein Buch, das meine Wenigkeit verfasst hast, und das das Thema der Oktoberemigration behandelt, hinzufügen. Es geht um das Leben der Nina Petrowskaja, der Muse und Femme fatale der russischen Dekadenz. Das Buch hat den Titel “Der feurige Engel” ist 2006 im Berlin Verlag erschienen.
Viel Grüße
Liliana Kern
Hanns-Martin Wietek schrieb am October 19, 2007:
Liebe Frau Kern,
danke für den Hinweis. Ist mir eigentlich unverständlich, dass mir Ihr Buch entgangen ist, da ich mit dem Berlin Verlag in bestem Kontakt stehe.
Wird sofort nachgeholt und vorgestellt, habe es bei Herrn Sommerfeldt schon bestellt.
Beste Grüße
Ihr
hmw
Das Erbe der Dekabristen, Teil 1 « ZVABlog schrieb am September 15, 2008:
[…] Anfang des ersten Essays in der Kolumne Russlands romantische Revolutionäre – Russische Schriftsteller der Emigration(en) – lautete: „Ohne die vielen russischen Dichter, Komponisten, Musiker und Künstler aus dem […]