Ernst Glaeser – gefeiert, verfemt, vergessen. Zur Karriere eines deutschen Schriftstellers
von tergast„Ich kann mit diesem Buch wenig anfangen. Das kann an mir liegen. Und deshalb ist der Autor, der eine der saubersten und anständigsten Erscheinungen der jüngern Generation ist, noch lange kein wilder Höllenhund. Er hat Anspruch darauf, gehört zu werden. Der Mann hat episches Talent. Er hat auch einen leisen Humor. Möge er sein Talent von keinem Stoff und von keiner Doktrin auffressen lassen.“

Ernst Glaeser
Am 16.12.1930 erscheint in der Weltbühne eine Kritik an Ernst Glaesers gerade erschienenem Roman Frieden. Rezensent Peter Panter, eines der journalistischen alter egos des berühmten Kurt Tucholsky, verleiht darin vor allem mit der letzten Bemerkung einer Hoffnung Ausdruck, die Glaeser auf eindrucksvolle Art und Weise nicht erfüllen konnte.
Der Name Ernst Glaeser hat in der deutschen Literaturgeschichte einen eigentümlichen Beigeschmack, zeigt doch die Karriere dieses Autors Risse und Brüche wie nur wenig andere. Und Ansatzpunkte zur Kritik gibt es, sicherlich, doch ist letztlich alles menschlich, allzumenschlich…
Als der erste Weltkrieg ausbricht, ist der 1902 geborene Glaeser noch nicht allzu unmittelbar mit der Realität des Krieges konfrontiert. Nichtsdestotrotz sind diese Zeit und dieser Krieg maßgeblich für seinen literarischen Aufstieg. Als Angehöriger einer Zwischengeneration schreibt er mit Jahrgang 1902 (1928) einen großen – und nicht zuletzt auch sehr erfolgreichen – Roman, der seinen Geburtsjahrgang gleichsam zum literarischen Begriff macht.
Schon mit dem Motto von Jahrgang 1902 – „La Guerre, ce sont nos Parents“ – wird die Elterngeneration voll für Krieg und Verderben verantwortlich gemacht. Der Roman zeichnet ein soziologisch ausgefeiltes, genau beobachtetes Bild der wilhelminischen Gesellschaft und wird damit zur Anklageschrift gegen die in sexueller, moralischer und politischer Hinsicht „verlogene Gesellschaft der Väter“. Die Wirkung des Romans war enorm, „ein verteufelt gutes Buch“, soll etwa Ernest Hemingway geurteilt haben, und Thomas Mann wird nachgesagt, Glaeser ein außerordentliches schriftstellerisches Talent attestiert zu haben.
Der tiefen Abneigung gegen die Welt der Eltern hatte Glaeser zuvor schon in zwei Dramen Ausdruck verliehen: Überwindung der Madonna (1924) und Seele über Bord (1926), das sogar dafür sorgte, dass der Autor einen Prozess wegen Gotteslästerung am Hals hatte.
Seine Karriere aber kommt erst mit dem Erfolg des Antikriegsromans in Fahrt. Er wird literarischer Leiter des Südwestfunks, arbeitet dabei weiterhin für die Frankfurter Zeitung und veröffentlicht 1929 unter dem Titel Fazit, Querschnitt durch die deutsche Publizistik eine Sammlung von Essays, die sich an den Glaubenssätzen der Neuen Sachlichkeit orientiert.
Mit dem Ende der Weimarer Republik und dem heraufziehenden Nationalsozialismus wird die literarische Karriere des Ernst Glaeser dann langsam zum „Fall Glaeser“, der bis heute nur schwer nachvollziehbar ist.
Glaeser steht zu Beginn der 1930er-Jahre der KPD nahe, ist Mitglied im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller und veröffentlicht 1931 gemeinsam mit Franz Carl Weiskopf Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre ‚Fünfjahresplan’. In der Folge muss er wie viele seiner Kollegen 1933 erleben, dass seine Bücher auf den Scheiterhaufen der braunen Kulturvernichter landen und er wie etwa Erich Kästner oder Heinrich Mann von den Nazis als „Zersetzer von Familie und Staat“ verfemt wird.
Glaeser emigriert, zunächst in die Tschechoslowakei, dann in die Schweiz, wo er nach einer Anfangszeit in Locarno 1935 in Zürich landet. Und dann passiert das aus heutiger Sicht schwer Fassbare: Der Autor, dessen Bücher eben noch auf dem Scheiterhaufen verglühten, nähert sich den Barbaren, die dafür verantwortlich waren, wieder an. Sehnsucht nach Deutschland keimt in Glaeser auf, bis er, für all seine Freunde und Bekannten unbegreiflich, 1939 schließlich in die Heimat zurückkehrt, dort wieder publizieren darf (häufig unter dem Pseudonym Ernst Töpfer) und auch noch Schriftleiter einer Wehrmachtszeitung wird.
Vor allem Glaesers Einsatz für die Luftwaffen-Blätter Adler im Osten und Adler im Süden ist schwer zu verstehen und kann wohl nur mit individuell-psychologischen Vorgängen erklärt werden, die möglicherweise mit der Ablehnung seiner antifaschistischen Romane Das Gut im Elsass (1932) und Der letzte Zivilist (1935) durch die Kommunistische Partei in Zusammenhang stehen. Glaeser mag sich als geistig und räumlich heimatlos empfunden haben und dies durch eine Unterwerfung unter die Daseinsbedingungen in der alten Heimat kompensiert haben. In jedem Fall aber hat Glaeser damit seinen eignen Abstieg eingeläutet. Er wird von Ulrich Becher als „literarischer Kriegsverbrecher“ gebrandmarkt, von anderen als „Völkerverräter“, „Deserteur“ oder „Anschmeißer“. Problematisch bleibt es für ihn indes auch innerhalb Deutschlands, denn Goebbels entzieht ihm 1942 die selbst erteilte Publikationserlaubnis wieder, vermutlich, weil Glaeser sich bemüht, die Rechte an Der letzte Zivilist zurückzubekommen.
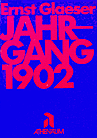
In Nachkriegsdeutschland bekommt Glaeser in Folge seiner Vorgeschichte künstlerisch kein Bein mehr auf den Boden, einer der letzten Romane, Glanz und Elend der Deutschen (1960), der auch eine Kritik des Wirtschaftswunderlandes enthält, wird von der Kritik zerrissen. Wer jedoch Leben und Werk Ernst Glaesers in seiner Gesamtheit betrachtet, wird feststellen, dass die nicht untypische Heimatlosigkeit des Intellektuellen hier derart manifest geworden ist, dass sich eine nähere Beschäftigung bezahlt macht. Und sei es zunächst auch nur mit Jahrgang 1902, dessen Lektüre in jedem Fall lohnt.
Ernst Glaeser im ZVAB
Überwindung der Madonna (1924)
Seele über Bord (1926)
Jahrgang 1902 (1928)
Fazit. Ein Querschnitt durch die deutsche Publizistik (1929)
Frieden (1930)
Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre ‚Fünfjahresplan’ (1931, mit Franz Carl Weiskopf)
Das Gut im Elsass (1932)
Der letzte Zivilist (1935)
Das Unvergängliche (1936)
Das Jahr (1938)
Wider die Bürokratie (1947)
Kreuzweg der Deutschen. Ein Vortrag (1947)
Die deutsche Libertät. Ein dramatische Testament in zwei Aufzügen und mit einem Nachwort (1948)
Köpfe und Profile (1952)
Das Kirschenfest (1953)
Glanz und Elend der Deutschen (1960)
Die zerstörte Illusion (1961)
Stichwörter:
Antikriegsroman, Bücherverbrennung, Glaeser, Jahrgang 19024 Kommentare
RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.

Manfred Flügge, Berlin schrieb am May 3, 2008:
In meiner Heinrich-Mann-Biographie (Rowohlt 2006) kann man nachlesen, dass Glaeser 1939 bei der Gestapo ausgesagt hat über andere Emigranten, dass ihm die NS-Machthaber aber nicht restlos über den Weg trauten.
Manfred Flügge, Berlin
Dr. Walter Hettche schrieb am May 5, 2008:
Völlig einverstanden, lieber Carsten Tergast: “Jahrgang 1902” sollte man gelesen haben, und vielleicht auch noch “Frieden” von 1930.
Bücherverbrennung 1933 schrieb am April 19, 2012:
[…] Zucht und Sitte in Familie und Staat! Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Glaeser und Erich […]
DER ERSTE WELTKRIEG IN DER LITERATUR » Duftender Doppelpunkt schrieb am February 19, 2014:
[…] Glaeser, Ernst (1902 – 1963): Jahrgang 1902, 1928 „Der Roman zeichnet ein soziologisch ausgefeiltes, genau beobachtetes Bild der wilhelminischen Gesellschaft und wird damit zur Anklageschrift gegen die in sexueller, moralischer und politischer Hinsicht ‚verlogene Gesellschaft der Väter‘. Die Wirkung des Romans war enorm, ‚ein verteufelt gutes Buch‘, soll etwa Ernest Hemingway geurteilt haben, und Thomas Mann wird nachgesagt, Glaeser ein außerordentliches schriftstellerisches Talent attestiert zu haben.“ Via ZVABlog […]