Amma Darko aus Ghana: Polygamie ist das Hauptübel
von litpromAmma Darko (Foto:Regina Bouillon)
Amma Darko, 1956 geboren in Tamale im Norden Ghanas, gehört zu den meist gelesenen afrikanischen Autorinnen in Deutschland. Das verdankt sich unter anderem der Tatsache, dass ihr Debüt Der verkaufte Traum zunächst auf Deutsch im Stuttgarter Schmetterling Verlag erschien, der bis heute alle ihre Romane veröffentlicht und Darko regelmäßig zu Lesereisen einlädt. Zuletzt war sie mit ihrem jüngsten Werk Das Lächeln der Nemesis unterwegs.
(Weiterlesen …)
Isolde Ohlbaum. Bilder des literarischen Lebens
von zvab
Uwe Timm, Herrsching 1991
© Isolde Ohlbaum
Es gibt kaum einen Dichter, Denker oder Gelehrten, den die Münchner Photographin Isolde Ohlbaum nicht photographiert hätte, sie begleitet und dokumentiert das internationale literarische Leben kontinuierlich. Für die Ausstellung Isolde Ohlbaum. Bilder des literarischen Lebens hat das Literaturhaus München ca. 120 Bilder aus ihrem gewaltigen Photoarchiv ausgewählt. Die Photos zeigen Größen der Literatur und Autoren der jüngeren Generation, Nobelpreisträger und natürlich auch zahlreiche Münchner Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Darunter sind Elias Canetti, Ilse Aichinger und Peter Handke, Friedrich Ani, Julia Franck und Kenzaburô Ôe, Elfriede Jelinek, Umberto Eco, Ernst Jünger, Siri Hustvedt, Michael Krüger, Doris Lessing, Michael Lentz und viele andere mehr.
Eine Ausstellung des Literaturhauses München in Zusammenarbeit mit dem Schirmer/Mosel Verlag vom 24.9. bis zum 9.11.2008
Di-Fr 12-20 Uhr, Sa/So 12-18 Uhr
Literaturhaus Galerie (Erdgeschoss)
Eintritt: Euro 4.- / 3.-
Das Erbe der Dekabristen, Teil 2
von wietek
Modest Mussorgski
So bedrückend und wirr das 19. Jahrhundert in Russland auch war, so „golden“, so ruhmreich, so glanzvoll (man könnte noch viele begeisterte Worte anfügen) war es in Literatur, Musik und Kunst. In der zweiten Hälfte kehrte sich die „Blickrichtung“ gar um: Hatte bisher das literarische Russland nach Westen geschaut, blickte jetzt der literarische (und nicht nur der literarische) Westen nach Russland. Die Übersetzungen der Werke von Puschkin, Lermontow, Gogol, Turgenjew und später von Dostojewski und Tolstoi wurden zu literarischen Ereignissen in ganz Europa. (Turgenjew lebte seit den 1860er-Jahren in Deutschland und Frankreich und hatte engen Kontakt zu Gustave Flaubert, Émile Zola, Theodor Storm, Paul Heyse, Berthold Auerbach und vielen anderen.) Nikolai Nekrassow und Anton Tschechow sind noch zu nennen.
Bei den Malern waren es u.a. Ilja Repin, Iwan Kramskoi und Wassili Perow, die Weltruhm erlangten.
Peter Tschaikowsky, Modest Mussorgski, Nikolai Rimski-Korsakow, Sergej Rachmaninow, Milij Balakirew, Alexander Borodin u.a. setzten Zeichen in der Musikgeschichte. (Weiterlesen …)
Das Erbe der Dekabristen, Teil 1
von wietekDer Anfang des ersten Essays in der Kolumne Russlands romantische Revolutionäre – Russische Schriftsteller der Emigration(en) – lautete:
„Ohne die vielen russischen Dichter, Komponisten, Musiker und Künstler aus dem 18. und 19. Jahrhundert ist die europäische und besonders die deutsche Kultur nicht denkbar – und selbst danach, zu Beginn bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, haben die verschiedenen Emigrantenwellen ungeheuer befruchtend auf unser Geistesleben gewirkt, – wieweit das auch für die neueren Wellen gilt, wird man erst rückblickend sagen können.
In Russland waren Politik und Literatur schon immer eng miteinander verquickt; Dichter waren weit mehr als im Westen das soziale Gewissen der Nation. Schon Puschkin, der für den Beginn der russischen Literatur steht, musste leidvolle Erfahrungen hinnehmen.“
Für keine Zeit in der Geschichte Russlands trifft das Gesagte mehr zu als für die, von der hier die Rede sein soll. Allerdings kann man ab dem Beginn des russischen Realismus nicht mehr von „romantischen“ Revolutionären sprechen. Ab diesem Zeitpunkt gab es nicht mehr den Hauch von Romantik – und wenn, dann doch immer mit einem leicht bitteren Beigeschmack. (Weiterlesen …)
15. September 2008Christopher Paul Curtis – Die Watsons fahren nach Birmingham – 1963
von lesartige
Aus dem amerik. Engl. v. Gabriele Haefs
Carlsen Verlag, Hamburg 1996, 196 S., ab 12
Die Watsons sind eine schwarzhäutige Familie, die 1963 in Birmingham den Hass der Weißen auf die Schwarzen erfahren.
Nach einem Bombenanschlag auf die dortige Kirche, steht die Familie unter Schock. Was genau passiert, wird in dem Buch nicht ausgesprochen. Ich musste einige Stellen viermal hintereinander lesen, um alles zu begreifen. Auch warum die Weißen die Bombe legten, wird nicht erklärt – das ist einfach so. Um die Geschichte besser zu verstehen, ist es gut, wenn man schon mehrere Bücher über den Schwarz-Weiß-Konflikt in den USA gelesen hat. (Weiterlesen …)
Sharon Creech und ihr bester Hund
von bardolaIch will nicht.
Jungs schreiben
keine Gedichte.
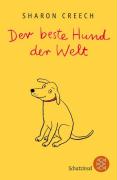
Diese ersten Zeilen aus dem Roman Der beste Hund der Welt von Sharon Creech definieren die Probleme des Schülers Jack auf klassisch-griechische Weise. Sie stehen nämlich in unausgesprochener Verbindung mit dem Paradoxon des Epimenides, dessen Aussage „Ein Kreter behauptet: ‚Alle Kreter lügen’” sich selbst ebenso ad absurdum führt wie die oben zitierten Sätze, die in Versform von einem Jungen verfasst sind; Sätze, die – wie das Buch demonstrieren wird – selbst bereits ein Gedicht bilden. (Weiterlesen …)
1. September 2008