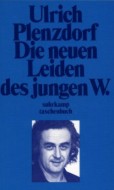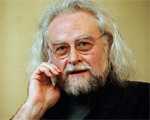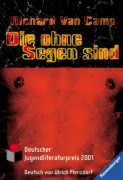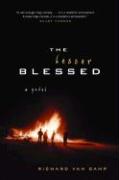Let me go crazy on you
von bardola„Uahh!“, „Ooooooooooh“, „Yeah“, „Wow!“, „One night“, „Oh, Johnny, Johnny, come on, come on!“, „Humph“, „Hmmm“, „Fuck you!“, „Shitshitshitshit“, „Jeeeesus“, „Take it easy“, „Come on, Baby“, „Go ahead“, „Hej, goofs“, „Whoah“, „Whoo hoo hoo!“, „Mhhh!“, „Let’s go!“, „See you“, „Bye“, „G’night, Gentlemen.“
Der 1971 geborene Richard Van Camp – wie sein 17-jähriger Ich-Erzähler ein kanadischer Indianer vom Stamm der Dogrib – schrieb Ende des vergangenen Jahrtausends den Roman Die ohne Segen sind, der – auch in der deutschen Fassung – die oben zitierten Ausrufe enthält. Dieser hoch gelobte, 158 Seiten schmale Debütroman wurde 2001 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis (DJLP) ausgezeichnet. Übersetzt wurde das zudem mit dem Air Canada Award der Canadian Author Association preisgekrönte Buch von Ulrich Plenzdorf, dem 1934 in Berlin geborenen Drehbuchautor und Schriftsteller, der 2007 viel zu früh verstarb.
Unvergessen ist Plenzdorfs größter Erfolg Die neuen Leiden des jungen W., und die darin bewiesene Fähigkeit, sich in die Welt der Jugendlichen einzufühlen, kommt dem deutschen Richard Van Camp zu gute. Die DJLP-Jury schrieb:
Die ohne Segen sind ist das furiose Debüt eines jungen Autors, dessen tabuloser Umgang mit Gewalt und Sexualität einen neuen Ton in die Jugendliteratur bringt. Ulrich Plenzdorf hat den Roman kongenial ins Deutsche übersetzt.
Diese Übersetzung setzte im Umgang mit der englischen Sprache Maßstäbe, die auch zehn Jahre später noch gelten.
Ich wollte mich als Übersetzender ausprobieren und suchte einen Text, der mir entgegenkommt. Ich fand ihn mit Glück in The Lesser Blessed. Ein Roman, bei dem mich von jeder Seite mein alter Freund Holden Caulfield aus New York ansah,
schreibt Plenzdorf über Van Camps Buch und dessen Bezug zu Jerome David Salingers Der Fänger im Roggen. Die Auszeichnung von Van Camps Debüt mit dem wichtigsten deutschen Jugendliteraturpreis hat das Verhältnis der englischen zur deutschen Prosa neu definiert, denn die Jury erklärte mit der Würdigung nicht nur das literarische Werk, sondern auch die Übersetzungsarbeit Plenzdorfs zu einer herausragenden Leistung mit Vorbildfunktion. Das bedeutet für Übersetzer und alle Leser, die es mit ähnlicher Prosa wie der von Van Camp zu tun haben (und die hat in Zeiten angloamerikanischer Dominanz auf dem deutschen Buchmarkt Hochkonjunktur), eine Neuorientierung und Annäherung an eine ungewöhnliche Sprachmischung, die mehr vom Original enthält, als es bislang üblich war. Nach Plenzdorfs Arbeit könnten jedenfalls die Werke der Beatniks allesamt neu übersetzt werden; vordringlich wäre eine Bearbeitung von Jack Kerouacs On the Road (dt. Unterwegs) in seinem Sinne.
Wichtigstes Merkmal von Plenzdorfs Übertragung ist (paradoxerweise) die Häufigkeit der Beibehaltung englischer Interjektionen und Ausdrücke und kurzer englischer Sätze, wie sie schon die einleitenden Zitate zeigen. Selbstverständlich handelt es sich um Wörter und Redewendungen, die bei den deutschen Lesern als bekannt vorausgesetzt und zum Teil auch von deutschen Autoren schon seit Jahrzehnten verwendet werden: Mom, Daddy, T-Shirt, okay usw. fallen in deutscher Prosa längst nicht mehr auf. Dem Original entsprechend setzt Plenzdorf allerdings das ungewöhlichere und kolloquialere ’kay ein. Der Bericht des Ich-Erzählers wird durch verschwenderischen Einsatz des Apostrophs beschleunigt und die Authentizität der Erzählung durch O-Ton-Wendungen und -Wörter erhöht. Firefighter, Bushcook, Pusher, Drummer, Scrapper (Kämpfer, von scrape), Bucks, Bubblegum, Fatty (statt Joint), Floater, Trippercity, Muscleshirt, Chicks, Chief (und im eindeutschenden Diminutiv: Chiefchen), Caps, Cops zuzüglich der kaum noch gewöhnungsbedürftigen Ranger, Rowdy, Scout, Stuntman, Clinch, Couch, Gang, Toast, Fight, Party, Baby, Beat, Story, Aftershave, Jeans, Joint, No Prob; second-hand, live, big, stoned, crazy, clever; kill, enter, relax…
Verstärkt wird der Nachhall des Originals durch Song-, Film- und Buchtitel oder unübersetzbare Wortspiele wie True If Destroyed (mit entsprechenden Abkürzungen); Goodbye Tension, Hello Pension; The Lonliness of the Long Distance Runner; Get It On, Bang a Gong; Hickey Juice; Highway to Hell; Crimson and Clover usw. Hinzu kommen die Namen der Bands (AC/DC, CCR, Iron Maiden, Guns N’ Roses, Van Halen usw.), der Indianerstämme (Chippeway, Cree, Dogrib usw.), Begriffe und Satzfetzen aus verschiedenen indigenen Sprachfamilien Kanadas (Neghadegondee, Mashi, A me nay usw.), Ortsnamen (Yelloknife, Pinebough, Hay River, Spruce Manor usw.) und selbstverständlich die Eigennamen (Larry, Jazz, Darcy, Johnny, Juliet, Hope usw.). Kaum ein Absatz, in dem nicht englisch gesprochen wird: es fallen die Worte Soul Train, Friendship-Center, Sex-Education und vor allem das refrainartige doggy-style, das glücklicherweise den Versuch der Bildung eines Adjektivs zur im Deutschen plump klingenden „Hundestellung“ verhindert. (Plenzdorf hat so viel Spaß an doggy-style, dass er den Begriff am Ende des Kapitels „Vorsichtig wie Pferde“ einsetzt, obwohl Van Camp in dieser Passage nichts Hündisches erwähnt.) Eine vollständige Liste würde den Rahmen sprengen und aus dem Kontext gerissen langweilen; ganz zu schweigen von einer Aneinanderreihung der Anglizismen, die man als solche gar nicht mehr wahrnimmt. (Wer denkt denn heute noch bei „jemanden feuern“ an einen Anglizismus, gebildet aus „to fire“?)
Bemerkenswert sind Plenzdorfs Bemühungen um sprachliches Crossover: Er sampelt und mixt und erhält eingedeutschte, noch wenig gebräuchliche Verben: „Ich jumpte über den Zaun…“; „Alle fingen an abzuhotten.“; „‚Mach dir nichts vor’, jokte ich.“ (nicht zu verwechseln mit joggte!); „Manche schmeißen einfach Steine in irgendwelche Fenster, damit man sie catcht.“ Denkbar ist es, dass in einigen Jahren Leser dieser verbalen Fusionen genauso ahnungslos sind, was den englischen Ursprung betrifft, wie heute schon beim obigen Beispiel „feuern“. Plenzdorfs Sprachakrobatik mit englischen Vokabeln bedeutet jedoch nicht, dass er auf den Einsatz unverfälschter deutscher Jugendsprache verzichten würde. Hier ein „Best of“: Affenpisse, Arschloch, Affenarsch, Flachzange, Kackspecht, Mistsau, Schaukelschwanz, Schwanzlutscher, Schleimscheißer, Schnellficker, abgewrackte Ballettratte, arrogante Schakalvisage, Mannomann.
Die einfachste und nicht minder wirksame Art, den impulsiven Charakter der englischen Erzähltechnik Van Camps ins Deutsche zu retten, besteht darin, im Original deutlich ausgesprochene Sätze der bekifften Protagonisten („Goooo cliiiimb the telephoooone poooole outsiiiide!“) im Deutschen so exakt wie möglich abzubilden: „Looooos! Kletter den Teeeeeelefoooooonmaaaaaast draußen hooooch!“ (Die Vokalwiederholungen sind hier sowohl beim englischen als auch beim deutschen Zitat sorgsam abgezählt; das gilt auch für andere Fälle, zum Beispiel das einleitend erwähnte „Jeeeesus“.)
„Kongenial“ nannte die Jury Plenzdorfs Übersetzung. Das aber trifft für jene Passagen nicht zu, in denen die deutsche Fassung das Original übertrifft. Plenzdorf ist einfach nur genial (ohne „kon-“ – oder zumindest frech und witzig), wo die Vorlage durchschnittlich ist, wenn er schreibt: „Dann rannten wir los, in unseren Socken. Das Pflaster war eisig… Wir hätten die Schuhe gut anziehen können, aber auf Socken durch die Straßen von Fort Simmer zu laufen war einfach cooler und kälter auch.“ An dieser Stelle muss sich Van Camp bescheiden: „We ran down the paved roads in our socks. The ground was cold … We could have stopped to put them on, but it just seemed hilaroius running down the back roads of town.“ Das schwache „hilarious“ gegen das starke „cooler und kälter auch“ zeigt, dass hier ein Übersetzer arbeitet, der zugleich Autor ist.
Bei aller anglophilen Virtuosität versagt jedoch Plenzdorf angesichts des Französischen: Im Original heißt die Französischlehrerein korrekt (mit Accent aigu!) Mademoiselle Sauvé und in Kanada weiß jedes Kind, wie man être und vous êtes richtig buchstabiert. Vielleicht hat der plötzliche Einbruch einer dritten Sprache den deutschen Setzer so verwirrt, dass die Mademoiselle im Deutschen einen hier deplacierten Accent grave (Sauvè) erhalten hat und der Accent circonflexe bei den Verben einfach entfallen ist (etre, etes).
Zurück zur dominierenden Quellsprache: Allein schon wegen der Häufigkeit des Gebrauchs verdient das Wörtchen Shit eine gesonderte Betrachtung. Dessen Einsatz in vermutlich dreistelliger Höhe in diesem dünnen Buch (inklusive der deutschen Varianten) lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf Van Camps Wortwahl, denn Plenzdorf – so müsste man meinen – hat es gut: Er kann zwischen Shit und Scheiße (auch als Kompositum) hin- und herwechseln. Doch der vermeintliche Vorteil der Übersetzung erweist sich als Notlösung, da Van Camp auf das Zauberwort fuck zurückgreift. Wie der folgende Dialog zeigt, hat Plenzdorf Hemmungen, mit dem inflationär verwendeten fuck so frei wie Van Camp umzugehen (obwohl er es an anderer Stelle durchaus unverändert übernimmt):
„Scheiße“, sagte er, „Juliet kriegt ein Kind. Sie hat mich angerufen und geheult. Sie ist scheißschwanger.“ – „Unmöglich.“ – „Yeah.“ – „Meinst du das scheißernst?“ – „Seh ich nicht scheißernst aus?!“ Er starrte mich an. Ich sah, er war in Panik. „Shit, Mann. Die ganze Stadt weiß es.“ – „Wieso denn?“ – „Die Krankenschwestern, die Docs, jeder Scheißer in der ganzen beschissenen Stadt.“ – „Oh Mann. Oh Shit“, sagte ich.
Wo Plenzdorf zwischen dem deutschen und dem englischen Begriff alterniert (und dabei manchmal dem Englischen noch den letzten Schliff gibt, indem er aus den „doctors“ in der deutschen Fassung das eingängigere „Docs“ macht), sorgt Van Camp mit fuck für Abwechslung:
„Ahh, shit“, he said. „Juliet’s gonna have a kid.“ – „What!?“ – „She called me up crying. She’s fuckin’ preggo.“ – „No way!“ – „Yeah.“ – „Are you fuckin’ serious?“ – „Do I look fuckin’ serious?“ He glared, and I realized he was scared. „Shit, man, the whole town knows.“ – „How?“ – „Nurses, doctors, fuckin’ everyone in this fuckin’ town!“ – „Oh man, oh shit“, I said.
Shit steht übrigens auch auf der Liste der Wörter, die Johnnys kleiner Bruder (er eröffnet den folgenden Dialog) nicht mehr in den Mund nehmen soll:
„Was hab ich denn gesagt?“ Johnny sagte: „Du hast gesagt: Was heißt der Shit. Und Shit steht auf der Liste. Macht fünfundzwanzig Cent.“ – „Shit! Kann ich später zahlen, wenn Mutter mir Taschengeld gibt?“ – „Nix ist“, sagte Johnny, „du bezahlst jetzt, und zwar insgesamt fünfzig, Mister Shit.“
Van Camp und Plenzdorf müssten ein Vermögen bezahlen, gälte Johnnys Liste auch für ihre Texte.
Weil sich Plenzdorf mit dieser Prosa ja „als Übersetzender ausprobieren“ wollte, sind einige Schwächen verzeihlich, die in späteren Auflagen behoben wurden. Leider kommt es vor, dass Übersetzer die erfolgreiche Arbeit eines prominenten Kollegen Wort für Wort durchlesen, um daraufhin öffentlich Abweichungen vom Original anzuprangern und damit eigene Kompetenz zu beweisen. Dies geschah auch bei Plenzdorf. Natürlich ist seine Übersetzung nicht vollkommen. Wesentlich aber ist es bei literarischen Texten, gelegentlich zugunsten einer stilistischen Entsprechung in der Zielsprache auf interlineare Übersetzungstreue zu verzichten.
Um abschließend über den im Schatten der Übersetzungsthematik gebliebenen Inhalt dieses zugleich witzigen, tragischen und poetischen Romans keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, sei unbedingt noch erwähnt, dass er manchmal trotz und manchmal wegen all der sprachlichen Besonderheiten – wie soll man sagen? – verdammt gut, ja, fuckin’ good ist. Wie heißt es doch bei Plenzdorf?
„Hej“, sagte die wildfremde Frau, bist du nicht Vernas Boy?“
„Yes Ma’am.“
„Let me go crazy on youuuuuu …“
Richard Van Camp im ZVAB
The Lesser Blessed (1996; dt. Die ohne Segen sind, 2000)
A Man Called Raven (1997)
Angel With Splash Pattern (2002; dt. Dreckige Engel, 2004)
What’s the Most Beautiful Thing You Know About Horses? (2003)
Ulrich Plenzdorf im ZVAB (Auswahl)
Die Legende von Paul und Paula (1974)
Die neuen Leiden des jungen W. (1976)
Karla – Der alte Mann, das Pferd, die Straße. Texte zu Filmen (1978)
Legende vom Glück ohne Ende (1979)
Gutenachtgeschichte (1983)
Ein Tag, länger als ein Leben (1986)
Zeit der Wölfe (1989)
Eins und eins ist uneins (1999)