Die Wahrheit im Blick und echten Geschichten auf der Spur
von litprom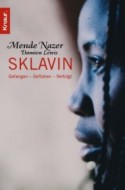
In den letzten zehn Jahren hat die deutsche Buchlandschaft eine interessante Entwicklung durchlaufen. So konnten wir beobachten, wie das scheinbar generell gesteigerte Bedürfnis nach “echten” Geschichten und dem “wahrem Erlebten” befriedigt wurde und noch immer mit neuen spektakulären (Auto-)Biografien, Dokumentationen und Reportagen befriedigt wird. Vielerorts spricht man von einem Documentary Turn, ein Begriff, der die gesteigerte Produktion von autobiografischen Erzählungen, aber auch biografischen Narrationen dokumentiert. Natürlich wurden schon immer Geschichten solcher Art erzählt. Neu ist jedoch, dass heute vermehrt Geschichten von Afrikanerinnen erzählt werden, von Frauen, die oftmals viele tausend Kilometer reisen mussten, bevor sie die Grenzen Europas erreichten und glaubten, ihrem Traum von einem besseren Leben näher gekommen zu sein. Doch wie gestaltet sich dann dieses neue Leben in Europa? Während sich manche tatsächlich ihrem Ziel näher sehen, scheinen andere gerade erst den Eingang zur Hölle passiert zu haben.
Eine Art Bilanz
Als Mende Nazer ihre erfolgreiche Biografie Sklavin , die sie zusammen mit dem englischen Journalisten Damien Lewis verfasste, im Jahr 2002 den deutschen Lesern vorstellte, war vielen sofort klar, dass dieses Buch in der deutschen und europäischen Leserlandschaft Spuren hinterlassen würde. Darin berichtet Mende von ihrer glücklichen Kindheit in den Nubabergen (Sudan), bevor sie von militanten Mudschaheddin verschleppt und später als Arbeitssklavin in die Hauptstadt Khartoum verkauft wird. Dort arbeitet sie unter schwersten Bedingungen und wird aufgrund ihrer Hautfarbe unentwegt von ihrer Herrin diskriminiert. Schließlich wird sie als Magd in den Haushalt eines hochrangigen Mitarbeiters der sudanesischen Botschaft nach London verkauft. Ohne auch nur ein Wort Englisch zu sprechen, lebt sie abgeschottet im Haushalt ihres Landsmannes, bis ihr schließlich am 11. September 2000 die Flucht aus einem der großen Anwesen eines Londoner Villen-Vororts gelingt. Doch auch nach ihrer Flucht hat Nazer Angst um ihr Leben, denn ihr Aufenhaltsrecht ist noch nicht geklärt. Ein neuer Kampf beginnt. Eine Ausweisung in den Sudan könnte den Tod bedeuten. Aber ihre Rechnung geht auf. Nachdem ihr Asylantrag 2002 zunächst abgelehnt wird, erwirkt sie (auch durch den durch das Buch entstandenen öffentlichen Druck!) eine Wiederaufnahme ihres Verfahrens. 2006 wird ihr schließlich die britische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Geschrieben als eine Mischung aus Sklaven-Memoiren und Fluchtgeschichte schaffen es Mende Nazer und Damien Lewis, aktuelle Genres miteinander zu verbinden und dabei das ureigene Interesse Nazers stets im Blick zu behalten. In einem eigentümlichen Gemisch aus biografischer Erzählung und Reflexion entsteht ein beachtenswertes Lifewriting. Dies zu lesen, macht betroffen und erinnert die Leser daran, dass Sklaverei noch lange nicht passé ist.

Mende Nazer
Natürlich gab es Versuche, Nazers Geschichte als frei erfunden abzutun, vor allem da die Verständigung zwischen dem Journalisten und der Sudanesin sich äußerst kompliziert gestaltet hatte. Nazers Englisch war zum Zeitpunkt des Interviews noch sehr rudimentär und Lewis spricht kein Arabisch. Ein Übersetzer, so beteuert Lewis im Nachwort, hätte das Vertauensverhältnis jedoch zu sehr belastet und so enstand das Buch irgendwo zwischen zwei Sprachen: eine Mischung aus Kindheitserinnerung, gerade Erlebtem und möglicherweise aufgetretenen Missverständnissen, wobei die Interviewsituation auch detailgenau geschildert wird. Wie soll man nun damit umgehen? Welchen Unterschied macht eine derartig gelagerte Erzähl- bzw. Schreibsituation für den Leser? Die rechtlichen Unwägbarkeiten bewusst ausgeblendet, stellt sich für die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin die Frage nach dem tatsächlichen Wahrheitsgehalt, vor allem, wenn die Eckpunkte (Sklavenhandel im Sudan, Erzählen der Geschichte, Flucht und Asylantrag) stimmig ineinander passen.
Die Wahrheit im Blick…
Eine neue Wendung erhalten hat die Bedeutung von Wahrheit allerdings in Deutschland spätestens seit der Publikation von Senait G. Meharis spannender Biografie Feuerherz (2004), die sich mittlerweile als völlig haltlos und frei erfunden erwiesen hat. Das skandalumwitterte Buch um Mehari und ihre Zeit als Kindersoldatin sowie ihre spätere Teilnahme an der Vorentscheidung des Eurovision Song Contests hat vor allem bei uns erneut die Frage nach der Bedeutung von Wahrheit und Fiktion in Biografien aufgeworfen. Während klar ist, dass öffentliche Diffamierungen weder in fiktiven noch in (auto-)biografischen Texten Platz haben sollten, stellt sich die Frage, wie „fiktiv“ darf denn nun eigentlich ein (auto-)biografischer Text sein?
Senait Mehari
Dieser Frage Rechnung tragend hat sich in den Medienwissenschaften unlängst ein eigenständiges Genre entwickelt, das Dokudrama. Dokudramas erzählen fiktionale Geschichten im autobiografischen Gewand, wobei das Genre ganz bewusst von der Form der autobiografischen Dokumentation profitiert. Interessanterweise hat sich das Dokudrama im eher konservativen Buchgeschäft jedoch als weitgehend marktuntauglich erwiesen. Diese Erkenntnis ist vor allem für Verlage von zentraler Bedeutung, denn auch heute noch werden Texte weitgehend nach dem Kriterium fiktiv oder aber (auto-)biografisch sortiert und für den Markt aufbereitet. So werden Bücher mit entsprechendem Cover oder aber Fotografien ausgestattet. Spielerische Mischformen wie beispielsweise das Dokudrama finden sich kaum im Buchhandel, am ehesten noch in den Zeitschriftenregalen. Vielleicht lässt sich dies damit erklären, dass im Lande Gutenbergs gedruckte Bücher, die augenscheinlich keine Fiktion sind, allzu leicht mit einem hohen Wahrheitsanspruch versehen werden. Und so scheint es, als würde ein ganzes Genre, das von Natur aus auf ein gewisses Maß an Spekulation angewiesen ist, nach einer fast nicht zu erreichenden Wahrheit streben. In diesem Tauziehen spielen Verlage eine bedeutsame Rolle, nicht zuletzt geht es ihnen hierbei ja auch um Selbstschutz. Wohl kaum ein Verlag möchte sich in diesem Zusammenhang auf dem hart umkämpften Buchmarkt einen Skandal leisten. Diese Feststellung wirft auf eine Reihe neuer Publikationen ein anderes Licht.
Den Geschichten auf der Spur…
In ihrer aufwühlenden Reportage Ware Frau: Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa (2008) legen die beiden Politikwissenschaftlerinnen Mary Kreutzer und Corinna Milborn sehr eindringlich dar, wie sich der Frauenhandel von Afrika nach Europa in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. In einer Mischung aus Hintergrundinformation, politischer Analyse und autobiografischen Berichten erzählen und dokumentieren die Autorinnen den (Leidens-)Weg von acht Nigerianerinnen, die allesamt in Europa ihr Glück zu finden hofften, um dann auf einer der zahlreichen europäischen „Freudenstraßen“ ihre „Reisekosten“ abzuarbeiten. Die acht Frauen tragen Namen wie Joana, Lucy, Florence oder aber Grace und gehören zu den ca. 100.000 Nigerianerinnen, die alle in irgendwelchen europäischen Städten im schmutzigen Geschäft der Zwangsprostitution gefangen sind. Die Lebensstationen der Frauen lesen sich fast wie die Urlaubsrouten internationaler Städtereisen: Benin City, Lagos, Kairo, Wien oder aber Lagos, Budapest, Kiew, Mailand, Rom. Bald fragen sich die Leser, warum machen sich diese Mädchen auf diese oftmals so beschwerliche Reise? Wie und von wem werden sie rekrutiert? Sind sie sich bewusst, welche Art Job sie in Europa ausüben sollen? Wie werden die Frauen über die Grenzen geschleust, und was tut die europäische Polizei gegen diese Art von Frauenhandel? All diesen Fragen gehen die Autorinnen nach. Neben einer brisanten politischen Reportage enthält das Buch Passagen, in denen die Frauen selbst zu Wort kommen und so ihre eigene Geschichte erzählen können. Insgesamt ein äußerst eindrucksvolles Dokument, das seinesgleichen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt sucht.
Joana Adesuwa Reiterer
Eine der zitierten Frauen ist Joana Adesuwa Reiterer. Sie war es, die Mary Kreutzer und Corinna Milborn erstmals auf das Problem des nigerianischen Frauenhandels aufmerksam machte und für deren Buch Impulsgeberin und Informantin war. Eine ausführliche Version ihrer Geschichte hat sie in dem Buch Die Wassergöttin: Wie ich den Bann des Voodoo brach (2009) niedergeschrieben.
Die Geschichte Adesuwas beginnt mit dem Verstoß ihres Vaters, weil dieser glaubt, in seiner Tochter eine Hexe, eine „Wassergöttin“ zu erkennen. Die junge Frau folgt ihrem Ehemann nach Wien, wo sie schmerzhaft erkennen muss, dass dieser als Menschenhändler tätig ist. Er ist es, der junge Mädchen mit falschen Versprechen nach Europa lockt, um sie dann bei ihren neuen Herrinnen, die sich auch Madame nennen, abzuliefern. Als Adesuwa sich beharrlich weigert, für ihren Ehemann als Madame zu arbeiten, wird das Leben in Österreich für die junge Frau immer schwieriger. Die Situation eskaliert, nachdem sie eines Tages einem jungen Mädchen zur Flucht verhilft. Nun muss Adesuwa selbst aus der Wohnung ihres Mannes fliehen. Neben diesen schrecklichen Einblicken in Adesuwas Lebenswelt als Ehefrau eines Frauenhändlers erfährt der Leser viel über nigerianische Voodoo-Traditionen, denn noch heute werden in Nigeria Frauen als „Hexen“ gebrandmarkt, verfolgt und ermordet.
Wie die beiden zuletzt vorgestellten Bücher zeigen, kann auch ein dritter Weg im (auto-)biografischen Erzählen bestens funktionieren. Gut recherchiert und „ehrlich erzählt“ können Flüchtlingsschicksale, Bürgerkriegssituationen, Geschichten von Menschenhandel und Körperverstümmelung dem Muster skandalträchtiger Memoiren entsagen, ohne dabei ihre Eindringlichkeit und Unmittelbarkeit einbüßen zu müssen. Dies jedoch soll nicht heißen, dass ein semi-autobiografischer Text nicht auch seinen Platz innerhalb des Genres finden kann. Wichtig ist vor allem, dass die Leser erkennen können, welche Art Geschichte sie in unerschrockener Mittelbarkeit präsentiert bekommen. Man sollte sie bloß nicht für dumm verkaufen.
Sissy Helff, die Autorin dieses Aufsatzes, arbeitet als promovierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Postkoloniale Studien/Transcultural English Studies an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie lebt mit ihrer Familie in Bad Homburg.
Der Aufsatz entstammt der am 9. März 2009 erschienenen Frühjahrsausgabe der LiteraturNachrichten, die litprom unter www.litprom.de veröffentlicht.
11. March 2009