„der Poet ein Lumpensammler“ – Jörg Fauser, Wirklichkeitssucher im Rausch
von tergastDarf man in dieser Rubrik über jemanden schreiben, der gerade erst durch eine frisch abgeschlossene Werkausgabe geehrt worden ist? Ich denke, man darf, wenn es sich um einen Autor handelt, der trotz seiner überragenden Bedeutung für die deutsche Nachkriegsliteratur bis heute eher eine Sache für Eingeweihte geblieben ist und der wohl nie mit dem Bekanntheitsgrad deutscher Großschriftsteller wird konkurrieren können.
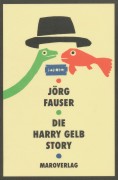
Nun könnte man sagen, das liegt daran, dass es Jörg Fauser einfach zu früh erwischt hat. Erwischt durch einen Lastwagenfahrer, der nicht ahnen konnte, dass da einer nach seiner eigenen Geburtstagsfeier zu Fuß über die Autobahn zu gehen versuchte. Ein absurder Tod, dessen Umstände bis heute rätselhaft bleiben, und der doch in seiner ganzen Sinnlosigkeit wie ein Querverweis auf das literarische Werk des Autors wirkt, das von Figuren durchzogen ist, denen man diese torkelnde Begehung einer nächtlichen Autobahn gleichfalls zutrauen würde.
Fauser, 1944 als Sohn eines Malers und einer Schauspielerin geboren, wurden Leben und Schreiben schnell eins; in beidem schert er sich wenig um Konventionen und das Urteil der Außenstehenden. Dem Erzählband Mann und Maus (1982) stellt er das Motto „Das Leben hat alles, was gebraucht wird“ voran und benennt damit auch die einzige Quelle, die er für seine Texte benötigt. Ob die erfolgreichen Romane wie der später mit Marius Müller-Westernhagen verfilmte Schneemann (1981) und der großartige, Fausers Istanbuler Drogenerfahrungen reflektierende Rohstoff (1984), die frühen Texte in Underground-Zeitschriften wie UFO oder Gasolin23 oder auch die Texte für Rocksänger Achim Reichel: Immer schöpft Fauser aus dem prallen Leben, wankt durch dessen Abgründe, integriert den Geruch der Gosse, zeigt nackt und ungeschützt die dunklen Ecken der menschlichen Seele, die wir alle nicht wahrhaben wollen und die doch in jedem von uns schlummern. Fauser versteht sich und sein Schreiben als etwas, das den Sinn des Lebens an dessen Basis sucht und bisweilen auch findet: „der Poet ein Lumpensammler/er kommt mit den Abfällen aus/wie die Ratte und der Schakal“, erkennt er 1979 in Trotzki, Goethe und das Glück.

Das zentrale Motiv in Fausers Texten ist der Rausch. Vor dem Hintergrund der eigenen Drogenkarriere, die früh mit Heroin beginnt und zumindest dem Alkohol bis zuletzt treu bleibt, stehen künstliche Fluchthelfer bei ihm als Chiffre für eine nie endende Sehnsucht nach Intensität, danach, das Leben in all seinen Facetten zu spüren. Und diese Suche spiegelt sich in seinen Texten wieder, wenn die durch sie geisternden Figuren lauter Dinge tun, die mit Vernunft und planvollem Tun nichts gemein haben: „Was tu ich hier/worauf warte ich/auf Schlaf nein/auf Erleuchtung nein/auf Rausch minus Horror/auf den irren Bomber/der uns alle weckt“, heißt es in Achim Reichels Song „Riverside Drive“, für den Fauser den Text schrieb. Nur im Rausch tritt klar zutage, wie verlogen die Nüchternheit ist, wenn sie den Menschen dazu dient, andere zu manipulieren, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Fausers in dieser Hinsicht kritischer Blick auf die Gesellschaft gilt übrigens genauso für die etablierte Bürgerlichkeit wie für die ihm scheinbar näher stehende Subkultur. Auch deren Tendenz, sich zu wichtig zu nehmen und sich als Mainstream etablieren zu wollen, ist ihm verdächtig.
Rausch bedeutet für Fauser und seine Figuren Natürlichkeit, die einzige Möglichkeit, im Moloch Großstadt, Kulisse seiner Texte und seines Lebens, zu sich selbst zurückzufinden und dem Leben etwas abzugewinnen, was es sonst vorenthält. Dabei steht Fausers Werk durchaus abseits hymnischer Verherrlichung von Drogen. Die Droge wird dem Schriftsteller, der Anfang der 1970er zumindest den harten Substanzen abschwor, vor allem gegen Ende seiner kurzen Karriere mehr und mehr zum literarischen Stilmittel, ohne sich dem Leser als reale Möglichkeit aufzudrängen. Jener, so war es wohl Fausers Ziel, sollte den Rausch aus seinen Texten beziehen.
Die Radikalität der Texte dürfte der Grund sein, warum Jörg Fausers Bücher nie wirklich dort eingeordnet wurden, wo sie unzweifelhaft hingehören: in den Kanon der Literatur, die uns die Wirklichkeit im Nachkriegsdeutschland so nahe bringt, dass es weh tut. Wer jedoch in der Literatur schonungslose Ehrlichkeit und Intensität sucht, sollte sich in das umfangreiche Werk Fausers vertiefen. Er wird dort beides finden. Und das ist doch schon eine Menge mehr, als man vom Großteil der neueren deutschen Literatur sagen kann…
Jörg Fauser im ZVAB
Aqualunge (1971)
Die Harry Gelb Story (1973)
Das Rolling Stones Songbook (1977)
Marlon Brando – der versilberte Rebell (1978)
Alles wird gut (1979)
Requiem für einen Goldfisch (1979)
Trotzki, Goethe und das Glück (1979)
Der Schneemann (1981)
Mann und Maus (1982)
Blues für Blondinen (1984)
Rohstoff (1984)
Das Schlangenmaul (1985)
Kant, eine Szene-Thriller (1987)
Fauser – Edition in 8 Bänden (1990)
Ich habe eine Mordswut (1993)
Das leise lächelnde Nein (1994)
Essays, Reportagen, Gedichte (1994)
Fauser O-Ton (Hörbuch, 1997)
Lese-Stoff (2003)
Fausertracks (Hörbuch, 2005)
Die Tournee – Roman aus dem Nachlass (2007)
Stichwörter:
Alkohol, Drogen, Fauser, Gesellschaftskritik, Mainstream, Nüchternheit, Radikalität, Rausch, Rohstoff, Schneemann, Subkultur, Zu gut zum Vergessen2 Kommentare
RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.

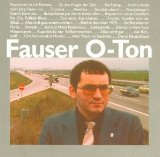
links for 2009-05-26 | Lotrees Journal schrieb am May 26, 2009:
[…] „der Poet ein Lumpensammler“ – Jörg Fauser, Wirklichkeitssucher im Rausch « ZVABlog „der Poet ein Lumpensammler/er kommt mit den Abfällen aus/wie die Ratte und der Schakal“, erkennt er 1979 in Trotzki, Goethe und das Glück. […]
dirk schrieb am May 27, 2009:
Was ist denn drin, im “Kanon der Literatur, die uns die Wirklichkeit im Nachkriegsdeutschland so nahe bringt, dass es weh tut”?