Kein Sinn im Leben außerhalb der Kunst – Wilhelm Lehmann, Großmeister der Naturlyrik
von tergast1923 erhält Robert Musil den Kleist-Preis. Doch nicht nur er, sondern noch ein weiterer Zeitgenosse wird von Alfred Döblin in diesem Jahr mit dem renommierten Preis geehrt: ein gewisser Wilhelm Lehmann, dessen Name heute selbst bei fleißigen Lesern im Gegensatz zu Musil und Döblin vor allem Achselzucken hervorrufen dürfte.
Lehmann wird 1882 im fernen Venezuela geboren, ist aber das Kind norddeutscher Eltern, mit denen er schon bald in die Heimat zurückkehrt. Seine Jugendjahre verlebt er, nachdem der Vater die Familie verlassen hat, mit seiner nun recht dominanten Mutter in Wandsbek.

Wilhelm Lehmann
Lehmanns Erwachsenenleben gliedert sich in zwei Teile: Er beginnt eine ganz bürgerliche Karriere, studiert Philosophie, Naturkunde und Sprachen in Berlin, Straßburg, Kiel und Tübingen, promoviert (in Kiel), absolviert das Staatsexamen fürs höhere Lehramt und wird schließlich Lehrer. Interessant ist seine Tätigkeit für die Freie Schulgemeinde Wickersdorf, ein reformpädagogisches Projekt, das mit den üblichen Drillanstalten wenig gemein hat. Spuren der Streitereien zwischen den Gründern der Schule, Martin Luserke und Gustav Wyneken, werden sich später im literarischen Werk Lehmanns wiederfinden.
Doch trotz seines Engagements ist der junge Lehrer Lehmann nicht dafür geschaffen, sein Leben allein als Vermittler von Bildung und Erziehung zu bestreiten. Wenngleich er bis ins Alter Lehrer bleibt, zuletzt von 1923 bis 1947 an der Jungmannschule in Eckernförde, spürt er zunehmend eine andere Berufung, die in einer Briefstelle von 1932 ihren Ausdruck findet: „Außerhalb der Kunst vermochte ich keinen Sinn im Leben zu finden.“ Sein Wechsel von den spannenden, aber anstrengenden reformpädagogischen Projekten zur staatlichen Schule dürfte mit dieser Erkenntnis zu tun haben.
Ab etwa 1915 bricht sich die Berufung im Leben Wilhelm Lehmanns Bahn, die Romane Der Bilderstürmer (1917), Die Schmetterlingspuppe (1918) und Weingott (1921) erscheinen. Es kommt zu jenem frühen Höhepunkt, mit dem dieser Text eröffnet: Alfred Döblin überreicht Lehmann neben Robert Musil den Kleist-Preis.
Auch nach dieser Ehrung schreibt Lehmann noch Romane, etwa Der Überläufer (1925) oder Der Provinzlärm (1929). Sie werden jedoch erst lange nach dem Krieg veröffentlicht. Im Falle des Überläufers hat das wohl mit dem Thema des desertierenden Soldaten zu tun, für das die 1920er- und 1930er-Jahren kein fruchtbarer Boden waren. Der Roman reflektiert Lehmanns traumatische Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, denen er durch Desertion in die englische Gefangenschaft zu entkommen suchte. Auch im Roman Weingott findet sich auf integrierten Tagebuchblättern ein Nachhall dieser Erlebnisse.
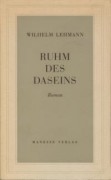
Lehmanns heute leider verblasster literarischer Ruhm gründet jedoch nicht auf seinen Romanen, sondern auf dem lyrischen Werk, das zu den bedeutendsten im Feld der Naturlyrik gerechnet werden darf. Bereits in den Berliner Studienjahren hatte er Oskar Loerke kennen gelernt, der ebenso wie Lehmann stark vom expressionistischen Schreiben beeinflusst, aber auch auf der Suche nach Weiterentwicklung war. Loerke bestärkte Lehmann in seinem Drang zu lyrischem Schaffen und erfand für ihn aufgrund seiner ausdrucksstarken Naturgedichte die Bezeichnung „Grüner Gott“.
Im Alter von 53 Jahren kommt Lehmanns lyrisches Talent schließlich vollständig zur Entfaltung, Antwort des Schweigens (1935) ist das erste gedruckte Zeugnis seiner unverwechselbaren dichterischen Kraft. Immer stärker wird fortan die Mythisierung der Natur in seinem Werk, immer genauer die Beschreibung botanischer und zoologischer Phänomene. Bisweilen scheint gar der Mensch völlig aus dieser Literatur getilgt und mit ihm auch die Zeitumstände seines Lebens, wie Gegner Lehmanns bemängelten. Doch den Dichter ficht dieser Vorwurf nicht an: „Ein Gespräch über Bäume“, so Lehmann in einer Antwort an seine Kritiker, schließe „das Wissen um böse Zustände und Taten nicht aus“, sondern helfe vielmehr, „den verloren gegangenen Menschen wieder zu holen.“
1957 vereinigt Lehmann vier kleinere Lyrikbändchen zum großen Band Meine Gedichtbücher. Als Mitglied verschiedener Vereinigungen von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bis zum P.E.N.-Club engagiert er sich nun auch in der Kulturpolitik.
Lehmanns Wirkung auf die deutsche Nachkriegslyrik, spürbar etwa im Werk von Günter Eich oder Karl Krolow, ist verschiedentlich gewürdigt worden; sein eigenes Schaffen aber rückte mehr und mehr in den Hintergrund, so dass heute kaum noch jemand seinen Namen kennt. Das ist schade, gilt es doch eine literarische Stimme wiederzuentdecken, die in der Naturbeschreibung so manches Menschliche und Allzumenschliche zu vermitteln vermag.
Wilhelm Lehmann im ZVAB
Der Bilderstürmer (1917)
Die Schmetterlingspuppe (1918)
Weingott (1921)
Vogelfreier Josef (1922)
Der Sturz auf die Erde (1923)
Der bedrängte Seraph (1924)
Die unbekannte Stimme (1932)
Die Hochzeit der Aufrührer (1934)
Antwort des Schweigens (1935)
Der grüne Gott (1942)
Entzückter Staub (1946)
Bukolisches Tagebuch (1948)
Noch nicht genug (1950)
Ruhm des Daseins (1953)
Meine Gedichtbücher (1957)
Erfahrungen mit Gedichten (1959)
Stichwörter:
Botanik, Desertion, Doeblin, Krieg, Lehmann, Loerke, Lyrik, musil, Mythisierung, Natur, Reformpädagogik, Schule1 Kommentar
RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.

Wolfgang Kaul schrieb am September 14, 2009:
Vielen Dank, daß Sie einmal den von mir schon lange geliebten Wilhelm Lehmann würdigen! Kennen gelernt habe ich den Dichter übrigens vor vielen Jahren durch eine Besprechung in der ZEIT. Wahrlich einer der versteckten Schätze. Dazu gehört auch meine neueste Entdeckung, Howard Spring. Vielleicht weisen Sie ja einmal die Leser an dieser Stelle auf ihn hin?
Viele Grüße von