Uri Orlev und die Bleisoldaten
von bardola
Manche der wichtigsten Bücher erscheinen nur durch Zufall in deutscher Sprache oder dank engagierter Fürsprecher. Mirjam Pressler übersetzte 1994 für Elefanten Press Uri Orlevs kurze Autobiografie Das Sandspiel, ein schmales Bändchen, das auf Hebräisch nie erschienen war. Pressler war von dieser knappen Schilderung eines Kinderschicksals im Zweiten Weltkrieg, das Orlev auf Anregung des deutschen Verlages geschrieben hatte, sehr bewegt.
Im Mittelpunkt steht das Kinderspiel zweier Brüder und die Frage: Wie viele Kinder wirst du haben? Der „Prophet″ nimmt eine Handvoll Sand, wirft ihn in die Luft und fängt ihn mit dem Handrücken auf. Natürlich bleiben zu viele Körner übrig und der Vorgang wird wiederholt. Die Sandkörner, die dabei neben die Hand fallen, stehen für jene Kinder, die auf verschiedene Art und Weise verloren gegangen sind. „Ich ging mit meinem Sohn zum Sandkasten und zeigte ihm das Spiel. Und ich erklärte ihm, dass uns die Deutschen ‚in die Luft geworfen’ hätten. Und jedes Mal starben viele Menschen. Aber wir, mein Bruder und ich, fielen immer auf eine sichere Stelle”, erinnert sich Orlev.
Diese Geschichte war für Mirjam Pressler der Auslöser, nach mehr zu fragen. Als sie erfuhr, dass die Idee des Sandspiels schon in Orlevs bereits 1956 erschienenen Roman Die Bleisoldaten angelegt ist, regte sie die Übertragung des umfangreichen Debüts an, das Orlev mit 25 Jahren beendet hatte. Erst 43 Jahre später konnte man die Bleisoldaten auf Deutsch lesen.
„Die Geschichte ist einfach unglaublich … ja – man muss sagen – spannend”, sagt Pressler. Bevor sie das Wort „spannend” ausspricht, zögert sie. Aber es stimmt: Orlev schreibt schnörkellos, packend und mit zwei herausragenden Besonderheiten über sein Leben: mit ungeheurer Imaginationskraft und mit besonderer Perspektive. „Er benutzt jedoch nicht die grauenhafte Zeit als Kulisse, um vor diesem Hintergrund etwas Erfundenes zu erzählen”, präzisiert Pressler.
Orlevs Erzählung setzt im Kriegsjahr 1942 ein. Der elfjährige Jurek (Orlevs Alter Ego) beobachtet nüchtern die Zeit der Okkupation Warschaus durch die Nazis. Nahezu kommentarlos (nur ganz selten schaltet sich der erwachsene Erzähler ein) wird in oft dialogischen Szenen die verzweifelte Lage der jüdisch-polnischen Familie Kosobolski geschildert. Als die Mutter einmal beim Schlafengehen zu früh aufhört, eine Geschichte zu erzählen, fangen die beiden Söhne im Dunkeln in ihren Betten an, sich Abenteuer auszudenken.
„Jurek”, sagte Kazik schläfrig, „wenn wir Riesen werden, wie groß sind wir dann?”
„Wir können uns klein und groß machen.”
„Nehmen wir auch Tante Mania mit?”
Jurek überlegte. „Ja”, entschied er dann. „Sie ist unsere Tante. Auch Onkel Sokol und Frau Panska. Wir können sie alle in die Tasche stecken. Und dann fliehen wir aus dem Ghetto.”
Kazik war eingeschlafen. Jurek lag noch immer halb wach.
„Jurek, Jurek, Jurek …”, hörte er rufen und von Ferne erklang eine Melodie.
Er durfte nicht antworten. Die alte Frau in der Kirche hatte das gesagt. Das war der Tod, der da rief.
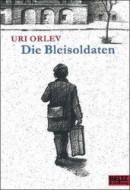
Jurek versteht erst mitten im Krieg, dass ihm geschieht, was ihm geschieht, weil er Jude ist, obwohl Religion in seinem Elternhaus keine Rolle spielte. Doch dann ist der Tod allgegenwärtig: Jureks Mutter, die im Krankenhaus erschossen wird; Tante Stella, die im Ghetto in einer Fabrik nicht für Geld, sondern nur für das Recht zu Leben arbeitet; Onkel Edek, der mit einer Am- pulle Zyankali in der Tasche in den Viehwaggon Richtung Treblinka steigt… Orlev zeigt seinen Alltag des Überlebens, die unfassbaren Katastrophen, aber auch die kleinen Glücksfälle in lebensbedrohlicher Lage im Ghetto oder im Konzentrationslager Bergen-Belsen; er beschreibt die Angst vor Verfolgung, die Willkür und die immer neuen Regelungen der Nazis, die Unsicherheit, was als Nächstes zu tun ist, die ersten Berichte über die Vernichtung aller jüdischen Polen, das Ausweichen in immer neue Verstecke.
„Uri Orlev gelingt es, das Thema von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus zu schildern, als man erwartet. Er wirft einen außergewöhnlichen Blick auf die Zeit”, sagt Mirjam Pressler. Die Erzählperspektive ist ein herausragendes Merkmal dieses Romans und des gesamten schriftstellerischen Oeuvres Orlevs. „Das Kind war ja alt genug. Orlev hat damals alles bewusst erlebt und er blendet als junger Mann beim Erzählen nichts wirklich aus. Er berichtet von den Schrecken, aber er berichtet so wie ein Kind und ohne zu dramatisieren”, so Pressler. Der Autor selbst schreibt in Sandpiel: „Es ist mir nicht möglich, als Erwachsener zu sprechen oder an Dinge zu denken, die mir passiert sind. Ich muss mich an sie erinnern, als wäre ich noch immer ein Kind.” Seiner Übersetzerin erklärte er bei einer der vielen Lesungen vor deutschen Schulklassen, dass er verrückt werden würde, wenn er sein Leben von heute aus, mit dem ganzen Wissen, was wirklich passiert ist, betrachten würde. „Das ist keine Einschränkung, das ist ein besonderes Talent”, betont Pressler.
Der Begriff “ungeheure Imaginationskraft” betrifft bei Orlev deshalb weniger die aus der Rückschau geschilderten Ereignisse, sondern erfasst vor allem die kindliche Phantasie von damals: Orlev sah die schrecklichen Ereignisse als Abenteuer. “Endlich passiert mir auch etwas Richtiges”, dachte der Junge, der schon so viele spannende Bücher gelesen hatte, und spielte alles mit seinem Bruder nach. Erst mit Bleisoldaten, danach mit einfachsten Gegenständen, die große Namen trugen: Robin Hood, Prinz Eisenherz, Kapitän Nemo, Sherlock Holmes. Jurek und Kazik wissen, dass Krieg ist, und sie reproduzieren ihn, ohne wirklich zu verstehen, in welcher realen Tragödie sie mitspielen müssen. „Diese Spiele haben sie bis zur Besessenheit gespielt. Die Außenwelt war Spielanreiz. Das Besondere ist, dass man alles aus Kindersicht erfährt, und zwar aus der Sicht eines besessenen Kindes, eines besessenen Spielers. Man spürt das Leid, aber es kommt als Abenteuer daher”, sagt Pressler. Orlev schildert zwei Parallelwelten, wobei die kindliche Phantasie die Schrecken der Realität erträglich macht.
Die Bleisoldaten ist ein schmuckloses, aber unvergessliches Zeugnis der Tragödie. Die literarische Form ist offen und erinnert an Tagebuchaufzeichnungen. Lakonisch erzählte Erinnerungsfetzen spiegeln den qualvollen Erinnerungsprozess wieder. Und doch schreibt Orlev auch kunstvoll, denn er verbindet auf beeindruckende Weise die Spielszenen mit der Realität. Die Brüder spielen mit Bleisoldaten, aber leben unter Menschen, die ebenfalls wie aus Blei sind: mitleidlos, empfindungslos, feindlich. Nur zögernd blättert man um, weil man nicht lesen will, was man befürchtet. Aber man liest weiter und hört nicht auf, weil man die ganze Wahrheit erfahren will.
„Die Jugendlichen heute erleben selten etwas Authentisches. Aber sie kennen auch die geheimen Sehnsüchte nach Abenteuern. Das ist auch ein Grund, warum sie diesen Roman gerne lesen”, beschreibt Mirjam Pressler ihre Erfahrungen mit dem Buch. Die Bleisoldaten ist ein ungeschliffener und mitreißender autobiografischer Roman, in dem trotz der Nähe zum furchtbaren Geschehen der Alltag zum Abenteuer wird, ohne dass das Leid und der Schrecken hinter dem Spielerischen verschwinden. Ein Buch mit Leerstellen, die Erwachsene füllen und auf diese Weise verhindern können, dass aus der schuldlosen deutschen Jugend eine ahnungslose wird. Die Bleisoldaten ist ein bewegendes Zeitdokument, das im Bewusstsein der Leser bleiben muss.
Uri Orlev wurde 1931 in Warschau als Jerzy-Henryk Orlowski geboren. Seit 1945 lebt er in Israel, heute in Jerusalem. Er ist einer der renommiertesten israelischen Kinderbuchautoren. Ein israelischer Verleger überredete ihn in den 1950er-Jahren, einen hebräisch klingenden Namen anzunehmen. Orlev wollte später wieder seinen europäischen Namen tragen, aber seine Kinder lehnten das ab. 1996 wurde er für sein Gesamtwerk mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis ausgezeichnet. Orlev ist Vater von drei Kindern und mehrfacher Großvater. Als 1986 Die Insel in der Vogelstraße bei Elefanten Press erschien, war Orlevs Buch das damals einzige auf dem deutschen Markt, mit dem sich ein Israeli an Jugendliche wandte und eigene Erfahrungen im Ghetto und im Konzentrationslager schilderte.
Uri Orlev im ZVAB
Das strickende Mütterlein (1981)
Die Insel in der Vogelstraße (1986)
Der Mann von der anderen Seite (1990)
Das Tier in der Nacht (1993)
Das Sandspiel (1994)
Julek und die Dame mit dem Hut (1997)
Der haarige Dienstag (1998)
Die Bleisoldaten (1999)
Der Glücksschnuller (2002)
Das Löwengeschenk (2002)
Lauf Junge, lauf (2004)
