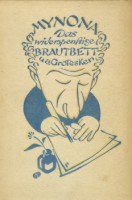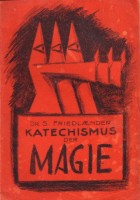Eine Mischung aus Kant und Chaplin
von tergastAnonymus ist ein immer wieder gerne benutztes Pseudonym, wenn der Verfasser eines Textes – aus welchem Grund auch immer – nicht erkannt werden will. Dass einer das irgendwie langweilig findet, das Wörtchen “anonym” einfach umdreht und dann als Mynona Literaturgeschichte schreibt, ist allerdings einzigartig.
So einzigartig, wie eben die ganze Persönlichkeit und das literarische Schaffen Mynonas waren, der am 4. Mai 1871 als Samuel Friedländer (auch Salomo Friedlaender) in Posen geboren wurde. Im Anschluss an die behütete Kindheit als Sohn einer Arztfamilie deutet zunächst nichts darauf hin, dass aus dem Jungen ein avantgardistischer Dichter werden könnte. Der naheliegende Weg wird eingeschlagen, auf die Aufnahme eines allgemeinmedizinischen Studiums in München folgt bald der doppelte Wechsel: von München nach Berlin, von der Allgemeinmedizin zur Zahnheilkunde.
Wie man von dort zu spekulativer Philosophie, alter Geschichte und Archäologie kommt, wird vermutlich Friedländers Geheimnis bleiben. Die Philosophie jedenfalls packt ihn besonders, und 1902 promoviert er in Jena mit einer Arbeit über Schopenhauers Verhältnis zu Kants Kritik der reinen Vernunft.

Gedenktafel in der Berliner
Johann-Georg-Straße
Berlin wird schließlich die Stadt, in der aus Samuel Friedländer Mynona wird.
Ab 1906 lebt er wieder dort und knüpft zahlreiche Kontakte zu Geistesgrößen seiner Zeit, darunter so illustre Persön- lichkeiten wie Alfred Kubin, Erich Müh- sam, Else Lasker-Schüler, Martin Buber, Georg Simmel oder Herwarth Walden. Durch die Bekanntschaft mit Raoul Hausmann, Hannah Höch und anderen Vorreitern der Bewegung entwickelt er in seinem literarischen Schaffen deutliche dadaistische Tendenzen, mischt diese mit expressionistischen Ausdrucksformen und bringt eine Vielzahl an Grotesken hervor, die auf geniale Weise sein parallel entstehendes philosophisches Werk illustrieren.
Gerade diese Doppelexistenz ist es, die Mynona einzigartig macht, einzigartig in einer Zeit, die an individualistischen Tendenzen und bemerkenswerten Künstlern wahrhaftig nicht arm war. Er selbst ist sich dieser Tatsache sehr wohl bewusst und artikuliert sie in einem Brief an den Verleger Kurt Wolff mit den Worten: „Ich behaupte kühnlich, daß ich zur Zeit der einzige bin, der eine gewisse Synthese aus Kant und Clown (Chaplin) darstellt.“
Eine Mischung aus Immanuel Kant, dem Säulenheiligen der deutschen Philosophie, und Charlie Chaplin, der Ikone des clownesken Auftritts? Darauf muss man erstmal kommen, doch Friedländer lag wohl richtig mit dieser Einschätzung seiner Existenz. Wie unbekümmert und ansprechend er literarisches Schaffen mit philosophischer Theorie verbindet, zeigt der 1922 entstandene Roman Graue Magie. In seine muntere Mixtur aus unterschiedlichsten literarischen Formen von der Groteske bis zum Krimi verpackt Mynona nicht nur spitzzüngige Darstellungen mancher Zeitgenossen wie Oswald Spengler oder dem Hellseher Hanussen, sondern integriert auch die philosophischen Theorien seines Lehrers Ernst Marcus sowie Kantsche Ansätze.
Über 250 literarische Texte entstehen im Laufe der Zeit neben den philosophischen Abhandlungen, ein Teil davon erscheint in der von Friedländer selbst herausgegebenen Zeitschrift Der Einzige, die in Titel und Ausrichtung die Individualphilosophie aufgreift, die Max Stirner in seinem Hauptwerk Der Einzige und sein Eigentum formuliert hatte.
Die Novelle Biblianthropen wird zwar 1933 noch mit einem von der Gesellschaft der Bibliophilen ausgelobten Preis bedacht, sorgt jedoch auch dafür, dass Friedländer sich zur Flucht nach Paris genötigt sieht. Denn der Druckereibesitzer hatte „verschiedene Anstößigkeiten“ des Textes zum Anlass genommen, Mynona mit Denunziation bei den neuen Herren(menschen) in Deutschland zu drohen.
Friedländer übersteht die Naziherrschaft und den Krieg im Exil. Seine schriftstellerische Produktivität allerdings lässt rapide nach, bereits 1935 erscheint in einem Pariser Verlag das zu Lebzeiten letzte belletristische Werk, die Sammlung Der lachende Hiob und andere Grotesken. Stattdessen widmet sich Friedländer in dieser Zeit der Weiterentwicklung seiner philosophischen Theorie, die schließlich im von ihm selbst als sein wichtigstes betrachteten Werk Das magische Ich (2001 posthum veröffentlicht) ihren vollendeten Ausdruck findet.
Nur ein Jahr nach Kriegsende stirbt Samuel Friedländer alias Mynona in Paris. Ihn zu lesen ist ein Vergnügen – allein das lohnt die Lektüre. Und wer sich die Mühe macht, dazu noch die philosophische Erkenntnis nachzuvollziehen, die das Werk durchzieht, wird doppelt belohnt von diesem einzigen Anonymus, der Mynona heißt.
Mynona im ZVAB (Auswahl):
Psychologie. Die Lehre von der Seele (1907)
Durch blaue Schleier. Gedichte (1908, unter dem Namen Salomo Friedländer)
Friedrich Nietzsche. Eine intellektuale Biographie (1911)
Schwarz-Weiß-Rot. Grotesken (1916)
Die Bank der Spötter. Ein Unroman (1919)
Der Schöpfer. Phantasie (1920)
Graue Magie. Berliner Nachschlüsselroman (1922)
Hat Erich Maria Remarque wirklich gelebt? Der Mann. Das Werk. Der Genius. 1000 Worte Remarque (1929)
Der lachende Hiob und andere Grotesken (1935)
Das magische Ich. Elemente des kritischen Polarismus (2001 aus dem Nachlass)