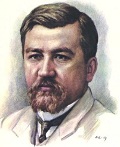Aleksandr Ivanovič Kuprin – Teil 1
von wietekWeiter zu Teil 2 – Aleksandr Ivanovič Kuprin
geboren am 26. Augustjul. / 7. Septembergreg. 1870 in Narovčat (Gouvernement Pensa, 500 km südöstlich von Moskau) und gestorben in Leningrad – wie St. Petersburg zu diesem Zeitpunkt schon hieß – am 25. August 1938, war ein Zeitzeuge des gesamten, großen Umbruchs in Russland, sowohl des gesellschaftlichen wie auch des literarischen. Er war noch bis in die letzte Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Russland (auch in der DDR) ein gern gelesener der letzten großen russischen Realisten, und viele seiner Erzählungen und Romane sind und werden noch heute in Russland verfilmt.
Mit Lev Tolstoj (*1828 †1910), Anton Čechov (*1860 †1904), Vladimir Korolenko (*1853 †1921), Fëdor Sologub (*1863 †1927), Pëtr Boborykin (*1836 †1921), Dmitri Mamin-Sibirjak (*1852, †1912), Ivan Bunin (*1870 †1953) und Maksim Gorkij (*1868 †1936) war er bekannt oder befreundet. In ihrem Kreis war er ein geschätzter Kollege. Mit Čechov, Bunin (seine erste Frau lernte er durch ihn kennen) und Mamin-Sibirjak (seine zweite Frau war eine Verwandte von ihm) war er näher bekannt und mit Gorkij war er zeitweilig sogar befreundet.
Mit Gorkij verbanden ihn sogar eine gewisse Wesensverwandtschaft und eine frappierende Parallelität der Lebensläufe: Gorkij war zwei Jahre älter als er (und starb zwei Jahre früher); wie Gorkij zog Kuprin, in den verschiedensten Berufen arbeitend, durch Russland, bevor er sich ausschließlich der Schriftstellerei widmete; beide waren bis zur Oktoberrevolution revolutionäre Schriftsteller – Gorkij allerdings ideologischer als Kuprin; sie arbeiteten in Gorkijs Verlagen »Snanie« und später im Verlag »Weltliteratur« zusammen und beabsichtigten mit Lenins Unterstützung die Bauernzeitung »Erde« zu gründen; beide emigrierten nach der Oktoberrevolution – Kuprin 1920 über Finnland nach Paris und Gorkij „aus gesundheitlichen Gründen“ 1921 über Berlin nach Italien (zu dieser Zeit war aus ihrem freundschaftlichen Verhältnis schon ein sehr distanziertes geworden); und beide kehrten nach Russland (jetzt Sowjetunion) zurück: Gorkij schon 1927 (und ließ sich immer mehr vom System vereinnahmen) und Kuprin 1937 – ein Jahr vor seinem und ein Jahr nach Gorkijs Tod (1936) –, um zu sterben, was er schon bei seiner Rückkehr wusste, denn er hatte Zungenkrebs.
Aleksandr Kuprin wuchs in sehr einfachen Verhältnissen auf: Seine Mutter stammte aus dem sehr berühmten, tatarischen, aber verarmten Fürstengeschlecht Kulunčakov und sein Vater war ein kleiner Beamter, der schon ein Jahr nach seiner Geburt an Cholera starb und die Familie völlig mittellos zurückließ. Mit sechs Jahren kam er in das Aleksandrovskij Waisenpensionat in Moskau (von wo er einen lebenslangen Hass auf die damaligen Erziehungsanstalten mitnahm), mit zehn Jahren kam er auf das Militärgymnasium, das kurz darauf in eine Kadettenanstalt umgewandelt wurde, die er als Zwanzigjähriger als Leutnant verließ.
Schon mit 13 Jahren schrieb er Gedichte und 1889, mit 19 Jahren, veröffentlichte er in einer Moskauer Zeitung seine erste Erzählung »Das letzte Debüt« (eine junge Schauspielerin begeht aus unerwiderter Liebe während einer Vorstellung Selbstmord), die ihm einige Tage Karzer einbrachte, weil er nicht zuvor eine Genehmigung von der Leitung der Kadettenanstalt eingeholt hatte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er mit seiner Beförderung zum Leutnant umgehend den Dienst quittiert, seine Mutter insistierte jedoch und er ging für vier Jahre zu einem Infanterieregiment nach Podolien, wo er den schlimmsten Stumpfsinn und die Intrigen des zaristischen Offizierslebens kennenlernte. 1893 versuchte er dem zu entkommen, indem er sich zur Aufnahmeprüfung an der Akademie des Generalstabs in St. Petersburg meldete. Auf der Reise dorthin bekam er mir einem Polizisten Streit und beleidigte ihn. Der Polizist verlangte eine Entschuldigung und machte Meldung, worauf Kuprin umgehend zu seinem Regiment zurückgeschickt wurde. Ein Jahr später quittierte er endgültig den Dienst.
Nun begann für ihn die Schule des Lebens. Er ging mit nur ein paar Rubeln in der Tasche nach Kiew, um sein Geld als Journalist zu verdienen. Dort veröffentlichte er dann auch in den verschiedensten Zeitungen und Journalen Reportagen, Glossen, Theaterberichte, Kurzgeschichte, kurzum alles, was gerade anfiel – vieles davon faste er 1897 in den Sammlungen »Kiewer Typen« und »Miniaturen« zusammen. Aber nicht nur dass er davon nicht leben konnte, ihn reizte das Unbekannte, reizten neue Erfahrungen. 1895 arbeitet er in einem Moskauer Betrieb, der Ventilatoren herstellte, 1896 als Stahlgießer im hoch industrialisierten Donezbecken, kurz danach gründet er in Kiew eine „Athletengesellschaft“ und einen Zirkus, 1897 findet man ihn als Gutsverwalter und Vorsänger in der Kirche, danach macht er eine Ausbildung zum Zahnarzt, um dann doch 1899 einer Theaterwandertruppe beizutreten, der er neun Monate die Treue hält und sich dann wieder von dem provinziellen Mief abwendet; Sänger, Privatlehrer und Landmesser sind die nächsten beruflichen Stationen. Zu guter Letzt beschließt er Mönch zu werden und zieht 1901 dann doch nach St. Petersburg, um ausschließlich Schriftsteller zu sein.
Diese „Wanderjahre“ sind der „Fundus“, aus dem er zeit seines Lebens geschöpft hat. Das brachte mit sich, dass er im Gegensatz zu den meisten Schriftstellern seiner Zeit kein bevorzugtes Hauptthema hatte, sondern aus der Reichhaltigkeit seines Lebens schöpfend zu vielen Bereichen des menschlichen und sozialen Lebens etwas zu sagen hatte. Er selbst sagte einmal, dass er alles, was er geschrieben, selbst erlebt habe, dass sein ganzes Schaffen Autobiografie sei.
(Anmerkung: In diesem Essay werden nur die Werke namentlich benannt, die ins Deutsche übersetzt sind – und das ist leider nur ein Bruchteil der ungefähr 200 Werke. Eine nahezu vollständige Auflistung – allerdings in russischer Sprache – befindet sich hier)
Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon (kritische) Erzählungen zu seinem Leben als Offizier geschrieben (Nachtlager 1895), über sein Leben mit den Zirkusleuten, zu Herzen gehende Tiergeschichten, über die Liebe (Olesja 1898 – eine der Welt besten Liebesgeschichte), Skizzen über die verschiedensten Personen und Berufe (s. o. »Kiewer Typen«) und auch nicht zuletzt sozialkritische Erzählungen wie Moloch (1896). Mit letzterer hatte er schon einige Berühmtheit erlangt. Sie ist eine seiner ersten revolutionären Erzählungen und handelt – erlebt in seiner Zeit als Stahlarbeiter im Donezbecken (Südostukraine) – von der frühkapitalistischen Ausbeutung der Arbeiter durch das reich gewordene Bürgertum, einer neuen Klasse Russlands, die von Altgläubigen und Juden dominiert wurde.
Mit offenen Armen wurde er von seinen Schriftstellerkollegen, wie Anton Čechov, Ivan Bunin und nicht zuletzt Maksim Gorkij aufgenommen. Er blieb zwar seiner Grundeinstellung, über alles, was er erlebt hatte, zu schreiben, treu, seine sozialkritischen, ja revolutionären Werke wurden jedoch schärfer. Hinzu kamen Erzählungen über die Juden – in der Südukraine gab es seit Jahren heftige Judenpogrome – (Die Jüdin 1904), in denen er die Voreingenommenheit der Zeitgenossen teilweise mit beißendem Spott bedachte. Das zaristische Offizierswesen nahm er weiterhin immer heftiger aufs Korn (Stabskapitän Rybikow 1905); dies gipfelte in seinem Roman Das Duell (1905), der ihn schlagartig weltberühmt machte, denn der Roman wurde noch im selben Jahr ins Deutsche und andere Sprachen übersetzt. In ihm zeigt er die ganze Sinnlosigkeit, den Stumpfsinn und den verrotteten Ehrbegriff dieser „Kaste“ auf: Der einzig einigermaßen Integre in diesem Kreis wird bei einem ihm aufgezwungenem Duell, das nach Absprache eigentlich ein Scheinduell sein sollte, erschossen.
In der Revolution von 1905 steht er eindeutig zu den Revolutionären und wettert gegen die „Abschlachtung“ der aufständigen Odessaer Matrosen. Mit seiner scharfen Reportage »Die Ereignisse von Sevastopol« handelt er sich einen Prozess ein, der durch die Kriegsereignisse bedingt erst später stattfinden kann und ihm „nur“ ein dauerhaftes Verbot, im Gebiet von Sevastopol zu leben, einbringt.
Auch nach der 1905er Revolution findet man ihn auf der Seite der Revolutionäre. Seit 1902 arbeitete er in Maksim Gorkijs Verlag »Snanje«, entfremdete sich aber nach und nach von Gorkij, denn er war mit dessen ideologischer Einstellung nicht einverstanden, er warf ihm vor, künstlerisch tendenziös zu sein. Kuprin war eher ein selbstbewusster Einzelgänger, ein Nonkonformist, dessen revolutionäre Einstellung eher dem Anarchismus Kropotkins oder Lev Tolstojs glich.
Weiter zu Teil 2 – Aleksandr Ivanovič Kuprin
Literatur Kuprin
Alexander Iwanowitsch Kuprin: Smaragd – Drei Erzählungen, Nachwort Erhard Hexelschneider, Insel Verlag Leipzig 1972. Enthaltene Erzählungen: Smaragd, ›Gambrinus‹, Olesja.
A. Kuprin: Olessja – und andere Novellen, Hans Bondy Verlagsbuchhandlung, Berlin W. 1911
Enthaltene Erzählungen: Olessja, Gambrinus, Die Hochzeit
Alexander Kuprin: Meistererzählungen, übersetzt von Eveline Passet, Nachwort von Ilma Rakusa, Manesse Verlag Zürich 1989. Enthaltene Erzählungen: Der Moloch, Das Nachtlager, Die Jüdin, Die Kränkung, Die mechanische Rechtspflege, Das Granatarmband, Der schwarze Blitz, Der Stern Salomos
A. Kuprin: Das Granatarmband – und anderes, Georg Müller München 1911. Enthaltene Erzählungen: Das Granatarmband, Moloch, Stabskapitän Rybnikow
A. Kuprin: JAMA – Die Lastergrube, Sittenroman, Vorwort von Dr. Savielly G. Tartakower, Internationaler Verlag „Renaissance“ 1923
Alexander Kuprin: Die Drehorgel und der weiße Pudel, Sanssouci Verlag Zürich 1979
Düwel, Wolf/ Grasshoff, Helmut [Hrsg]: Geschichte der russischen Literatur von den Anfängen bis 1917 (in zwei Bänden), Aufbau-Verlag 1986
Luther, Arthur: Geschichte der Russischen Literatur, Bibliographisches Institut Leipzig 1924
Lauer, Reinhard: Geschichte der russischen Literatur – von 1700 bis zur Gegenwart, C.H. Beck Verlag 2000