Was geschah am 24. und 25. Dezember?
von wietekWas geschah eigentlich am 24. Dezember im Jahre Null? … Nichts! … Denn das Jahr Null gibt es nicht. Unsere Zeitrechnung beginnt mit dem Jahr eins nach Christi Geburt (1 n. Chr.), das Jahr davor ist das Jahr 1 v. Chr., sprich, eins vor Christi Geburt. Demnach müsste der historische Christus im Jahr eins vor Christi Geburt geboren worden sein, damit er im Jahr eins nach Christi Geburt ein Jahr alt werden konnte. Nun, alle weiteren Gedankenspiele zu diesem Datumsproblem sollte man den Kabarettisten überlassen.
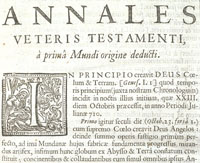
Ein prominentes Beispiel für eine Re-
konstruktion historischen Geschehens
anhand eines Bibelstudiums sind James
Usshers Annales veteris testamenti
Fakt ist, dass Jesus Christus als Mensch gelebt hat – man spricht in diesem Fall vom „historischen Jesus“. Aber wann er geboren wurde, ist nicht belegt, denn damals gab es weder Taufbücher (die Kirche musste ja erst noch gegründet werden) noch Standesämter mit Geburtsregistern. Man musste alles aus später Auf- geschriebenem rekonstruieren – und da ist Einiges geschrieben worden. Eine feste Regelung, wie die Jahre gezählt wurden, gab es auch nicht – jeder hatte da so seine eigene Methode: Die Römer zählten vom Tag der Gründung Roms an (woher sie den Tag wussten, weiß keiner), die Juden vom Tag der Erschaffung der Welt (wer ihnen den verraten hat, ist auch unbekannt) und … und … und… Das Jahr begann auch nicht überall am 1. Januar. Bei den Römern war es (nach unserem Kalender) der 1. März, in Byzanz der 1. September usw. Aber des Durcheinanders ist noch nicht genug. Statt dass es besser wurde, wurde es schlechter, denn in der Folge gab es auch noch verschiedene Kalender: So feiert die Russische Orthodoxie und andere, die nach dem julianischen Kalender leben, heute Weihnachten, den 25. Dezember, wenn bei uns nach dem gregorianischen Kalender der 6. Januar ist.
Nachdem man sich durch all das durchgebissen hatte, kam man zu dem Schluss, dass der historische Jesus im Jahr 6 oder 7 vor Christi Geburt geboren worden sein musste. Auf ein Datum konnte man sich aber nicht einigen – bei den einen war es der 24. Dezember, andere behaupten, es sei der 25. März gewesen. Der Turmbau zu Babel lässt grüßen.
Wie es denn auch immer gewesen sein mag, ob man gläubig im Sinne einer Kirche oder ein Atheist ist, Weihnachten hat Symbolcharakter: Weihnachten ist das Fest der Freude, der Familie und des Friedens. Und es ist interessant zu erfahren, wie die Welt sich daran gehalten hat. Aber erst mal noch zum Weihnachtsfest selbst.
Im Jahr 274 legte der römische Kaiser Aurelian den „Geburtstag“ des Sonnengottes „sol invictus“, den er als seinen persönlichen Schutzherrn betrachtete, auf den 25. Dezember; und der dann schon christliche römische Kaiser Constantinus II. bestimmte im Jahr 354 eben diesen Tag zum Geburtstag Jesu Christi, womit das Weihnachtsfest „geboren“ war. Im Jahr 525 begründete der Mönch Dionysius Exiguus nach einem komplizierten Verfahren die bis heute gültige „christliche Zeitrechnung“, nach der Jesus Christus ebenfalls am 25. Dezember geboren wurde.

Karl I., genannt Karl, der Große,
war im Jahr 800 der erste von
vielen Herrschern, die sich an
Weihnachten krönen ließen, um auf
höhere Weihen zu verweisen.
Die nach höchsten Weihen strebenden Herrscher „sonnten“ sich im Glanz dieses Tages: Schon im Jahr 498 hatte sich der Merowinger König Chlodwig I. an diesem Tag christlich taufen lassen. Und in der Folge wurde der Tag ganz offensichtlich zum bevorzugten Krönungstag:
Im Jahr 800 wurde in Rom der Franken- könig Karl I. von Papst Leo III. zum Kaiser gekrönt; er war seit dem Untergang des Römischen Reiches im Jahr 476 der erste, der den Titel „Römischer Kaiser“ erhielt: Karolus serenissimus Augustus a Deo coronatus magnus pacificus imperator Romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam dei rex Francorum atque Langobardorum (dt. Karl, durchlauchtigster Augustus, von Gott gekrönter, großer Frieden stiftender Kaiser, das Römische Reich regierend, der von Gottes Gnaden auch König der Franken und Langobarden ist).
Schon zu Lebzeiten bekam Karl I. den Beinamen „der Große“, denn er war der bedeutendste Herrscher des Mittelalters; er starb in Aachen und ist dort auch beigesetzt. 1165 wurde er heiliggesprochen – was angesichts seines kriegerischen und ausschweifenden Lebenswandels von einer etwas merkwürdigen Auffassung von „Heiligkeit“ zeugt….
Am 25. Dezember 983 wurde der dreijährige Otto III. in Aachen zum Deutschen König gekrönt. 996 wurde er Kaiser des Heiligen Römischen Reiches; nach seinem Tod 1002 wurde er ebenfalls in Aachen begraben. Im Jahr 1046 krönte Papst Clemens II. den Deutschen König Heinrich III. und seine Frau Agnes von Poitou an diesem Tag zu Kaiser und Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches.
Für Kaiserkrönungen war der Papst zuständig – noch! Später ließen die Potentaten den Papst nur noch zuschauen und krönten sich selbst. Krönungen zum König durften die Subchargierten durchführen: So wurde am Weihnachtstag 1066 in der Londoner Westminster Abbey der Herzog der Normandie, Wilhelm I., der Eroberer, von Ealdred, Erzbischof von York, zum König von England gekrönt.
Auf dem Ersten Kreuzzug ins Heilige Land wurde am 25. Dezember 1100 Balduin von Boulogne vom lateinischen Patriarchen von Jerusalem zum ersten König von Jerusalem gekrönt. Aber über das, was in den folgenden zwei Jahrhunderten im Namen Christi bei den Kreuzzügen geschah, deckt man besser schamhaft den Mantel des Schweigens – es passt wahrlich nicht zum Fest der Liebe.
Ja, und sogar 1926 wurde am Weihnachtstag noch einmal ein Kaiser gekrönt, diesmal allerdings nicht vom Papst oder seinen lokalen Stellvertretern:
Hirohito wurde Kaiser von Japan und „regierte“ bis zu seinem Tod 1989 als der 124. Tenno von Japan.
Aber nun genug der „von Gott (und anderen) begnadeten“ Könige und Kaiser.

Franz von Assisi (hier auf einem
zeitgenössischen Wandgemälde)
stellte Weihnachten 1223 das
Geschehen in Betlehem mit le-
benden Menschen und Tieren
nach – es war die Geburtsstunde
der Weihnachtskrippe.
Bis ins 13. Jahrhundert hinein wurde das Weihnachtsgeschehen – Jesus in einer Krippe in einem Stall in Bethlehem – nur bildlich dargestellt. An Weihnachten 1223 stellte es Franz von Assisi erstmals mit lebenden Menschen und Tieren nach. (Franz von Assisi wurde schon zwei Jahre nach seinem Tod heiliggesprochen, er ist der Begründer des Franziskanerordens und Verfasser des Gebets „Sonnengesang“, in dem er die Schöpfung preist – ein Gesang, den man gerade heute immer wieder sprechen sollte.) Diese theaterhafte Darstellung war der Vorläufer der heutigen Weihnachtskrippen. Mit zu den nachweislich ältesten und bekanntesten Krippen gehören die Prager (1562), die Münchner (1607) und die Innsbrucker (1608) Krippe.
Zu Weihnachten 1818 wurde in der Kirche St. Nikolaus in Oberndorf bei Salzburg in der Christmette zum ersten Mal das wohl schönste und ergreifendste Weihnachtslied der Welt gesungen: „Stille Nacht, Heilige Nacht“.
Es ist ein wunderbar gelungenes, ehrfurchtsvolles Lied, das früher meist ohne Instrumentalbegleitung und nur an Heiligabend und dem 1. Weihnachtsfeiertag gesungen wurde; und bis vor wenigen Jahren hatte sogar der Kommerz noch Respekt vor dieser Tradition und es vom vorweihnachtlichen (ehemals: Adventszeit) Einkaufsgedudel ausgenommen. Sein Dichter, Pfarrer Joseph Mohr, und sein Komponist, der Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber, haben sich sicher nicht träumen lassen, dass dieses Lied einmal, in 30 Sprachen übersetzt, um die ganze Welt gehen und quasi zum Symbol für Weihnachten werden würde.
Ja, sogar die moderne Medienzeit begann mit der „Stillen Nacht“: Zu Weihnachten im Jahr 1952 begann der Nordwestdeutsche Rundfunk seinen regelmäßigen Fernsehbetrieb mit dem weihnachtlichen Fernsehspiel „Stille Nacht, Heilige Nacht“, das von den Entstehungsgeschichte des Liedes erzählte.

Die Sendlinger Mordweihnacht von 1705
(hier auf einer Tuschezeichnung von 1846)
kostete über 1000 Menschen das Leben.
Aber es geschah auch anderes – und da war von stiller und heiliger Nacht nichts zu spüren: die „Sendlinger Mordweihnacht“ an Weihnachten 1705. Im Spanischen Erbfolgekrieg hatte der habsburgische Kaiser Joseph I. Bayern besetzt. Das Volk (sprich die Bauern) erhoben sich gegen die kaiserlichen Besatzungstruppen und versuchten, München zu erobern, was misslang. Die Aufständischen mussten sich ergeben und legten, nachdem man ihnen Pardon, also eine Zusicherung, dass man ihr Leben schonen würde, gewährt hatte, ihre Waffen nieder. Danach wurden sie alle an Ort und Stelle niedergemetzelt; einige flüchteten auf den Sendlinger Friedhof, auf heiligen Boden, wo sie sich geschützt glaubten. Auch dort wurden sie niedergemetzelt; die Kirche wurde geplündert und zerstört. Über 1.100 Menschen wurden an diesem Weihnachten massakriert.
Am 24. Dezember 1825 übernahm Nikolaus I. (aus dem Haus Romanow-Holstein-Gottorp) die Regentschaft als Zar und Kaiser von Russland. Er war einer der autoritärsten Zaren Russlands; seine erste Tat war die Niederschlagung des Dekabristenaufstandes – die fünf Anführer wurden aufgehängt und 110 Unterstützer nach Sibirien geschickt.
1944 hat die Rote Armee zu Weihnachten Budapest eingeschlossen, womit die fast 3 Monate dauernde Schlacht um Budapest begann, die nahezu 200.000 Menschenleben kostete.
Weihnachten 1979 marschierten russische Truppen in Afghanistan ein.
1989, am 25. Dezember, wurden der ehemalige rumänische Diktator Ceausescu und seine Frau von einem Militärgericht verurteilt und sofort hingerichtet.
Am 24. Dezember 1991 trat Michail Gorbatschow als Präsident der Sowjetunion zurück; die UdSSR existierte damit nicht mehr, und am 25. Dezember nahm Russland als Rechtsnachfolger den Ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat ein.
Aber da war noch etwas. Etwas, das so unwahrscheinlich klingt wie ein Märchen. Soll man sich mit Wehmut daran erinnern und es als Relikt einer vergangenen Zeit abtun?
Doch es war wirklich Weihnachten, still und heilig und wie es weihnachtlicher nicht sein kann.
Man sollte – auch wenn es schwerfällt, daran zu glauben – jede Weihnacht daran denken und ihn vielleicht als kleinen Lichtblick der Hoffnung für die Menschheit sehen: den Weihnachtsfrieden des Ersten Weltkrieges.

Nahezu ein Wunder war der Weihnachts-
frieden, den die Soldaten im Jahr 1914
an allen Fronten einhielten.
Der Erste Weltkrieg war schon nach wenigen Monaten zu einem Graben- krieg erstarrt. Vielerorts lagen die Schützengräben des Gegners nur 50 bis 100 m auseinander, man konnte sich sogar durch Zuruf verständigen.
Am 24. Dezember 1914 legten spontan, ohne Befehl und unabge- sprochen, sowohl an der Westfront wie auch an der Ostfront Soldaten beider Seiten ihre Waffen nieder. An der gesamten Front wurde nicht geschossen. Man schätzt heute, dass es allein an der Westfront mindestens 100.000 Soldaten waren, die an diesem Tag auf Kampfhandlungen verzichteten. Damit nicht genug: Sie kamen aus ihren Gräben und Löchern, gratulierten sich, beschenkten sich gegenseitig, sangen miteinander und feierten, ja, sie spielten sogar Fußball gegeneinander.
Begonnen hatte alles – soweit man es nachvollziehen kann – an der Front südlich von Ypern (Westflandern, Belgien), an der sich die Briten und die Deutschen gegenüberstanden. Durch Zuruf hatte man sich verständigt, dass man die Gefallenen bergen wolle. Danach wurde ein gemeinsamer, zweisprachiger Gottesdienst mit einem britischen Pfarrer abgehalten. Leutnant Arthur Pelham Burn von den Gordon Highlanders schrieb in sein Tagebuch:
„The Germans formed up on one side, the English on the other, the officers standing in front, every head bared. Yes, I think it was a sight one will never see again.”
(„Die Deutschen hatten sich auf der einen Seite aufgestellt, die Engländer auf der anderen, die Offiziere standen vor ihnen, alle ohne Kopfbedeckung. Ja. Ich glaube das war ein Anblick, den man nie wieder sehen wird.“)
[zitiert nach Malcolm Brown und Shirley Seaton: Christmas Truce – The Western Front December 1914]
Wie sich dieses Weihnachtswunder entlang der ganzen Frontlinie fortpflanzte, ist eines der Mysterien, über die man nur spekulieren könnte, wenn es denn sinnvoll wäre. Kleine Tannenbäume und Kerzen wurden auf die Wälle der Gräben gestellt. Man erzählt davon, dass Deutsche Bierfässer zu den Briten gerollt und dafür die typisch englischen Plumpuddings (Weihnachtspudding) bekommen, Soldaten beider Seiten Zigaretten miteinander getauscht und Karten gespielt haben, von gemeinsamem Schweinegrillen ist die Rede, und, wie schon erwähnt, gemeinsamem Fußballspiel; und wenn der Gegner nach dem vielen Feiern besoffen war, hat man ihn zu seinen Leuten zurückgetragen.
Der Frieden dauerte bis zum 26. Dezember und an Stellen, an denen schottische Regimenter lagen, sogar bis Neujahr – weil das ein besonderer Feiertag für die Schotten ist.
Dann bedankte man sich beieinander und fing wieder an zu schießen. Wie es weiterging, ist bekannt … aber vielleicht sollte man das einmal ausblenden und sich mit der Frage trösten „Was wäre gewesen, wenn …?“
Allen ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest!
21. December 2011