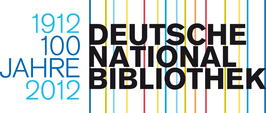100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek
von zvabMit über 90.000 Neuerscheinungen pro Jahr ist der deutsche Buchmarkt unübersichtlicher als je zuvor. Bücher werden gedruckt und bleiben ungelesen, andere sind schnell vergriffen oder von so großer Seltenheit, dass sie irgendwann zu heiß begehrten Sammlerstücken werden. Wer hat noch den Überblick über all diese Bücher? Und, wollte man sie alle lesen, wohin würde man gehen? Die Antwort auf diese Fragen findet sich in der Deutschen Nationalbibliothek, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum feiert.
Die Idee einer Nationalbibliothek ist einfach: Von jedem Buch, das im betreffenden Land – oder im Ausland in der Landessprache – erscheint muss der Verlag der Bibliothek ein Pflichtexemplar zur Verfügung stellen. Dieses wird dann in den Bestand aufgenommen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Erfüllung des Bildungsauftrages nahm in Deutschland am 3. Oktober 1912 erstmalig feste Gestalt an. Gespräche zur Schaffung einer Nationalbibliothek gab es bereits Jahre vor ihrer letztlichen Entstehung, denn kulturpolitisch hinkte man den westeuropäischen Nachbarn weit hinterher: In Großbritannien sammelte das British Museum die Buchbestände des Landes, in Frankreich übernahm die bibliothèque nationale diese Aufgabe.
Eine Regelung im 1871 neu gegründeten Deutschen Reich zu erzielen war jedoch keine leichte Aufgabe. Während Preußen hoheitliche Dominanz behielt, war das Reich als Staatenbund doch föderal und die einzelnen Länder somit in ihrer Gesetzgebung weitestgehend eigenständig. Doch das Fehlen einer nationalen Kultur- oder Wissenschaftspolitik – und somit auch das Fehlen einer nationalen Bibliothekspolitik – machte sich schnell bemerkbar. Zwar sammelte die Königliche Bibliothek zu Berlin den deutschen Buchbestand, doch erhielt sie lediglich Pflichtexemplare der in Preußen gedruckten Bücher, die weniger als die Hälfte der deutschen Buchproduktion um die Jahrhundertwende ausmachten.
Das Vorantreiben einer Lösung ist schließlich Erich Ehlermann zu verdanken, dem 2. Vorsteher des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. Unterstützt durch die Leipziger Verlagsbuchhändler Arthur Meiner und Albert Brockhaus gab er den Anstoß zu Verhandlungen, die von Ehlermann, Brockhaus und dem 1. Vorsitzenden des Börsenvereins Karl Siegismund mit dem Reichskanzler, dem preußischen Kulturminister und der Direktion der Königlichen Bibliothek geführt wurden. Trotz der Ablehnung einer zentralen Lösung durch das Reich kam man schließlich zu einem Kompromiss: Die neugeschaffene Deutsche Bücherei würde, zur Wahrung des aktuellen Buchbestandes, den kulturpolitischen Sammelauftrag wahrnehmen, dabei jedoch darauf verzichten, den Bestand rückwärtig oder um fremdsprachige Titel zu ergänzen; dies blieb ein Vorrecht der Königlichen Bibliothek.
Es kam schließlich zu einer Einigung zwischen dem Königreich Sachsen und der Stadt Leipzig, den alleinigen finanziellen Trägern. Am 25. September 1912 wurden die Pläne mit einer Bekanntmachung im Börsenblatt konkretisiert, die Vertragsunterzeichnung zwischen Königreich, Stadt und dem Börsenverein folgte am 3. Oktober 1912. Für den Bestand der Bibliothek trug der Börsenverein Sorge, der mit den Buchhändlern eine freiwillige Vereinbarung zur Abgabe von Exemplaren getroffen hatte. Ein Pflichtexemplar gab es somit noch nicht, doch schon im ersten Jahr trafen 21.000 Titel ein. Erst im September 1935 wurde die Selbstverpflichtung des Buchhandels durch die Anordnung eines Pflichtexemplars ersetzt.
Während des 2. Weltkrieges erlitt die Deutsche Bücherei in Leipzig zahlreiche Rückschlage, unter anderem die Zerstörung des Baus auf dem Deutschen Platz. Dennoch überdauerte sie die Kriegsjahre und als 1946 mit der Gründung der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main auch eine westdeutsche Lösung entstand, existierten forthin zwei Nationalbibliotheken, die gleichermaßen den deutschen Buchbestand wahrten und in einer Bibliografie verzeichneten.
Der deutsche Einigungsvertrag regelte 1990 nach fast 50 Jahren Koexistenz die Vereinigung der Deutschen Bücherei und der Deutschen Bibliothek zur Deutschen Nationalbibliothek, die bis heute den kulturpolitischen Sammelauftrag wahrt.
3. October 2012