Alle Artikel von
Irmtraud Morgner: Ein weiblicher Tausendsassa

Ich gebe es zu: Da ihr Buch Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura. Roman in dreizehn Büchern und sieben Intermezzos (1974) überall im Volksbuchhandel der DDR herumstand, war mir das Buch nie einen Blick wert, da half auch der auffällige Schutzumschlag von Heinz Hellmis nix. Das gehörte sich einfach nicht als DDR-Autor: Präsent zu sein im Handel. Über dem Ladentisch: Das war der Platz für sozialistische Scribenten, für die man sich demonstrativ nicht interessierte.
Diese Ignoranz gegenüber der Autorin Morgner haben Irmtraud Morgner, geboren am 22. August 1933 in Chemnitz, studierte gleich nach dem Abitur von 1952 bis 1956 Germanistik und Literaturwissenschaft an der Universität Leipzig (u.a. bei Hans Mayer und Ernst Bloch). Von 1956 bis 1958 war sie Mitarbeiterin in der Redaktion der Zeitschrift „Neue deutsche Literatur“. Dort, im Frühjahr 1957, sah sie einen Redakteur „heilige Worte“ redigieren: „Der Redakteur tilgte zwei Strophen eines Gedichts, ersetzte gegebene Worte durch eigene und fertigte aus dem Abfall zwei neue Verse… (Weiterlesen …)
Hans Erich Nossack: Aufbruch ins Nicht-Versicherbare
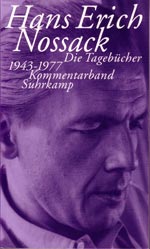
Er gilt als sperrig, schwer zugänglich und wenig marktgerecht: Eigentlich genügend Abschreckungspotential, ein Buch des Autors Hans Erich Nossack (1901 – 1977) gar nicht erst in die Hand zu nehmen, der denn auch durch Sartres Vermittlung und Veröffentlichungen in Frankreich bekannter war als in Deutschland (1973 erhielt er den Prix Pour le Mérite). Nossack nicht zu lesen hieße allerdings, einen der größten deutschen Prosaisten des vergangenen Jahrhunderts zu verpassen.
Heute ist in der literarischen Öffentlichkeit kaum mehr die Rede von ihm. Schade, denn man muss sich weit umsehen, um einen Erzähler solchen Ranges zu finden: Freilich, mit schnellem Querlesen ist es bei ihm nicht getan, der so lange Zeit ein „Doppelleben“ als Hamburger Kaufmann und Schriftsteller führte. Man muss sich einlassen wollen auf seine leise bohrend auf den Punkt geschriebene Prosa und den hintergründigen Humor. (Weiterlesen …)
Alexander Moritz Frey: Der phantastische Satiriker
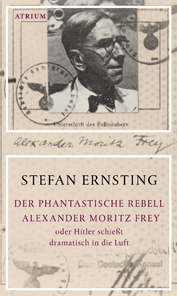
Seine Freunde nannten ihn Amf – und vielleicht hat ihn auch Adolf Hitler, sein Regiments„kamerad“ im Ersten Weltkrieg, im Schützengraben so gerufen: Amf steht für Alexander Moritz Frey. Als Frey 1915 Sanitäter in der gleichen Einheit wurde, in der Hitler Meldegänger war, hatte er zahlreiche Geschichten in Zeitungen und einige Bücher veröffentlicht. Hitler war das ziemlich egal, aber beider Feldwebel Max Amann interessierte sich ausnehmend für die Pressebranche – und fragte Frey darüber ein Loch in den Bauch. Vielleicht hat Frey dadurch unfreiwillig eine unheilvolle Karriere befördert: Amann wurde späterer Reichsleiter der NSDAP-Presse und Herausgeber von Mein Kampf.
Mit diesen Beziehungen hätte Frey locker Feuilletonchef des Völkischen Beobachter werden können (man hat ihm diesen Job angeboten), doch hatte er für das braune Pack nur Verachtung übrig – seine pazifistische Gesinnung hätte man spätestens seinem Feldsanitätsroman Die Pflasterkästen (1929) entnehmen können, der von allen namhaften Rezensenten der Weimarer Republik an die Seite von Remarques Im Westen nichts Neues (wenn nicht darüber) gestellt wurde. Zum Glück war Amf nicht zu Hause, als am 15. März 1933 die Nazis seine Wohnung auseinandernahmen, sofort danach begab er sich ins Exil nach Salzburg, flüchtete später in die Schweiz. Dort lebte und arbeitete er in bitterster Armut bis zu seinem Tod 1957; und hätten ihn nicht Freunde wie Thomas Mann finanziell unterstützt, wäre er wahrscheinlich verhungert.
Vielleicht leitet die von Stefan Ernsting verfaßte Biographie Freys, die Anfang nächsten Jahres unter dem Titel Der phantastische Rebell Alexander Moritz Frey oder Hitler schießt dramatisch in die Luft bei Atrium erscheint, eine Wiederentdeckung dieses brillanten Erzählers und Satirikers ein. Es wäre nicht allein schön, es wäre auch nötig. Wäre Frey bekannter, die Feuilletons hätten ihn sicher in die Schublade „der deutsche Edgar Allan Poe“ gesteckt. Nicht ganz zu Unrecht.
(Weiterlesen …)
Albert Vigoleis Thelen: Der begnadete Erzähler
Entstehungsgeschichten von Büchern sind manchmal skurril, diese hier aber sollte einmalig sein: Da sitzt ein fast 50jähriger Deutscher Anfang der 50er Jahre in Amsterdam, weil er nicht ins „4. Reich“, wie er das entnazifizierungsunwillige Nachkriegs-Deutschland nennt, zurückkehren will, schreibt Gedichte und schmeißt sie großenteils wieder weg, schmiedet Verlagspläne, die alle nichts werden und erzählt im Freundeskreis die wildesten Geschichten aus seiner Exilzeit auf Mallorca, wo er von 1931 bis 1936 lebte. Für den Unterhalt sorgt natürlich seine Frau.
Anthony Burgess: Der Hexenmeister aus Manchester
Es ist ein ärztliches Urteil, dem wir – so heißt es wenigstens – das Erwachen eines der bedeutendsten literarischen Genies des vergangenen Jahrhunderts zu verdanken haben: Der am 25. Februar 1917 in Manchester geborene Lehrer für Englische Literatur John Anthony Burgess Wilson erhielt 1959 die verheerende Diagnose, an einem inoperablen Gehirntumor zu leiden: Er möge sich innerhalb der nächsten 12 Monate schon auf sein Ableben gefaßt machen, bedeutete ihm der Arzt. (Weiterlesen …)

