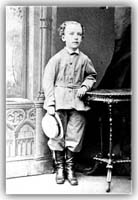Alle Artikel von
Aleksej Michajlovič Remizov – Teil I: Cancellarius des Affenordens

Nikolaus II.
(Gemälde von E. Liphart)
Russlands Weg in die Katastrophe
Mit der Wende zum 20. Jahrhundert begann für Russland die schrecklichste Zeit seiner Geschichte.
1894 folgte Nikolaus II. seinem Vater Alexander III. auf dem Thron. Er führte die erzkonservative Politik seines Vaters und dessen radikalkonservativen Bera- ters Pobedonoszev nahtlos fort; er war ein autokra- tischer Herrscher von Gottes Gnaden – Reformen oder gar Demokratie waren ihm ein Gräuel, wie er schon bei der Thronübernahme in einer Rede verlauten ließ.
(Weiterlesen …)
Fëdor Sologub, der „Sänger des Todes“ – Teil I
Ich nehme ein Stück grauen, armseligen Lebens und schaffe daraus eine liebliche Legende, weil ich ein Dichter bin. Magst du, Leben, in Dunkelheit verharren, trüb und alltäglich, oder in wütenden Bränden toben, ich, der Dichter, werde über dir eine von mir geschaffene Legende aufbauen – eine Legende vom Schönen und vom Entzückenden.
[Anfang der Legende im Werden von Fëdor Sologub, übersetzt von Friedrich Schwarz]
Fëdor Sologub (eigentlich Fëdor Kuzmič Teternikov), am 17. Februar jul./ 1. März greg. 1863 in St. Petersburg geboren, gehört zusammen mit Valerij Brjusov (*1873, †1924) und Nikolaj Minskij (*1855, †1937) zur älteren Generation der russischen Symbolisten. Schon mit zwölf Jahren schrieb er Gedichte (die verloren gegangen sind), im Jahr 1882 verteidigte er am Sankt Petersburger Lehrerbildungsinstitut seine Diplomarbeit mit dem Titel Märchen des Tierepos und die Ethik (im Original Skazki životnovo ėposa i nravstvenno-bytovye) und 1884 veröffentlichte er (noch unter seinem richtigen Namen) in der Kinderzeitschrift Wesna (dt. Frühling) die Fabel „Fuchs und Igel“. Letzteres Ereignis gilt als der eigentliche Beginn von Sologubs schriftstellerischer Tätigkeit.
Sologub hat sehr bewusst die Blütezeit des russischen Realismus mit ihren Größen Dostoevskij und Tolstoj miterlebt, ebenso jedoch auch ihren „Niedergang“, den Übergang zum Naturalismus. Politisch geprägt wurde er von der hoffnungslosen Zeit der Repression unter Alexander III., die er als Lehrer an verschiedenen Orten in der Provinz erlebt (oder besser: durchgestanden) hat.
[Die für das Verständnis von Fëdor Sologubs Schaffen wichtigen gesellschaftspolitischen und künstlerischen Voraussetzungen wurden in den Essays Kaiser Alexander III. und Aufbruch in die Moderne – die russischen Symbolisten dargelegt.]
(Weiterlesen …)
Fëdor Sologub, der „Sänger des Todes“ – Teil II
Nachdem in Teil I des Essays die Person Fëdor Sologub im Mittelpunkt der Betrachtungen stand, soll in diesem Teil sein Schaffen umrissen werden.
Wie alle Symbolisten betrachtet auch Sologub das Leben auf dieser Welt nicht als die einzige Form des Seins.
Die irdische Existenz ist nur ein Teil – und zwar der kleinere – des Menschen, denn er selbst ist Teil einer jenseitigen, allumfassenden Sphäre, die seinem Erkenntnisbereich entzogen ist. Nur eines ist sicher: Diese Sphäre ist vollkommen, das irdische Leben dagegen eine vorüberge- hende Qual. Wie ein Wurm, den Schutz der Dunkelheit suchend, den Tag flüchtend, sich in die Erde bohrend, krümmt sich der Mensch während seiner Existenz auf Erden. Die irdische Welt ist jedoch Teil des Ganzen, dessen Gesetze auch auf sie einwirken. Der Mensch kommt aus dem Metaphysischen, der Jenseitigkeit, und wird durch seinen in die Irre geleiteten Willen in die irdische Existenz gestoßen, aus der er mit dem Tode wieder ins Metaphysische entschwindet. In der Geschichte „Die Kommenden“ aus dem Buch der Märchen schreibt Sologub:
Niemand weiß, was kommen wird.
Aber es gibt einen Ort, wo die Zukunft durch das blaue Gewebe der Wünsche durchschimmert. Das ist der Ort, wo die noch Ungeborenen ruhen. Dort ist es schön, still und kühl. Dort gibt es keinen Kummer, und statt der Luft weht dort eine Atmosphäre reiner Freude, die den Ungeborenen das Atmen leicht macht. (Weiterlesen …)
17. Juli 1936
Wer weiß heute noch, wofür dieses Datum steht? Hand aufs Herz: Aus den letzten drei Generationen wohl niemand mehr. Und aus der älteren Generation vielleicht eine Handvoll junggebliebener Alt-68er. In Spanien ist das vermutlich anders, aber wahrscheinlich auch nicht viel besser.
Dabei ist das eigentlich ein Tag, an dem – wie sich später herausstellte – Weltgeschichte geschrieben wurde: Am 17. Juli 1936 putschte in Marokko, das damals unter spanischer Herrschaft stand, das Militär gegen die republikanische Regierung Spaniens – eigentlich nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit und schon gar nicht in Spanien. Schon am nächsten Tag übernahm General Francisco Franco Bahamonde (44 Jahre alt und schon seit 10 Jahren General) das Kommando über den Putsch, der nun auch auf das Mutterland übergriff. Am 21. Juli begann die – auch literarisch und medial berühmt, ja zur Legende gewordene – Belagerung des Alcázars von Toledo. Ende September avancierte Franco – er soll sich selbst ernannt haben – zum „Generalisimo“ der Junta und „El Caudillo“ (Führer) der nationalspanischen Regierung der eroberten Gebiete Spaniens. Schon im November erkannten das Deutsche Reich unter Hitler und Italien unter Mussolini seine Regierung als die einzig legale an – was jedoch nicht zu dem Trugschluss verleiten darf, dass die Putschisten eine nationalsozialistische oder faschistische Ideologie verfolgten, sie waren stramm konservativ.
Wie war das einstige Weltreich, von dem sein Kaiser Karl V. (*1500, †1558) einst sagen konnte, dass in ihm die Sonne niemals unterginge, und das sich mit England einmal die ganze Welt geteilt hatte, in eine so desolate Lage geraten? (Weiterlesen …)
Aufbruch in die Moderne – die russischen Symbolisten
Die große Zeit der russischen Literatur war das 19. Jahrhundert gewesen. Es war die Zeit des Realismus, für die große Namen wie Nikolaj Gogol, Ivan Turgenev, Fëdor Dostoevskij und Lev Tolstoj (um nur die berühmtesten zu nennen) stehen. In ihren Werken wurde die Lebenswirklichkeit in allen Bereichen geschil- dert – gesellschaftlich, politisch und rein menschlich; die Schriftsteller sahen ihre Auf- gabe darin, aufklärend, kritisch, im weitesten Sinn des Wortes erzieherisch zu wirken. Zum Zeitpunkt des Todes von Dostoevskij 1881 war der Höhepunkt des Realismus erreicht. Danach sank das Interesse sowohl der Schriftsteller als auch der Leser ständig; immer weniger sahen die Schriftsteller ihre Auf- gabe darin, „belehrend“ – d. h. positive Lösungsansätze aufzeigend – zu wirken. Die Schriftsteller des sich aus dem Realismus entwickelnden Naturalismus – wie Boborykin und Mamin-Sibirjak – beschränkten sich darauf, schonungslos die Finger auf die blutenden Wunden der Gesellschaft zu legen. Čechov – ursprünglich ein aufrechter Realist – glitt in Ironie und Zynismus, ja fast in die Hoffnungslosigkeit, ab. Lev Tolstoj verwarf in seinem Werk Die Beichte (1882) gar sein ganzes bisheriges Leben und Schaffen. Was war geschehen? (Weiterlesen …)
Aleksandr Ivanovič Kuprin – Teil 2
Zu Teil 1 – Aleksandr Ivanovič Kuprin
Die Zeit bis zum Ausbruch der Ersten Weltkrieges war für Kuprin nerven- und kräftezehrend: Trennung von seiner Frau, Heirat der zweiten Frau, ein aufreibendes Boheme-Leben, Reisen von Finnland bis auf die Krim. Literarisch war es jedoch eine fruchtbare Zeit. Von den vielen, in dieser Zeit entstandenen Werken sind in deutscher Sprache erschienen:
Die Kränkung (1906), eine Erzählung voller schwarzem Humor, in der sich die „Zunft“ der Diebe dagegen wehrt, für die Pogrome gegen die Juden verantwortlich zu sein, wofür die Polizei sie – der Einfachheit halber – verantwortlich macht und prügelt. (Weiterlesen …)
Aleksandr Ivanovič Kuprin – Teil 1
Weiter zu Teil 2 – Aleksandr Ivanovič Kuprin
geboren am 26. Augustjul. / 7. Septembergreg. 1870 in Narovčat (Gouvernement Pensa, 500 km südöstlich von Moskau) und gestorben in Leningrad – wie St. Petersburg zu diesem Zeitpunkt schon hieß – am 25. August 1938, war ein Zeitzeuge des gesamten, großen Umbruchs in Russland, sowohl des gesellschaftlichen wie auch des literarischen. Er war noch bis in die letzte Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Russland (auch in der DDR) ein gern gelesener der letzten großen russischen Realisten, und viele seiner Erzählungen und Romane sind und werden noch heute in Russland verfilmt. (Weiterlesen …)
Graf Aleksej Konstantinovic Tolstoj
Jeder, der den Namen Tolstoj liest oder hört, denkt sofort an das große, streitbare, weltberühmte Schriftstellergenie Lev Nikolaevič. Aber es gab noch zwei andere große Tolstojs, die in seinem Schatten standen: Aleksej Konstantinovič (*1817, †1875) und Aleksej Nikolaevič (*1883, †1945), der zu Sowjetzeiten „der rote Graf“ genannt wurde. Ersterer stand dort, was seine literarische Größe betrifft, ganz sicher zu Unrecht.
Alle drei Tolstojs waren Schriftsteller und mehr oder weniger nah miteinander verwandt, sie hatten einen gemeinsamen Urahnen – Aleksej Nikolaevič in der sechsten und Lev Nikolaevič und Aleksej Konstantinovič, von dem dieser Essay handeln wird, mit einem gemeinsamen Urgroßvater in der vierten Generation (Stammbaum der drei Tolstoj-Schriftsteller hier als PDF). Bei dem riesigen Stammbaum des Geschlechtes der Grafen Tolstoj, der bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht und ca. 650 Personen umfasst, ist dies schon ein erwähnenswertes Detail. (Weiterlesen …)
Lev Tolstoj – Denker und Philosoph
So einhellig Lev Tolstoj weltweit als einer der größten Schriftsteller (wenn nicht gar: der größte) gefeiert wurde, so umstritten ist er als Denker und Philosoph – zu seinen Lebzeiten und heute.
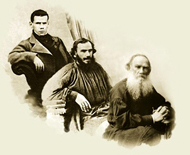
Tolstoj als Jüngling,
junger Mann und im Alter
Wie in Teil I dieser Essay-Trilogie dargestellt, war er von Kindheit an ein Mensch von messerscharfem analytischem Verstand bei gleichzeitiger höchster Unduldsamkeit gegenüber allen, die seiner Argumentation nicht folgen konnten oder wollten – heute würde man sagen, er war ein extrem dominanter Mann. Hinzu kam seine hervorragende Fähigkeit, sich auszudrücken – sei es mündlich oder schriftlich –, und sein perfektes logisches Denken. Er war sich dessen zwar bewusst, aber als dominanter Typ bediente er sich dessen auch unbewusst. Schon in seinem Auftreten drückte sich diese Dominanz, noch verstärkt durch seine hocharistokratische Mentalität, aus und er erdrückte fast seine Gesprächspartner mit seiner Erscheinung – wenn er es darauf anlegte, “vernichtete” er sie gar. Er war kein schöngeistiger, westeuropäischer Philosoph, sondern ein sich kraftvoll und sehr direkt ausdrückender, gleich einem Bauern in der Erde verwurzelter Russe. Mit einem Bein stand er zudem – im übertragenen Sinn – am Thron des Zaren und mit dem anderen auf dem ärmlichsten Hof eines Bauern. Zur Folge hatte dies alles, dass er zwangsläufig polarisierte, wenn er seine Überlegungen und Erkenntnisse quasi »ex kathedra« “verkündete”.
(Weiterlesen …)
Lev Tolstoj: „Der Meister aller Meister, ein allwissender Shakespeare …“
Das ist eine erstklassige Sache! Welch ein Künstler und welch ein Psycholog! Ich brach in Rufe der Begeisterung aus während der Lektüre… Ja, das ist stark, sehr stark… Der Meister aller Meister, ein allwissender Shakespeare …
[Gustave Flaubert in einem Brief an I. S. Turgenev aus dem Jahre 1880 nach der Lektüre von Krieg und Frieden]
Lev Tolstoj (auch Lew oder Leo Tolstoi) war zeit seines Lebens davon besessen, das, was er als Wahrheit erkannt hatte, auch auszusprechen; sich selbst, anderen und vor allem auch seinen Lesern wollte er nichts als die (oder besser: seine) Wahrheit sagen. Das führte einerseits zu jener schonungslosen Selbstkritik, von der seine Tagebücher geradezu strotzen, andererseits zu einer völlig unduldsamen Haltung seinen Diskussionspartnern gegenüber, die durch Tolstojs aristokratisches Bewusstsein noch verstärkt wurde. Nun war er aber auch und schon von Kindheit an ein unentwegt reflektierender, ja philosophierender Mensch; seine Wahrheiten änderten sich zwangsläufig mit seinem jeweiligen Erkenntnisstand, wodurch sich manch Widersprüchliches in seinem Werk findet – beispielsweise wird aus der Bewunderung soldatischer Tugenden (Sevastopoler Erzählungen) am Ende seines Lebens ein anarchischer Pazifismus.
« Previous Page — Next Page »