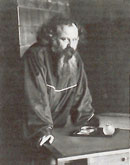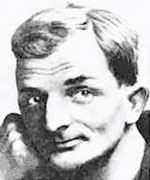Russische Schriftsteller der Emigration(en)
von wietekOhne die vielen russischen Dichter, Komponisten, Musiker und Künstler aus dem 18. und 19. Jahrhundert ist die europäische und besonders die deutsche Kultur nicht denkbar – und selbst danach, zu Beginn bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, haben die verschiedenen Emigrantenwellen ungeheuer befruchtend auf unser Geistesleben gewirkt, – wieweit das auch für die neueren Wellen gilt, wird man erst rückblickend sagen können.
In Russland waren Politik und Literatur schon immer eng miteinander verquickt; Dichter waren weit mehr als im Westen das soziale Gewissen der Nation. Schon Puschkin, der für den Beginn der russischen Literatur steht, musste leidvolle Erfahrungen hinnehmen. Es gab aber auch niemanden, der diese Aufgabe in einem absolutistischen Staat hätte erfüllen können. Ganz offensichtlich wurde dies bei den Revolutionären Majakowski, Fürst Kropotkin, Gorki (der differenzierter zu beurteilen ist) und vielen mehr. Viele Dichter gingen, auch ohne Revolutionär geworden zu sein, in die Verbannung nach Sibirien oder wurden im günstigsten Fall aus den Metropolen und damit aus der Gesellschaft verbannt.
Das heißt, Politik ist in Russland (bis heute) aus der Literatur nicht weg zu denken und wird daher auch immer wieder Thema sein.
(Weiterlesen …)
Hermann Bahr: Rastloser Prophet – Vergessener Literat
von tergast„Niemals und immer derselbe“. Dieser Versuch einer Selbstbeschreibung kann als programmatisch für Hermann Bahr gelten. 1863 ist er in Linz als Sohn des Rechtsanwalts, Notars und Landtagsabgeordneten Dr. Alois Bahr und seiner Frau Wilhelmine (Minna), geborene Weidlich, zur Welt gekommen, um diese fortan mit immer neuen Erkenntnissen zur Literatur und Kunst zu bereichern.
„Niemals und immer derselbe“, das bedeutet für Bahr, der in Wien Klassische Philologie, Philosophie, Rechtswissenschaften und Nationalökonomie studierte, nichts anderes als seine Betrachtungen und Theorien vor allem zur Literatur der Moderne ständig in neue Richtungen zu lenken und das Alte zu verwerfen, sobald es den Ruch des Etablierten anzunehmen schien. In dieser Unberechenbarkeit jedoch war er höchst berechenbar, denn genau das war sein Lebensmotto: Vordenker der Moderne sein, antizipieren, was kommt und wichtig wird, und sobald es soweit ist, das Ganze verwerfen und den nächsten Schritt wagen. (Weiterlesen …)
10. September 2007Ralf Isau: Museum der Erinnerungen
von bardolaDie Götterskulpturen im Pergamonmuseum in Berlin geben in Ralf Isaus vor zehn Jahren erschienen Roman Das Museum der gestohlenen Erinnerungen Rätsel auf: “… und so könnte ich dir noch viele Beispiele nennen. Ob es dabei um die Archäomagnetik oder irgendeine andere Methode geht. Die Wissenschaft ist niemals objektiv und schon gar nicht fehlbar gewesen – das widerspräche sogar ihrer wahren Natur. Leider haben viele Menschen sie zu einem Glaubensbekenntnis gemacht, um eigenes, sehr subjektives Handeln zu rechtfertigen. So verhält es sich auch mit Marduks Schicksalstafeln … “, heißt es gegen Ende dieses fesselnden Abenteuers, das nicht Fantasy nach angloamerikanischem Muster ist, sondern ein Versuch des Autors, mit Geschichten und Geschichte das Denken der Leser zu schärfen, flexibler zu gestalten und zudem über viele faszinierende historische Ereignisse oder philosophische Betrachtungen zu informieren. (Weiterlesen …)
3. September 2007Karl Gutzkow: bewegt, zensiert und streitbar. Ein literarisches Leben im 19. Jahrhundert
von tergastIn ärmlichen Verhältnissen, als Sohn eines Stallmeisters des Prinzen Friedrich Wilhelm Karl, wurde am 17. März 1811 in Berlin ein Mann geboren, der knapp 25 Jahre später eines der berüchtigsten Werke der Literatur des 19. Jahrhunderts schaffen sollte. So berüchtigt, dass es ihm sogar eine einmonatige Gefängnisstrafe einbrachte.
Der Roman, von der zeitgenössischen Kritik als „unsittlich und gotteslästerlich“ gebrandmarkt, hieß Wally, die Zweiflerin, sein Autor war Karl Gutzkow, der neben seiner Wally eine große Menge weiterer literarischer Werke schuf und für die jungdeutsche Literatur von nicht unerheblicher Bedeutung war.
Gutzkow etwa war es, der dafür sorgte, dass Georg Büchners Dantons Tod in der von Eduard Duller herausgegebenen Zeitschrift Phönix. Frühlings-Zeitung für Deutschland erscheinen konnte, für die Gutzkow das so genannte Literaturblatt erstellte. Büchner war zu jener Zeit durch einen intensiven Briefwechsel mit Gutzkow verbunden und empfand ihn als einen seiner ersten Förderer. (Weiterlesen …)
Joachim Ringelnatz – Frech und herzbetrunken
von bardolaMit Joachim Ringelnatz kann man nicht früh genug beginnen. Schon für Kinder ab fünf Jahren bieten seine Gedichte viel Stoff zum Nachdenken und Lachen. Manchmal sind die Texte so erfrischend für den Nachwuchs, aber so grausam zum Alter, dass die beste Lösung für peinlich berührte Erzieher und noch nicht alphabetisierte Kinder eine Hör-CD ist.
Ach schenk mir doch ein Grammofon.
Ich bin ein ungezog’nes Kind,
Weil meine Eltern Säufer sind.
Verzeih mir, dass ich gähne.
Beschütze mich in aller Not,
Mach meine Eltern noch nicht tot
Und schenk der Oma Zähne.
Esskultur
von konecny„Wir saßen auf den strohgeflochtenen Stühlen im Esszimmer eines der köstlichen alten Landhäuser in der Umgebung von Paris.“

Gleich der erste Satz von Brechts Kurzgeschichte Esskultur machte mich glücklich. Boah! Jedes Dingwort so groß wie seine Information, jedes Wort in Reih und Glied. Wie Wortsoldaten! Vom Größten zum Kleinsten: Stühle, Esszimmer, Landhaus, Umgebung von Paris. Und ich hockte in der Umgebung von München! Genau gesagt in der S-Bahn! Nach einem Jahr Flüchtlingslager hatte man mich – den Tschechen – endlich unter die Deutschen gelassen..
Die S-Bahn rüttelte etwas. Schnell legte ich meine Hand auf den Topfdeckel neben mir. Immer wenn der Deckel hoch hüpfte, entwich aus dem Gulaschtopf eine dicke Knoblauchfahne. Die Nüstern der Fahrgäste blähten sich auf, ihre Nasenflügel flatterten auf der Suche nach der Duft-Quelle. Da! Sie sogen den Knoblauchduft tief ein und erschauerten vor Wonne. Danke Dir, Gott! Die Deutschen mögen Knoblauch!
(Weiterlesen …)
Richard Huelsenbeck als Figur der literarischen Moderne – En avant DADA
von tergast„Dada war in Zürich geboren, und einer seiner Abgesandten, Huelsenbeck, brachte die Botschaft nach Berlin, wo der Kreis der Freien Straße um Franz Jung schon vorbereitet war, alle Konsequenzen einer Empörungs-Aktion zu ziehen. Jung und ich verstanden sofort die Wichtigkeit dieses Zerstörungsmittels der sogenannten ‚künstlerischen Kultur’ und beschlossen, den Club DADA als Standarte des Internationalismus zu gründen, mit Huelsenbeck an der Spitze.“
Es ist Raoul Hausmann, der mit dieser Bemerkung in dem DADA beschreibenden Text „Dada empört sich, regt sich und stirbt in Berlin“ auf die Bedeutung Richard Huelsenbecks verweist. Jener Huelsenbeck war frühes Mitglied der legendären Club Voltaire in Zürich gewesen, dem Geburtsort des Dadaismus. Dort hatte er schon kurz nach der Gründung des Clubs durch Hugo Ball und Emmy Hennings an den Soiréen teilgenommen, mit dem das Kunst-Publikum der Zeit geschockt werden sollte. (Weiterlesen …)
16. July 2007Mats Wahls Erzählkunst
von bardola1996 wurde Mats Wahl auf einen Schlag in Deutschland berühmt. Drei seiner Bücher waren in verschiedenen Kategorien für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Die Winterbucht, Stockholms breiter Wassergraben zwischen Arm und Reich, der Hauptschauplatz seines gleichnamigen Romans, wurde schließlich ausgezeichnet.
Erzählt wird die Geschichte von John-John, einem dunkelhäutigen, 16-jährigen Schweden aus einfachen und zerrütteten Verhältnissen. John-John muss an vielen Fronten emotional und handgreiflich kämpfen: Die zwei schlimmsten Schlachtfelder werden einerseits vom Freund seiner Mutter dominiert, der John-Johns Schwester vergewaltigt, und von seinem Freund Fighter, der ihn zu kleinkriminellen Handlungen verführt und später Neonazi wird. John-John flüchtet sich an die Schauspielschule und verliebt sich in ein Mädchen aus reichem Haus.
(Weiterlesen …)
Bücher für die „Blöden“
von konecny
Alles Schlechte hat seine gute Seite. Der Sozialismus zum Beispiel hat uns hemmungslos „sozial“ gemacht. Im Sozialismus musstest du eine Menge Leute kennen: Den Metzger – sonst gab’s am Abend nur grüne Wurst. Der Gemüsehändler war dein Freund, weil sogar Zwiebeln hin und wieder zu „Engprofil“-Waren zählten. Ein Kumpel in der Autowerkstatt machte sich gut, jemand bei der Polizei, diverse Handwerker musstest du kennen, den Buchhändler… ja, Wahnsinn! Was für eine super Bekanntschaft damals im Sozialismus ein Buchhändler war! Als Anfang der Achtziger zum Beispiel auf Tschechisch On the Road von Kerouac erschien! Während sich die anderen Kunden in der Schlange vor der Buchhandlung gegenseitig die Schienbeine blutig traten, hat dein Kerouac auf dich schon unter der Theke gewartet. Ohne Vetternwirtschaft lief im „real existierenden“ Sozialismus nun mal gar nichts. Nur die Schopenhauer-Jünger beschritten den Weg der Askese, lasen nicht, ernährten sich so, wie’s der Fünf-Jahres-Plan gerade erlaubte und soffen allein vor sich hin. Bier gab’s im Sozialismus genug, leider im Sommer zu warm und recht trüb – die Bierpipeline war noch vor dem Krieg gebaut worden und somit veraltet und dreckig. Trotzdem wurde der Hahn nicht zugedreht. Bier musste sein. Damit uns Übrigen das Lesen allein nicht zu öde wurde und wir selbst nicht auf blöde Gedanken kamen. An Revolutionen und so.
(Weiterlesen …)
Rudolf Borchardt – Einzelgänger, Spracherneuerer und Symbol der Zerrissenheit der literarischen Moderne
von tergast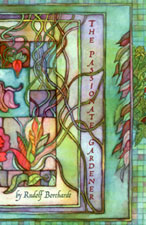
„Er war ein Mann des Privatdrucks“.
Die Sprache, das Rohmaterial der Dichter, war ihm das wichtigste, und trieb ihn sein Dichterleben lang um.
Rudolf Borchardt, 1877 geboren, mitten hinein in eine der intensivsten Epochen der deutschen Literatur, kommt heute in den Literaturgeschichten höchstens noch als Randbemerkung vor. Zu unzugänglich und abseitig erscheint sein Werk auf den ersten Blick.
Bereits der zweite Blick jedoch bemerkt eine ungeheure Vielfalt an Lyrik, Prosa, Essayistik, Übersetzungen, Reden, die in einem 68jährigen Leben (Borchardt starb 1945) kaum unterzubringen zu sein scheint. (Weiterlesen …)