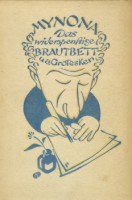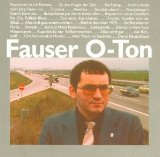Fanny Gräfin zu Reventlow, Skandalnudel und Schriftstellerin der Schwabinger Bohème
von tergastEin Blick zurück auf die letzten Kolumnen brachte dieser Tage eine Erkenntnis hervor: Hier ging es schon lange nicht mehr um eine Autorin. Diesem Zustand muss dringend Abhilfe geschaffen werden.

Fanny Gräfin zu Reventlow
Würde die Dame, um die es hier geht, heute leben, wäre sie vermutlich eine Art Skandalnudel und häufiger mal auf der Titelseite der einschlägigen Gazetten. Immer unangepasst, ihrer Zeit voraus, nie den Erwartungen ihrer Mitmenschen entsprechend. Aber mit dem festen Willen, ihren Weg zu gehen.
Das war um 1900, als sich Fanny Gräfin zu Reventlow für diese Lebensweise entschied, natürlich noch ungleich schwerer als in postmodernen „Jeder macht was er will“-Zeiten. Da konnte man noch, wie es der 1871 in Husum geborenen Fanny Liane Wilhelmine Sophie Auguste Adrienne Gräfin zu Reventlow passierte, von der Familie zur Besserung aufs Land geschickt werden. Zu einer Pastorenfamilie, damit auch alles seinen geregelten christlichen Gang gehen möge.
Dumm nur, dass die Familie nicht mit der Widerstandskraft des Mädchens rechnete, das sogleich aus dem Exil floh und bei Verwandten in Wandsbek unterkam, um von dort aus zu einer Karriere zu starten, die ihres gleichen sucht. (Weiterlesen …)
20. December 2010Entartung, Lügen und Krankheit – Max Nordau oder: Der andere Blick auf die Jahrhundertwende
von tergastWenn eines die Zeit des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts kennzeichnet, dann wohl die Gleichzeitigkeit so vieler unterschiedlicher Gedanken, Weltanschauungen und politischer wie künstlerischer Überzeugungen und Richtungen. Da konnte einer als Jude geboren werden, sich mit Leib und Seele und sogar mit einer Namensänderung davon lossagen, und schließlich doch noch zu einem der Vorkämpfer der zionistischen Bewegung an der Seite Theodor Herzls werden. Und dieser eine konnte in der Zwischenzeit ein literarisches und kritisches Werk schaffen, das – wenngleich nicht intentional – den aufkeimenden faschistischen Bewegungen in die Karten spielte. (Weiterlesen …)
31. August 2010Alles andere als ein Durchschnittstalent: der vielschichtige Literat Walter Hasenclever
von tergastAls 1912 die Einrichtung des Kleistpreises beschlossen wurde, entschied man sich bewusst gegen eine Mehrheitsentscheidung bei der Preisvergabe. Ein einzelner „Vertrauensmann“ sollte den Preisträger benennen, zur Begründung dieses Vorgehens hieß es:
7. June 2010Der Kleistpreis soll neue und ungewöhnliche Begabungen unterstützen. Mehrheiten entscheiden sich für das Durchschnittstalent, das es allen recht macht. Nur ein einzelner kann sich rücksichtslos für das Außerordentliche einsetzen.
Eine Mischung aus Kant und Chaplin
von tergastAnonymus ist ein immer wieder gerne benutztes Pseudonym, wenn der Verfasser eines Textes – aus welchem Grund auch immer – nicht erkannt werden will. Dass einer das irgendwie langweilig findet, das Wörtchen “anonym” einfach umdreht und dann als Mynona Literaturgeschichte schreibt, ist allerdings einzigartig.
(Weiterlesen …)
So genial wie maßlos – Hans Henny Jahnn, der große Außenseiter in der deutschen Literatur
von tergastVor einiger Zeit war der Dichter Oskar Loerke Gegenstand dieser Kolumne, die der Würdigung fast vergessener Autoren gewidmet ist (hier geht’s zur Kolumne über Oskar Loerke). Doch Loerke schrieb nicht nur selbst, er goutierte auch, was andere schrieben, und überreichte sogar Preise dafür. So beispielsweise im Jahr 1920, als der nicht gerade unwichtige Kleist-Preis für ein völlig unbekanntes Buch eines völlig unbekannten Schriftstellers verliehen wurde. Das Buch hieß Pastor Ephraim Magnus, der Autor Hans Henny Jahnn.
(Weiterlesen …)
Überzeugung und Tatkraft – Franz Jung
von tergastBeginnen wir mit einem Zitat:
29. September 2009Ein Autor expressionistischer Prosa, Mitbegründer von Dada Berlin. Kriegsfreiwilliger, Deserteur, linksradikaler Aktivist. Terrorist und Häftling – fünfmal im Gefängnis, einmal im KZ, einmal zum Tod verurteilt. Promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Fabrikdirektor in der Sowjetunion, Börsenkorrespondent, Unternehmer, Mäzen Brechts. Säufer; gelegentlich schwere Depressionen. Dreimal verheiratet. Lebte u.a. in Schlesien, München, Berlin, Petrograd, Wien, Genf, Budapest, Italien, San Francisco, Paris. Starb 1963 in einem Stuttgarter Krankenhausbett, 74 Jahre alt. (Weiterlesen …)
Kein Sinn im Leben außerhalb der Kunst – Wilhelm Lehmann, Großmeister der Naturlyrik
von tergast1923 erhält Robert Musil den Kleist-Preis. Doch nicht nur er, sondern noch ein weiterer Zeitgenosse wird von Alfred Döblin in diesem Jahr mit dem renommierten Preis geehrt: ein gewisser Wilhelm Lehmann, dessen Name heute selbst bei fleißigen Lesern im Gegensatz zu Musil und Döblin vor allem Achselzucken hervorrufen dürfte. (Weiterlesen …)
20. July 2009„der Poet ein Lumpensammler“ – Jörg Fauser, Wirklichkeitssucher im Rausch
von tergastDarf man in dieser Rubrik über jemanden schreiben, der gerade erst durch eine frisch abgeschlossene Werkausgabe geehrt worden ist? Ich denke, man darf, wenn es sich um einen Autor handelt, der trotz seiner überragenden Bedeutung für die deutsche Nachkriegsliteratur bis heute eher eine Sache für Eingeweihte geblieben ist und der wohl nie mit dem Bekanntheitsgrad deutscher Großschriftsteller wird konkurrieren können.
(Weiterlesen …)
Pawel Iwanowitsch Melnikow – Chronist der Altgläubigen
von wietek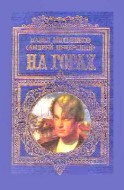
Cover von Na gorach
(dt. In den Bergen),
das nicht in deutscher
Übersetzung vorliegt
Pawel Melnikow war ganz gewiss kein Systemkritiker geschweige denn ein Revolutionär. Ganz im Gegenteil, er war ein – so würde man heute sagen – regierungstreuer, rechtsliberaler Beamter und er starb – darin sind sich alle Quellen einig – „nach einem ruhigen Lebensabend“ im Bett (und zwar am 1. jul / 13.greg Februar 1883 in Nishni Nowgorod).
Seine einzige „Unbotmäßigkeit“ bestand wohl darin, dass er während seines Studiums an einer Studentenfeier teilnahm. Er wurde deswegen nach seiner Promotion für unwürdig gehalten, einen Lehrstuhl für slawische Mundarten zu besetzen.
Aus Melnikows Leben gibt es ansonsten wenig herausragende Ereignisse zu berichten. Die wenigen, die überliefert sind, sind dazu noch – je nachdem von welch politischer Couleur die Berichterstatter waren – unterschiedlich berichtet und gewichtet worden. (Weiterlesen …)
„Eine kluge Frau hat Millionen Feinde – alle dummen Männer.“ Marie von Ebner-Eschenbach als poetische Vorbotin der Gleichberechtigung.
von tergast
Im Riesenreich des Kaisers Franz-Joseph wuchs sie nach ihrer Geburt1830 vorwiegend im mährischen Teil auf, verbrachte jedoch auch einen Teil der Kindheit im Zentrum der habsburgischen Monarchie, in Wien. Die frühen Jahre von Marie von Ebner-Eschenbach spielten sich zwischen zwei Sprachpolen ab: Französisch war die Sprache ihrer Familie, Tschechisch die von Amme, Kinderfrau und Gesinde, die für ihr Aufwachsen nicht ohne Bedeutung waren. Nachdem die Mutter kurz nach der Geburt gestorben war und Marie mit nur sieben Jahren auch die erste Stiefmutter verlor, war die Großmutter die zentrale Konstante im Leben des jungen Mädchens, das sich früh für Corneille begeisterte und infolgedessen die „größte Schriftstellerin“ werden wollte. Einer der ersten poetischen Gehversuche, eine „Ode à Napoléon“, findet vor dem 15 Jahre älteren Vetter Moritz Freiherr von Ebner-Eschenbach, der sie zufällig liest, keine Gnade. Vor allem die Anbiederung ans Französische stört in jener Zeit; er empfiehlt ihr: „Was deutsch du denkst, hab deutsch zu sagen auch den Mut!“
(Weiterlesen …)