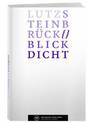Interview
Fluchtpunkte auf Song, Text und Gedicht - Lutz Steinbrück im Gespräch mit Kristoffer Cornils
Kristoffer Cornils: In deinem zweiten Band Blickdicht scheinen mir im Vergleich zu Fluchtpunkt:Perspektiven gesellschaftliche Themen wesentlich mehr in den Vordergrund zu treten. Wie würdest du das erklären?
Lutz Steinbrück: Im Gegensatz zum ersten Band gibt es kaum intime Gedichte, die sich auf Zweier-Konstellationen konzentrieren. Deshalb drängt sich dieser Eindruck wahrscheinlich auf. Gesellschaftliche Themen sind in beiden Büchern stark vertreten, weil sie mich beschäftigen und ich mich in meinen Gedichten daran abarbeite. In Blickdicht treten sie sprachlich weniger verschlüsselt, also klarer und in diesem Sinne auch gesellschaftskritischer zutage.
K. Cornils: Das würde ich auch sagen, da ich selbst nicht unbedingt konkrete Statements oder Stellungnahmen in den Gedichten sehe, sondern vielmehr den Prozess der Meinungsbildung aus dem Gegebenen heraus.
Du sprichst in einem online bei www.lauter-niemand.de veröffentlichten Text zu deinen eigenen Gedichten von inneren und äußeren Impulsen, die dein Schreiben injizieren – überwiegen die äußeren Impulse, ist so die gesellschaftskritischere Ausrichtung zu erklären?
L. Steinbrück: Innere und äußere Impulse stehen in einer Wechselbeziehung. Die Gedichte gehen von meiner Wahrnehmung aus, die von persönlichen Erfahrungen geprägt ist. Innere Impulse und Wahrnehmungen von Außenwelt ergänzen sich und fließen in die Texte ein. Im Gedicht Hereinspaziert gab es zwei Slogans, die ich als äußere Impulse aufgeschnappt und darin verwertet habe: „I hate CBS“ und „Wir haben all das für dich zerstört“. Sie sind wie Teile eines Puzzles und bringen unterschiedliche Perspektiven zum Ausdruck. In diesem Gedicht ist die Vater-Sohn-Beziehung exemplarisch für einen Generationskonflikt, in dem es um konträre Weltanschauungen, gegenseitiges Unverständnis und mangelnde Kommunikation geht. Manche Blickdicht-Gedichte halten allerdings auch eine Perspektive durch, etwa das Kolonialwarengedicht, in dem sich eine einzige Figur in einem postkolonialen Gestus äußert.
K. Cornils: Du integrierst auffällig häufig die Sprache der Medien, arbeitest also nicht nur mit Slogans, sondern viel mit Schlagwörtern. Inwiefern arbeitest du bewusst mit diesem Sprachmaterial?
L. Steinbrück: Das Schlagwortartige kommt wahrscheinlich daher, dass ich sehr von Songtexten deutschsprachiger Punk- und Indie-Bands geprägt bin. Ich bin mit Texten der Fehlfarben, Extrabreit oder Ideal aufgewachsen, in den Neunzigern habe ich die Goldenen Zitronen, die Sterne oder Tocotronic gehört. Alles Bands, die viel mit Slogans gearbeitet haben. „Es liegt ein Grauschleier in der Stadt / den meine Mutter noch nicht weggewaschen hat“ von den Fehlfarben bringt eben auch eine bestimmte Atmosphäre rüber. Das habe ich aufgesogen. Da ich mit meiner Band Nördliche Gärten selbst Musik mache und viele der Texte schreibe und singe, sind wohl auch meine Gedichte stärker von Slogans und Schlagwörtern geprägt als es bei anderen Lyrikern der Fall ist. Das passiert, ich suche nicht danach.
Was Mediensprache betrifft, fließt diese automatisch in die Texte ein. Anglizismen reizen mich dabei weniger. Trotzdem benutze ich auch mal Wörter wie „seafood“, die in der Werbung und dadurch auch alltagssprachlich häufiger verwendet werden und einen bestimmten Zeitgeist ausdrücken. Die Gefahr, dass das zu manieriert oder gewollt klingt, sehe ich nicht nur bei Anglizismen, sondern auch bei „großen“, pathetisch aufgeladenen, abgenutzten Wörtern und Begriffen wie Herz, Schmerz oder Seele. Die versuche ich in Gedichten zu meiden.
K. Cornils: Du trennst zwischen deinem Schreiben als Lyriker und dem als Songwriter.
L. Steinbrück: Naja, in einem Songtext kann sich zur Not, überspitzt gesagt, auch mal „Schwein“ auf „rein“ reimen, das wäre mir in der Lyrik peinlich. Songtexte funktionieren mit der Musik zusammen, oft pointiert und schnell auf den Punkt. Bei der Lyrik habe ich meistens den Anspruch, dass die Texte codierter, vielschichtiger sind, nicht so sehr auf Klarheit angelegt. Bands wie Blumfeld oder die Einstürzenden Neubauten haben sicher Texte, die auch ohne Musik als Gedicht funktionieren würden. Da gibt es keine klare Grenze. Ich sortiere meine Textideen ziemlich spontan nach Gedichten oder Songtexten. Bei mir zu Hause liegen zwei Zettelhaufen.
K. Cornils: Würde dir der Gedanke zusagen, deine eigene Lyrik zu vertonen?
L. Steinbrück: Ja, daran habe ich auch gedacht, aber das ist bisher nur eine Idee. Die meisten Verlage würden meine Songtexte nicht in Lyrikbänden abdrucken, während umgekehrt meine Gedichte mit Musik funktionieren würden. Ich hatte im ersten „Blickdicht“-Manuskript auch zwei Songtexte, die es aber nicht in den Band geschafft haben.
K. Cornils: In deinem Text für lauter niemand schreibst du, dass einige deiner „Blickdicht“-Texte als „zu eindeutig“ rezipiert werden könnten. Bezieht sich das auf die von dir verwendeten Slogans, Schlagwörter?
L. Steinbrück: Nein, das bezieht sich auf die wenigen Texte, die konsequent die Perspektive einer einzigen Figur einhalten. Da gibt es wenig Raum für überraschende Wendungen. Im Kolonialwarengedicht zum Beispiel heißt es am Schluss: „Es waren doch immer / Macher wie wir, die ferne Länder nahmen / und irgendwie / Geschichte schrieben // oder was willst du / mir jetzt erzählen?“ Es ist eindeutig eine zynische Haltung, die sich selbst vorführt. Bei solchen monoperspektivischen Gedichten kann ich mir vorstellen, dass viele, die sich intensiv mit Lyrik beschäftigen und/oder selbst Gedichte schreiben, wenig Erkenntnisgewinn daraus ziehen.
K. Cornils: Ist es Teil deines Ansatzes, die Sprache der Medien poetisch verwertbar machen? Begriffe wie „Fleischindustrie“, „Rendite“ oder Ähnliches sind in deinen Texten recht häufig zu finden.
L. Steinbrück: Auf alle Fälle, denn das beschäftigt mich. Wie gesellschaftliche Verhältnisse Menschen beeinflussen oder wie umgekehrt die Menschen die Gesellschaft prägen. Das erlebe ich beruflich vor allem als Journalist. Ich sehe mich nicht primär als Schriftsteller, sondern als Journalist, Lyriker und Musiker. Wahrscheinlich habe ich deshalb ein anderes Selbstbild als diejenigen Autoren, die sich vor allem als Literaten sehen und positionieren. Andere Autoren definieren sich sicher stärker über ihre Arbeit als Schriftsteller als ich. Dafür bescheren mir die Arbeit als Journalismus und Musiker andere Erfahrungen und Horizonte. Das kann ein Nachteil sein, weil ich in keinem Bereich hundert Prozent geben kann. Andererseits sehe ich den Vorteil, mehr Distanz zu den einzelnen Bereichen, auch zum jeweiligen Erfolg und zum Scheitern zu haben, weil ich nicht so stark die Notwendigkeit und den Drang spüre, mich im jeweiligen Betrieb als erfolgreichen „Markennamen“ positionieren zu müssen.
K. Cornils: Hat es denn eher Vor- oder Nachteile, „Vollblutliterat“ zu sein?
L. Steinbrück: Ich denke, beides trifft zu. Wer seine Identität primär darüber definiert und Literatur als Beruf betrachtet, denkt vermutlich vorsichtiger in Bezug darauf, wie er sich in der Öffentlichkeit verhält, denkt mehr in Betriebskategorien, was die Außendarstellung betrifft. Darauf bin ich nicht so fixiert, weil ich vom Journalismus lebe und nicht von der Musik oder der Lyrik. Wäre ich primär Literat, würde ich mich sicher stärker über meinen Stellenwert im Literaturbetrieb, auch in Form von Preisen und Stipendien definieren.