[Christa Wolf, Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud] My white male bookshelf #6
Vor einer Weile habe ich alle Bücher männlicher Autoren in meinem Bücherregal umgedreht. Man sah statt bunter Buchrücken fast nur noch die Seiten. Mein Regal war weiß geworden. Seit dem lese ich nur noch weibliche Autorinnen.
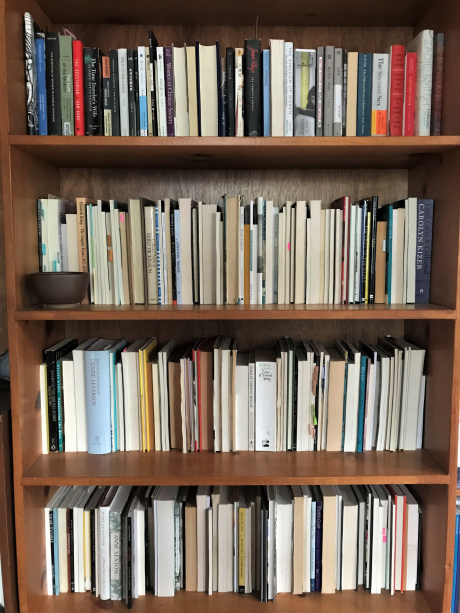 My white male bookshelf steht bei Eleanor Goodman, amerikanische Lyrikerin und Übersetzerin aus dem Chinesischen
My white male bookshelf steht bei Eleanor Goodman, amerikanische Lyrikerin und Übersetzerin aus dem Chinesischen
»So würde es jedesmal sein, so ist es jedesmal gewesen, wenn wir den langen Weg zu diesem entlegenen Lokal auf uns nehmen würden, auf uns genommen hatten.« (S. 50)
So beschreibt Christa Wolf einen Besuch in einem Chinarestaurant in Los Angeles. Beziehungsweise, das schreibt nicht Christa Wolf, sondern die namenlose Erzählerin aus ihrem letzten Roman Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud, der 2010 bei Suhrkamp erschienen ist.
Die Erzählerin ist nicht die Schriftstellerin, alles ist ausgedacht, so steht es in der Vorbemerkung. Trotzdem deckt sich vieles mit der Biographie Christa Wolfs – soweit ich das nachvollziehen kann. Denn absurderweise lese ich Christa Wolf zum ersten Mal: Sei es, weil ich in Westdeutschland aufgewachsen bin, sei es, weil ich nicht Germanistik, sondern Allgemeine Literaturwissenschaft studiert habe, sei es aus Zufall. Insofern ist Christa Wolf eine Neuentdeckung für mich und zufälligerweise ist es gerade ihr letzter Roman, den ich im Buchladen gekauft habe. Einfach, weil der Titel mich von allen ihren Büchern am meisten angesprochen hat. Trotzdem: Viel Recherche braucht es nicht, um herauszufinden, dass es hier um Wolfs Biografie geht. Auch der Text selbst strahlt das aus.
Ob Christa Wolf nun tatsächlich im Chinarestaurant gewesen ist, kann mit Bestimmtheit natürlich nicht gesagt werden. Aber deswegen habe ich die Stelle auch nicht ausgewählt. Was ich interessant finde, ist dieses »würde«: »So würde es jedesmal sein«. So – mit diesem Konjunktiv, mit diesem jedesmal – beschreibt man die Entstehung privater Mythen. Die Zeit, in der man immer ins Chinarestaurant gegangen ist, es mehr oder weniger immer gleich war, also immer gleich schön. Immer in der Vagheit des Konjunktivs, weil die Zukunft immer etwas Irreales hat. Man weiß schließlich nicht, ob sie wirklich so stattfinden wird, wie man sie sich vorstellt – auch, wenn die Zeit sich wiederholt.
Und das wiederholt Wolf, bzw. ihre Erzählerin. Dann allerdings nicht im Konjunktiv, sondern im Indikativ:
»So würde es jedesmal sein, so ist es jedesmal gewesen, wenn wir den langen Weg zu diesem entlegenen Lokal auf uns nehmen würden, auf uns genommen hatten.« (S. 50)
Was im weichen Konjunktiv einer vagen Zukunft erzählt wird, wird noch einmal im harten Indikativ festgestellt – so ist es gewesen. Der Konjunktiv wird mit dem Band des Indikativs festgezurrt – so ist es jedesmal gewesen.
Genau darum geht es in Wolfs Roman. Die Erzählerin erzählt aus einer Jetztzeit und versucht dabei aus einer vagen Erinnerung einen klaren Text zu machen. Das macht sie schon auf der ersten Seite deutlich:
»Aus allen Himmeln stürzen […] Ich weiß noch, daß ich mir vornahm, diesen Satz später zu benützen, wenn ich über die Landung und über den Aufenthalt an der Fremden Küste, der vor mir lag, schreiben würde: Jetzt.« (S. 9)
Die Erzählerin fliegt mit ihrem gültigen DDR-Pass nach Los Angeles, die DDR ist zu diesem Zeitpunkt allerdings schon nicht mehr gültig. Das ist die Grundkonstellation. In der Jetztzeit erinnert sie sich, bringt die vage Erinnerung in eine klare Vergangenheitsform.
Der Roman hat haarsträubende Plot-points und erzählt irrsinnige Geschichten. Trotzdem verzichtet Wolf darauf, Spannung zu erzeugen. Und auch das ist ein Spiel mit der Form des Romans: Denn was Roman genannt wird, verheißt ja vor allem Unterhaltung nach allen Regeln der Erzählkunst – und genau diesen verweigert sich Wolf.
Stattdessen konzentriert sie sich in der Geschichte ganz auf das Erinnern: Die Erzählerin versucht, sich im Jetzt daran zu erinnern, wie sie zwanzig Jahre vorher in Los Angeles versucht hat, sich an Ereignisse zu erinnern, die wiederum dreißig Jahre zurückliegen.
Und in diesem Bogen der doppelten Erinnerung, der ein ganzes Leben umfasst, ist der Overcoat of Dr. Freud Begleiter und Fetisch zugleich: Die Erzählerin befindet sich zu einem Rechercheaufenthalt im Getty-Center unter einer Gruppe von Stipendiat*innen. Einer von ihnen, Bob, erzählt die Geschichte, »wie er Freuds Mantel gewann und wieder verlor«. (S. 225)
Bob bekommt den Mantel durch Zufall, hängt ihn innen an seine Bürotür und verreist. Als er wiederkommt, ist der Mantel weg. Er fragt sich, ob er die Tür nicht richtig abgeschlossen hat, ob das Absicht war und wer den Mantel jetzt hat. Es geht also um Zufall, Vergessen, Verdrängen, Erinnern und die Frage, was man bereuen soll. Genau wie in der Geschichte von Christa Wolfs Erzählerin: Sie hat an den Aufbau des sozialistischen Staats geglaubt, bis zum Ende. Und nach dem Ende hat sie ihr eigenes Leben in den Stasiakten wiedergefunden. Vergewaltigt durch die Sprache der Geheimpolizei, die die eigenen Erinnerungen in ihr sprachliches System zwingt.
Und dann, während die Erzählerin in Los Angeles arbeitet, wird ihre wenige Dokumente umfassende »Täterakte« geöffnet und in der Presse rezipiert. Sie war laut Aktenlage IM, und versucht nun zu rekonstruieren, wie sie das eigentlich geworden ist, ob es eine Schuldigkeit gibt und wenn ja, wie sie gelagert ist.
Sie kann sich kaum erinnern, sammelt Verschwundenes – das Innenfutter von Dr. Freuds Mantel. Und das in Los Angeles, wo sie von Holocaust-Überlebenden und ihren Kindern zu den rassistischen Pogromen in Deutschland befragt wird (es ist Anfang der 90er) und wo communist Reiz- und Tabuwort zugleich ist.
Verschwunden ist nicht nur der Mantel, sondern auch die Weltsicht der Erzählerin: Eine Person, die mit meterweise Opferakten bei der Stasi geführt wurde und die trotzdem an dem Glauben an eine sozialistische Welt festgehalten hat. Das ist nicht heroisch, sondern tragisch. Geschrieben in der scheinbar ideologiefreien Zeit der 00er Jahre, die eigentlich durchdrungen von liberaler kapitalistischer Ideologie war, die zumindest mir damals völlig selbstverständlich erschien. Christ Wolf nicht.
Und das macht den Reiz ihrer Prosa aus: Die etwas umständliche Präzision, in der sie ihren kalifornischen Alltag beschreibt. Vieles von dem, was sie beschreibt, ist heute durch die zahlreichen amerikanischen Serien bekannt – und war es vielleicht schon in der damaligen BRD. Im Roman wird das nicht mit lässigem Kosmopolitismus gesehen, sondern mit Neugierde und Skepsis zugleich. Die abendliche Star Trek-Folge schwankt zwischen guilty pleasure und ernstzunehmender Machtreflexion:
»Ich aß, machte es mir dann in dem tiefen Sessel vor dem Fernseher bequem, den Wein in Reichweite, wie üblich lief ›Star Trek‹ auf Kanal 13, schamlos entzückt folgte ich dem Kapitän Picard und seiner Mannschaft, hingegeben den Weltall-Abenteuern des Sternenschiffs Enterprise, wobei die Picard-Mannschaft vorführte, daß unbedingte Disziplin sehr wohl zusammengehen konnte mit einer durch männliches Understatement veredelten reifen Menschlichkeit.« (S. 80)
Hier merkt man schon, Stadt der Engel ist keine Hochspannung. Aber einem wird auf den 600 Seiten nicht nur klar, wie schnell man selbst vergisst, sondern wie kurzlebig das kulturelle Gedächtnis ist. Insofern ist Stadt der Engel auch eine Chronik der jüngsten Vergangenheit.
Am Ende versucht Bob, der ehemalige Besitzer von Dr. Freuds Overcoat, sich damit zu trösten, »daß der Mantel durch eine Kette unglaubhafter Zufälle an einen der homeless people geraten sei«. (S. 225). Und auch die Erzählerin wird durch einen Zufall getröstet, zu dem auch ihr kein anderes Wort einfällt als »unglaubhaft«.
Unglaubhaft ist diese Geschichte allemal. Auf Englisch würde man vielleicht sagen: Stranger than fiction. Und genau darum geht es in Christa Wolfs Roman: Die Grauzone zwischen Erinnerung und Gegenwart, zwischen Realität und Fiktion, zwischen Deutsch und Englisch.
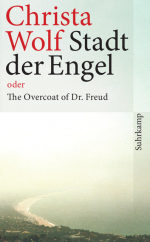 Christa Wolf
Christa Wolf
Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud
Erschienen: 19.09.2011
suhrkamp taschenbuch 4275
414 Seiten / 12,00 €
ISBN: 978-3-518-46718-3
Fixpoetry 2018
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.







Neuen Kommentar schreiben