#textediebleibensollten [Zuckmayer]
Carl Zuckmayer ist vor allem für seine Theaterstücke bekannt. Mit dem „Fröhlichen Weinberg“ gelang ihm 1925, 28-jährig, ein Sensationserfolg, an den er nahtlos anzuknüpfen vermochte. „Der Hauptmann von Köpenick“ (1931) und „Des Teufels General“ (1945), über seinen Freund Ernst Udet, das Erste-Weltkriegs-„Flieger-Ass“, gehören zu den meistgespielten Stücken auf deutschsprachigen Bühnen sowie zum festen Unterrichtsstoff von der Mittelstufe aufwärts.
Weit weniger bekannt als sein dramatisches Werk sind die Romane und Erzählungen, die Zuckmayer geschrieben hat. Und nicht zuletzt seine großartige Autobiographie mit dem schönen, vieldeutigen und zugleich treffenden Titel „Als wär’s ein Stück von mir“, angelehnt an eine Gedichtzeile aus „Der gute Kamerad“ von Ludwig Uhland, erschienen 1966 im S. Fischer Verlag. Das Buch stand sage und schreibe 37 Wochen an der Spitze der Spiegel-Beststellerliste.
Vielleicht liegt es am kommerziellen Erfolg, dass Zuckmayer heute allenfalls am Rande zur Riege der großen deutschen Autoren des vergangenen Jahrhunderts gerechnet wird. Womöglich aber auch an der verbreiteten Fehlwahrnehmung, es handle sich bei ihm um eine Art „Volksschriftsteller“ – der „Fröhliche Weinberg“ ist durchgehend in pfälzischer Mundart verfasst –, der bestenfalls „Unterhaltungsliteratur“ verfasst habe. Ein Schicksal, das er dann mit Oskar Maria Graf teilte, der sogar im New Yorker Exil noch als bayerischer Heimatdichter galt. Wobei man hinzufügen muss, dass Graf dieses Image selbst kultiviert hat.
Dabei zählt „Als wär’s ein Stück von mir“ zu den herausragenden autobiographischen Werken in deutscher Sprache. Zwei Aspekte sind es, die das Buch auch heute noch so ungemein lesenswert machen – und Zuckmayer zu einem der großen literarischen Zeitchronisten des 20. Jahrhunderts. Zum einen, die einzigartige Beschreibung seiner Flucht aus dem von Nazis besetzten Österreich 1938, per Zug in die Schweiz; zum anderen seine Wahrnehmung des Ersten Weltkrieges als junger Mann und – später dann – hochdekorierter Soldat. Es gibt nicht viele Autoren, die die Erfahrung des Krieges und der heraufziehenden Katastrophe eindringlicher und zugleich unaufgeregter beschrieben haben, als der 1896 in Rheinhessen geborene, 1977 im Kanton Wallis als Schweizer Staatsbürger verstorbene Zuckmayer.
Als Zuckmayer 1938 Hals über Kopf aus Österreich fliehen musste, waren seine Werke in Deutschland längst als „nicht mit der nationalsozialistischen Weltanschauung übereinstimmend“ verboten. Der Zug, der ihn in die Schweiz bringen sollte, wurde am Grenzübergang Feldkirch „im grellen Kegel der Schweinwerfer“ angehalten. Kurz zuvor hatten Mitreisende, angesichts der bevorstehenden Kontrollen von Panik erfasst, ihre Wertgegenstände und Bargeld, was sie für das künftige Leben im Exil zu retten beabsichtigt hatten, aus den Zugfenstern auf die vorbeiziehenden Vorarlberger Wiesen geworfen. Am Ende war es das nackte Leben, das es zu retten galt.
Am Bahnsteig wurde dann tatsächlich „jedes Paar Strümpfe aufgerollt, die Leisten aus den Stiefeln gezogen, jedes gefaltete Hemd auseinandergeschüttelt, jedes Schmink- und Pudertäschchen geöffnet.“ Jeder einzelne Passagier wurde „körperlich visitiert“. Wen man davonkommen ließ, bei dem sollte sichergestellt sein, dass er nicht mehr als die pure Existenz mit sich führte.
Als der „berüchtigte Zuckmayer“, so die Ansprache des kontrollierenden SA-Mannes, vom Perron in eine separat gelegene Baracke (ab)geführt wurde, dachte er, seine letzte Stunde habe geschlagen. Dass es nicht so kam, verdankte er seiner Schlagfertigkeit, die ihm als „deutsche Aufrichtigkeit“ ausgelegte wurde („Ich kann nicht Parteigenosse sein, weil meine Werke in Deutschland verboten sind“). Sowie dem Eisernen Kreuz Erster Klasse, das er sich, neben einigen anderen Tapferkeitsmedaillen aus dem Ersten Weltkrieg, vor der Abreise ans Revers gesteckt hatte („Dann sind Sie ja ein Held, sagte er der SA-Mann […]. Wir von der jüngeren Generation, die nicht mehr das Glück hatten, am Krieg teilzunehmen, wissen, was wir unseren Helden schuldig sind“). Mit Ehrengeleit von SS und SA ließ man den peinlich berührten Zuckmayer passieren. Seine plötzliche Privilegierung nutzend, gelang es ihm noch, eine Bekannte seiner Frau, eine Jüdin, und ihren Mann, die er im Zug getroffen hatte, aus den Händen der Nazi-Schergen zu befreien („Ich kenne diesen Herrn, er ist politisch einwandfrei“). Das war freilich ein Einzelfall und daher nur bedingt Anlass zur Freude. Für viele andere, die im selben Zug wie Zuckmayer gesessen hatten, endete die Reise in dieser Nacht an der Schweizer Grenze. Ihr weiteres Schicksal lässt sich allenfalls erahnen.
Wie viele seiner exilierten Kollegen verbrachte Zuckmayer die Jahre des Zweiten Weltkrieges in den USA. Ein Engagement als Drehbuchschreiber in Hollywood gab er trotz bequemer Stellung und einträglichem Salär schnell wieder auf. Die Oberflächlichkeit der Menschen an der US-Westküste war ihm ein Graus. Stattdessen zog er sich ins ländliche Vermont zurück, wo er mit seiner Frau eine kleine Farm betrieb und lediglich in den Abendstunden ein wenig an seinen Stücken und Texten feilte. Womöglich ist es auch dieser selbstgewählten Zurückgezogenheit geschuldet, eine Art Exil im Exil, dass Zuckmayer in den Darstellungen zur Geschichte des deutschen Exils nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Der eindrucksvollste Teil seiner Autobiographie ist jedoch die Beschreibung des Ersten Weltkrieges. Zuckmayer selbst war sich der Bedeutung der Jahre 1914 bis 1918 für seine innere Entwicklung offenkundig bewusst, nicht umsonst ist das entsprechende Kapitel mit „Als wär’s ein Stück von mir“ überschrieben – und damit titelgebend für die gesamte Lebensgeschichte.
Das Besondere ist, dass Zuckmayer über den Krieg schreibt, ohne auf die eigentlichen Kriegshandlungen, die er immerhin knapp vier Jahre als Offizier an vorderster Front miterlebt hatte, einzugehen. Damit unterscheidet er sich grundlegend von anderen Chronisten des Krieges, wie Ernst Jünger, Erich Maria Remarque oder Ludwig Renn. Den Krieg selbst zu thematisieren, sei ihm, so erfährt man, sein Leben lang unmöglich geblieben; weder konnte er darüber schreiben, noch davon sprechen. Wenn er später mit Frontsoldaten zusammensaß, habe er stets ein Grundverständnis über das gemeinsam Erlebte verspürt; gepaart mit der stillschweigenden Übereinkunft, nicht näher darauf einzugehen. Wer dabei war, der wusste, was der andere gesehen hatte; wer nicht, dem wäre es ohnehin nicht zu vermitteln gewesen. „Als wär’s ein Stück von mir“, auch so darf man die Kapitel- und Buchüberschrift lesen.
Das „Augusterlebnis 1914“ war für Zuckmayer „eine Pracht und zugleich ein Jammer“. Kein Kriegstaumel, keine Massenhysterie, wie dies nachträglich gerne behauptet wurde – und zum Zeitpunkt der Niederschrift von Zuckmayers Autobiographie noch verbreitete Forschungsmeinung war –, sondern ein disziplinierter, besonnener, ernster Vorgang. Eine hoffnungsvolle, leistungsstarke Generation, eine „Pracht an gesunden Leibern“, sei ohne Euphorie, gleichwohl in der Überzeugung, das Richtige und Notwendige zu tun, ins Feld gezogen; und die wenigsten, die 1914 bereits dabei waren, kehrten zurück. Das freilich war den Menschen, deren Erinnerung am kurzen deutsch-französischen Krieg 1870/71 haftete, nicht gegenwärtig. Weswegen es für den noch nicht ganz 18-jährigen Zuckmayer keine große Überredungskunst bedurfte, von den Eltern die Erlaubnis zur freiwilligen Meldung einzuholen.
Erste Zweifel am „Schönen, Wahren und Guten“ des Krieges ließen nur wenige Wochen auf sich warten. Sie setzten ein mit der Behandlung der Elsässer und steigerten sich in den folgenden Frontmonaten ins Unermessliche. Als lebenslange Bereicherung empfand Zuckmayer hingegen die im Felde erfahrene Kameradschaft des „gemeinen Mannes“, weswegen er es – rückblickend freilich – als „einen der Glücksfälle seines Lebens“ bezeichnete, nicht in gehobener Stellung, sondern als einfacher Frontsoldat in den Krieg gezogen zu sein. „Es hat mir […] viel später, als es in Amerika noch einmal galt, von unten anzufangen, unendlich viel genutzt.“
Und letztlich war es auch der Krieg, der Zuckmayer an das eigene literarische Schaffen heranführte, inspiriert von der von Franz Pfemfert herausgegebenen linkspazifistischen Zeitschrift „Aktion“, die, kein Scherz, Woche für Woche per Feldpost an die Front geliefert wurde. Mit einem Gedicht, in dem er zur Überwindung aller Krieg aufrief, reüssierte der mittlerweile zum Leutnant beförderten Zuckmayer 1917 als „gedruckter Autor“ – und war fortan fester Mitarbeiter der „Aktion“, was, wie er einräumte, einerseits zu einer etwas „merkwürdigen Doppelexistenz“ führte, andererseits den Beginn seiner publizistischen und schriftstellerischen Arbeit markierte. Auch derlei Widersprüchlichkeiten gehörten zur Wirklichkeit des Krieges – und zu den prägenden Weichenstellungen in Zuckmayers Leben.
Seiner Prämisse von der grundsätzlichen Nichtdarstellbarkeit des Krieges blieb Zuckmayer sein Leben lang treu. Die Erfahrungen des Krieges und der aufziehenden Katastrophe des Nationalsozialismus hatten sich ihm tief eingebrannt; sie waren ein untrennbarer, allgegenwärtiger Teil seiner selbst und seines literarischen Schaffens geworden. Womöglich erfährt man gerade deswegen bei ihm mehr über den Krieg und seine Auswirkungen auf die Menschen, als bei vielen seiner schreibenden Zeitgenossen, die sich, oft vergeblich, darum bemühten, das Unsagbare in Worte zu fassen.
*
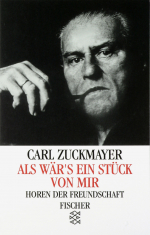 Carl Zuckmayer
Carl Zuckmayer
Als wär's ein Stück von mir
Horen der Freundschaft
FISCHER Taschenbuch;
Auflage: Ungekürzte Ausg.
(28. Oktober 1988)
10,95 Euro
978-3596210497
Fixpoetry 2019
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.







Neuen Kommentar schreiben