„…wichtig, müde zu sein“
Die Bezeichnung "Roman" auf dem Cover trügt wieder einmal: Es handelt sich bei Lukas Meschiks "Die Räume des Valentin Kemp", ganz genau der Definition einer Novelle gemäß, um den Bericht einer außergewöhnlichen Begebenheit, der sich nicht mit Nebenhandlungen aufhält. Auch inhaltlich – es geht (a) um eine Sorte Weltflucht, die (b) ein fantastisches Element aufweist, und (c) die "romantische" Selbstreferenzialität des Geschriebenen spielt eine Rolle – verweist das Buch mehrfach auf die romantische Novellentradition. Einzig die Seitenanzahl ist hier romanhaft.
Was wir lesen, ist jedenfalls ein Ausschnitt aus der Biographie des Protagonisten, ungefähr sein halbes Leben, das sich um eine Zeitschleife, eine Variante des Großvaterparadoxons, anordnet.
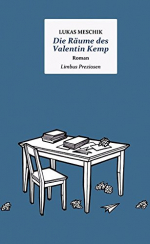 Das einzelne Element der ganzen Anordnung, das dabei (diesen Rezensenten) am meisten zu überzeugen vermag, ist der Umstand, dass der eigentliche Loop – das technische, philosophische, selbst das ganz praktische "wie" jener Zeitreise oder jenes Zeit-Möbiusbandes – komplett in den Hintergrund tritt. Also: Nicht so sehr, dass der Loop in den Hintergrund tritt – das gehört zu den Erfordernissen gerade dieser Erzählhandlung – sondern wie friktionsfrei und vollständig Meschik ihn unter den Teppich kehrt, ohne dass die Geschichte seiner Funktionalität entbehren muss. Denn zu dem, worum es in "Die Räume des Valentin Kemp" geht, verhält sich jenes fantastische Element mehr wie eine zufällige Zutat. Wir haben es mit der – über das Paradoxon vermittelten – Selbstbespiegelung eines sich unangenehm wichtig nehmenden "Geistesmenschen" zu tun, und dem aus dieser Selbstbespiegelung resultierenden Rückzug aus der "normalen", "bürgerlichen" Biographie, den am Ende als Scheitern-am- oder Sieg-über-das-Leben zu deuten uns frei steht.
Das einzelne Element der ganzen Anordnung, das dabei (diesen Rezensenten) am meisten zu überzeugen vermag, ist der Umstand, dass der eigentliche Loop – das technische, philosophische, selbst das ganz praktische "wie" jener Zeitreise oder jenes Zeit-Möbiusbandes – komplett in den Hintergrund tritt. Also: Nicht so sehr, dass der Loop in den Hintergrund tritt – das gehört zu den Erfordernissen gerade dieser Erzählhandlung – sondern wie friktionsfrei und vollständig Meschik ihn unter den Teppich kehrt, ohne dass die Geschichte seiner Funktionalität entbehren muss. Denn zu dem, worum es in "Die Räume des Valentin Kemp" geht, verhält sich jenes fantastische Element mehr wie eine zufällige Zutat. Wir haben es mit der – über das Paradoxon vermittelten – Selbstbespiegelung eines sich unangenehm wichtig nehmenden "Geistesmenschen" zu tun, und dem aus dieser Selbstbespiegelung resultierenden Rückzug aus der "normalen", "bürgerlichen" Biographie, den am Ende als Scheitern-am- oder Sieg-über-das-Leben zu deuten uns frei steht.
Bei alledem sind der Aufbau, der Plot, die thematischen Verschraubungen und Referenzen fein justiert und, sagen wir, gut geölt: Die titelgebenden (und nur zum Teil handgreiflichen, zum Teil dann auch bloß metaphorischen) "Räume" bilden ein Labyrinth, das sich des Protagonisten bedient, um sich selbst zu setzen; entsprechend dürfen wir in ihm, "Kemp", je nach unserem Standort innerhalb des Loops, entweder Theseus, Midas oder den Minotaurus erblicken (und dann wieder fragen, was uns das bedeutet, dass dieser Minotaurus nicht und nicht erschlagen wird) … Die ganze gut geölte Maschine ist nun ihrerseits zu bestaunen als Vehikel der Behauptung bzw. Wiederbelebung eines bestimmten, s. o., im epochenbezeichnenden Sinn romantischen Begriffs davon, was Literatur, was ein Autor, was ein Text wäre bzw. zu sein habe (in dieser Reihenfolge: eine kontemplative Betätigung auf ein "Eigentliches" hin, eine Art moderner Mystiker und das zufällige Nebenprodukt von dessen, äh, Vereigentlichung)… Und hier wird's dann haarig:
Denn das Fleisch auf den Knochen dieses Aufbaus, die ganz konkrete Person Kemp mit ihrem konkreten Leben in einer sozialen Wirklichkeit, die wir als Wien, ca. 2017 wiedererkennen – sie hat uns nichts, oder wenig, zu sagen. Was an Kemps Leben, soweit wir es gezeigt bekommen, partikular, interessant oder auch nur greifbar sein könnte – die Natur der Beziehung zur Geliebten, wie sie durch das Buch hin für das ganze umfangreiche "Andere" namens "Normalität" einstehen muss; der familiäre Hintergrund des Protagonisten; der Inhalt der Bücher, die er schreibt, oder zumindest die Art ihrer Publikumsresonanz – es bleibt alles farblos und generisch.
Das mag Absicht sein, um unsere Aufmerksamkeit auf die erwähnte "Maschine" zu lenken, aber es sabotiert tendenziell den Gehalt, um dessentwillen Meschik diese Maschine überhaupt vor uns hinstellt: Eine Geschichte intellektueller Weltflucht bräuchte erstens so etwas wie einen spezifischen, nicht bloß allgemein behaupteten Gehalt der intellektuellen Betätigung des Protagonisten, und zweitens, nicht minder bedeutsam, eine zu fliehende Welt, die nicht bloß aus ein paar unvermittelten Einzelfiguren besteht. Die nächstliegende Leseweise, um mit diesem Missverhältnis zwischen Anlage und Konkretisierung umzugehen, ist, in Kemp schlicht einen unsympathischen, grundlos arroganten Protagonisten mit geringem realen Erfahrungs- und Empfindungsreichtum zu sehen – eine unreflektierte österreichische Spießerversion der Erzählerfigur in den Strauß' "Sieben Nächten" – der durch das erfahrene Paradoxon in seinen unerfreulichen Eigenschaften noch bestärkt wird. Mit einer gewissen Schadenfreude dürfen wir uns ausmalen, wie es nach Ende des fünften "Raums" mit diesem Kemp weitergeht.
Fixpoetry 2018
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.









Neuen Kommentar schreiben