SPUK!
Im Sommer 2018 fragte die New York Times dreizehn namhafte Autoren, welches Buch für sie „most frightening“ sei. Shirley Jacksons Klassiker „Spuk in Hill House“ von 1959 wurde dabei gleich dreimal genannt – von Neil Gaiman, Dan Simmons und Carmen Maria Machado. „Ich las es neben meiner schlafenden Frau, konnte mich nicht bewegen, nicht ins Bett gehen, konnte nichts tun außer weiter zu lesen und zu beten, dass sich die Schatten um mich herum nicht bewegen würden“, sagte Machado. Und auch Peter Straub, Donna Tartt und Joyce Carol Oates sind ausgemachte Fans von Shirley Jackson. In seinem Sachbuch „Danse Macabre“ über Horror in Literatur und Film schrieb Stephen King 1981, „Hill House“ und Henry James' „Turn of the Screw“ seien „die einzigen wirklich großen unheimlichen Romane der letzten hundert Jahre“.
Dass Jacksons „Spuk in Hill House“ und ihr letzter Roman „Wir haben schon immer im Schloss gelebt“ nun sechzig Jahre nach der Erstveröffentlichung in neuer deutscher Übersetzung durch Eva Brunner vorliegen, ist ein großes Glück. Ein Glück, das zweifellos auch dem Hype um die nur lose auf dem Buch basierende Netflix-Serie zu verdanken ist (der bereits dritten Verfilmung des Stoffs nach 1963 und 1999). In einem Essay zur Neuauflage von „Danse Macabre“ ging King 2010 intensiv auf die Frage ein, weshalb es den meisten modernen Horrorfilmen (und wohl auch -büchern) trotz immer heftigerer Schockeffekte nicht gelingt, uns zu ängstigen: Weil Effekthascherei nicht gruselig ist. Im Gegenteil, sie ist sterbenslangweilig. Es ist nicht ganz ohne Ironie, dass die jüngste Neuverfilmung von Kings eigenem (brillanten!) Roman „Es“ in genau diese Kerbe schlägt. Wenn gefühlt im Fünfminutentakt der Gruselclown aus der Ecke springt, sorgt das, was als „jump scare“ gedacht ist, allenfalls noch für ein genervtes Augenrollen beim Zuschauer.
Shirley Jackson brauchte all das nicht, um ihr Spukhaus zum Grausigsten zu machen, das je durch die Literatur geisterte – und dabei bleibt es am Ende dem Leser überlassen, zu entscheiden, ob da wirklich etwas durch die finsteren Räume wandelt, oder nicht. Sich dessen nie ganz sicher zu sein und stets an der dünnen, verletzlichen Haut der Realität entlangzugleiten ist es, was den Horror ausmacht. Schon der erste Satz bringt das auf den Punkt: „Kein lebender Organismus wird lange gedeihen, wenn er sich immer nur in der reinen Wirklichkeit aufhalten muss.“
Aber was ist das schon – die Wirklichkeit? Als Protagonistin Eleanor sich auf den Weg ins Hill House macht, tut sie das gar nicht in erster Linie, weil der Anthropologe Dr. Montague sie und zwei weitere Personen darum gebeten hat, da er ergründen will, was es mit dem Haus und den vermeintlich paranormalen Phänomenen auf sich hat. Nein, für Eleanor ist es vor allem eine Flucht aus der Enge ihres unerträglich gewordenen Lebens, weg von ihren verhassten Verwandten, weg von dem Ort, an dem nur drei Monate zuvor ihre Mutter gestorben ist. Sie sehnt sich danach, etwas anderes, etwas Wirkliches zu erleben. Doch ihre Unsicherheiten, ihre Labilität, ihre Ich-Fixiertheit und ihr Hang, sich in Traumwelten zu flüchten, machen sie anfällig für das, was sich im Hill House abspielt. Für die unheimlichen Geschichten, die sich um das schiefe Gemäuer ranken, in dem es seit dem Selbstmord der letzten Besitzerin niemand länger als zwei Tage ausgehalten haben soll.
Ist diese eiskalte Stelle vor dem Kinderzimmer wirklich das Zentrum eines Hauses, das irgendwie lebendig ist? Oder gibt es, wie Dr. Montague beharrt, vielleicht eine ganz banale Erklärung? Wie auch für das, was nachts über den Flur streift und gegen die Türen hämmert? Während die anderen das herauszufinden versuchen, zieht sich Eleanor zunehmend in sich selbst zurück, wird vereinnahmt von diesem Haus, das sie zu rufen scheint – mit der Stimme ihrer toten Mutter, an deren Ende Eleanor, das sagt sie sich zumindest, nicht ganz unschuldig ist.
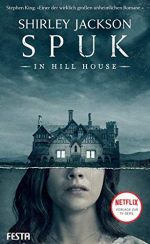 Im „Hill House“ spielt sich der Horror im Kopf ab – es ist derselbe Horror, der Kinder ängstigt, die nachts das Licht anlassen, damit sich nichts in den Schatten verstecken kann. Dabei ist das, was Shirley Jackson erzählt, nie eindeutig, immer bleibt das, was geschieht oder nicht geschieht, im Zwielicht; sobald man versucht, sich irgendwo festzuhalten, rutscht man gemeinsam mit der Hauptfigur ab. Ein alptraumhaftes Buch, das man auf unterschiedliche Weisen lesen kann, das sich keineswegs auf Anhieb erschließt und eben daraus seinen Grusel zieht – einen Grusel, der nicht vergeht, sobald man das Buch zuschlägt und das Licht einschaltet, sondern ein Grusel, der einen verfolgt, sobald man gerade glaubt, nicht mehr dran zu denken.
Im „Hill House“ spielt sich der Horror im Kopf ab – es ist derselbe Horror, der Kinder ängstigt, die nachts das Licht anlassen, damit sich nichts in den Schatten verstecken kann. Dabei ist das, was Shirley Jackson erzählt, nie eindeutig, immer bleibt das, was geschieht oder nicht geschieht, im Zwielicht; sobald man versucht, sich irgendwo festzuhalten, rutscht man gemeinsam mit der Hauptfigur ab. Ein alptraumhaftes Buch, das man auf unterschiedliche Weisen lesen kann, das sich keineswegs auf Anhieb erschließt und eben daraus seinen Grusel zieht – einen Grusel, der nicht vergeht, sobald man das Buch zuschlägt und das Licht einschaltet, sondern ein Grusel, der einen verfolgt, sobald man gerade glaubt, nicht mehr dran zu denken.
„Wir haben schon immer im Schloss gelebt“ (1962) dreht das klassische Haunted-House-Motiv um. Hier ist es das Anwesen der Blackwoods, in dem vor Jahren ein schrecklicher Mord geschah: fast die ganze Familie wurde beim Abendessen mit Arsen vergiftet und starb jämmerlich. Nicht vom Gift gekostet hatten lediglich die Schwestern Constance und Merricat, und der alte Julien Blackwood hat überlebt, ist aber an den Rollstuhl gefesselt und nicht mehr Herr seiner Sinne. Die Dorfbewohner machen einen Bogen um das Anwesen, über das viele Gerüchte und Schauergeschichten kursieren, seit Constance vor Gericht vom Mordvorwurf freigesprochen wurde und sich in das Haus zurückgezogen hat, wo sie isoliert mit ihrer Schwester und ihrem Onkel lebt.
Jeden Dienstag geht Merricat ins Dorf, um Lebensmittel einzukaufen, und wird dort behandelt wie eine Aussätzige. Die Achtzehnjährige, die nichts kennt außer dem Blackwood-Anwesen, flüchtet sich in eine Fantasiewelt und ergeht sich in Mordfantasien an den Dorfbewohnern. Rund um das Anwesen vergräbt sie Dinge, die ihren toten Verwandten gehörten, als Talismane, die die bösen Geister und Dämonen – die Dorfbewohner – fernhalten sollen, während Onkel Julien an einem Buch arbeitet, in dem er obsessiv jedes Detail jenes verhängnisvollen Abends festhalten will. Constance hält derweil Wache über das Haus, hält es sauber und sorgt dafür, dass alles exakt so bleibt wie zu dem Zeitpunkt, an dem alle starben. Zumindest bis eines Tages ihr Cousin Charles vor der Tür steht und sie umwirbt, weil er an den Tresor in Vaters Salon will. Doch Charles bringt das fragile Gleichgewicht von Constance, Merricat und Julien ins Wanken, und Merricat verzweifelt bei dem Versuch, das Schloss, in dem sie immer gelebt hat, vor dem raffgierigen Eindringling zu beschützen – bis eines Nachts ein durchgedrehter Mob auf dem Gelände steht und abrechnen will...
Der Roman, den Shirley Jackson drei Jahre vor ihrem viel zu frühen Tod veröffentlichte, ist ihr Meisterwerk. Und es ist keineswegs ein Genrestück, in dem es spukt (oder: vielleicht spukt, wie im Hill House), sondern ein vielschichtiges Psychogramm, das zu einem frühen Zeitpunkt bereits alle Klischees der platten Horrorromane der kommenden Jahrzehnte demontiert hat. Der Horror hier besteht nicht aus Geistern und Dämonen, sondern aus Menschen – aus gierigen, missgünstigen Menschen, die durch vage Gerüchte zu einem mörderischen Mob werden. Und damit ist es ein höchst zeitgemäßes Buch, blickt man auf die gesellschaftlichen Verhältnisse unserer Tage. Dabei aber verweigert sich Shirley Jackson einem zu simplen schwarz-weißen Täter-Opfer-Schema, denn auch bei dem Familienmord ist nichts, wie es auf den ersten Blick scheint. Und während sie mit Merricat eine der eindrucksvollsten literarischen Figuren der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts erschaffen hat, ist ihr mit dem „Schloss“ ein Roman von zeitloser Eleganz, beklemmendem Schrecken und beispielloser erzählerischer Dichte gelungen.
Es ist an der Zeit, diese große und wegweisende Autorin wieder zu entdecken – und diese beiden Bücher machen den Anfang.
Fixpoetry 2019
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.









Neuen Kommentar schreiben