Lohnt es sich zu überleben?
Die Faszination für (post-)apokalyptische Szenarien scheint für deutschsprachige Autoren ungebrochen zu sein. Vor allem, wenn sie in verschneiter Winterlandschaft spielen. Heinz Helles zweiter Roman Eigentlich müssten wir tanzen tut genau das, erinnert dabei aber wesentlich mehr an Cormac McCarthy als zum Beispiel an Roman Ehrlich.
Die Ausgangslage wirkt ebenfalls vertraut. Eine Fünfergruppe junger Männer verbringt ein gemeinsames Wochenende auf einer Berghütte. Es wird gesoffen, eine Schneebar gebaut, in gemeinsamen Erinnerungen gekramt. Zu sagen haben sich die fünf aber längst nicht mehr so viel wie früher. Sich diese Entfremdung einzugestehen fällt zumindest dem Ich-Erzähler nicht leicht. Als sie sich auf den Weg zurück ins Tal begeben wollen, sehen sie das Dorf unter ihnen brennen. Schnell wird ihnen klar, dass sie zu den letzten Überlebenden einer Welt gehören, die nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was sie bis dahin kannten.
Damit beginnt für die fünf so etwas wie der schier endlose Marsch der Kaiserpinguine, dem Schnee und der Eiseskälte zum Trotz. Eine Metapher, die Helle selbst evoziert, wenn er seinen Roman wie folgt beginnen lässt: „Wenn es zu kalt ist zum Hinlegen, abends, bleiben wir stehen. Wir stehen eng beieinander, Rücken an Rücken an Seite an Bauch. Wir drehen uns langsam weiter im Verlauf der Nacht jeder darf mal in der Mitte stehen, jeder muss ab und zu an den Rand.“
Zu Beginn ihrer Wanderung stellen sich der Gruppe vor allem praktische Fragen. Wie kommen wir an Lebensmittel? Wie an Feuerholz? Doch als der erste der Freunde zurückgelassen werden muss, wird Helles Roman philosophischer. Es geht jetzt nicht mehr um die Individuen der Gruppe, was ihre Freundschaft ausmacht und wie lange sie noch halten kann. „Wir sind ein über mehrere Körper verteilter Wille geworden, und neben dem Teil dieses Willens, den jeder von uns in sich trägt, ist kein Raum mehr für irgendetwas anderes. Wir wollen leben.“
In einer geradezu betörend emotionslosen Sprache erzählt Heinz Helle hier weit mehr als eine Geschichte vom Untergang, sondern wagt eine Erzählung über den Sinn des Lebens, allein und in einer sich immer fremder werdenden Gemeinschaft. Zugespitzt müsste man fragen: Lohnt es sich die Apokalypse zu überleben?
Fixpoetry 2015
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.



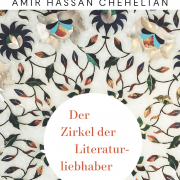





Neuen Kommentar schreiben