William Faulkners Elefant und Gustave Flauberts tonnenschwere Glocke.
Ein Foto von William Faulkner vom Juli 1931, aufgenommen von James Cofield: „Tweed, trotz der Hitze, weißes, unauffällig offenes Dalton-Hemd (…). Die Arme verschränkt, aber nicht wie in der Kirche, eher wie nach dem Mittagessen. In seiner Rechten die kleine Feuersanduhr, die überaus kostbare Zigarette, die mit unerträglicher Schärfe das Vergehen der Zeit bezeichnet“. Die Lucky Strike brennt, ist schon auf die Hälfte reduziert. „Und da ein Fotograf, sei es nun wissentlich oder nicht, nie zufällig das Licht ruft, den Blitz auf die Silbernitrate niedergehen lässt, will ich wissen, warum Cofields Finger just in diesem Augenblick jene kleine Bewegung macht, die aus einem womöglich verkaterten Leib, der sicherlich schwitzt in seiner Tweed-Jacke und sein Dalton-Hemd durchnässt, im Juli in Mississippi eine Ikone macht. Ich möchte glauben, dass es eine unmerkliche Veränderung in Faulkners Blick ist, die ihn dazu treibt, abzudrücken, es ihm vielleicht befiehlt.“
Was sieht Faulkner an diesem heißen Julitag? Der französische Autor Pierre Michon lässt ihn „einen Elefanten“ sehen – ein Ausdruck, den er von James McPherson übernommen hat, der das von einem Soldaten im Sezessionskrieg erzählt: „nicht irgendein Feuer, sondern ein äußerst modernes, das von den neuen Granatwerfern des Erfinders Shrapnell ausgespuckt wurde, von riesigen Kanonenmündern mit dreizehn Daumen Durchmesser, die die Leichtigkeit von Tänzern besaßen, von Spencer-Repetiergewehren mit gezogenem Lauf, lauter Dingen also, denen gegenüber ein Kavallerie-Angriff mit Säbeln, Standarten, Federbüschen und allem Drum und Dran in etwa mit der Brenndauer eine Lucky Strike zu vergleichen ist.“
So eine Art Elefant, solch ein Monster sieht auch Faulkner. Aber nicht den Krieg, sondern einen Elefanten, „dessen großer Fuß von Geburt an über uns schwebt, dem wir dennoch zulächeln und der uns ernährt: die Familie, die Filiationen, in denen der Letztgeborene immer der Allerletzte ist, der Zufall der fleischlichen Kreuzungen, durch den wir Fleisch werden und der uns zudem die Illusion verpasst, dass dieses Fleisch kein Zufall, sondern Schicksal ist.“ Die Menschen, gefangen „vom eisernen Modell eines mythologischen Vorfahren, der alle Karten in seine Hand gebracht und alles so eingerichtet hatte, dass jeder männliche Leib, der ihm nachfolgen sollte, nichts anderes würde sein können als schicksallos, denn das Schicksal war ja er selbst, der Vorfahre, er allein.“ Und vor diesem familiären Hintergrund, so Michon, schrieb Faulkner seine mythischen Bücher über den amerikanischen Süden, über die Schicksale der Schicksalslosen, über das Leiden und die Freuden des Menschen.
Kein Zweifel, die Franzosen lieben das Pathos, die große Geste, die in sich selber kreisende Formulierung. Auch Michon, der nachdenkt über Faulkner, Flaubert und Beckett, über die verstreichende Zeit und „wahres Leben“ vs. „große Literatur“. Über die Rolle der Poesie und den Unterschied zwischen „Bulldozerliteratur“, wie sie Melville, Shakespeare oder Joyce geschrieben haben, und der „sublimen Literatur“ von beispielweise Pessoa. Flaubert wird bei ihm zu einem Menschen, der sich selbst ganz aufgegeben hat, um die Literatur zu erneuern, um „Madame Bovary“ und „Bouvard und Pécuchet“ schreiben zu können. Nichts weniger als den „absoluten Text, die Wahrheit in der Literatur“ – das hat Flaubert geschaffen, „eine Literatur, notwendig wie der Tod, die Arbeit, die Tränen.“
Und die Poesie? Zweimal hat Michon gebetet, indem er ein Gedicht aufsagte: einmal beim Tod seiner Mutter, ein anderes Mal, als ein Kind geboren wurde. Beim Tod seiner Mutter war es François Villons „Ballade der Gehenkten“, in der der zum Tode bereite Villon die Nachlebenden aufruft: „Bittet Gott, er möge uns verzeihen“. Bei der Geburt des Kindes war es Victor Hugos „Der Schlaf des Boas“, der von einem alttestamentarischen Mann erzählt, Urgroßvater von König David und damit Stammvater von Jesus: „Die beiden Gedichte, die ich aufsagte (…) betrachten Leichen, alle Leichen, darunter die der Mütter, sie betrachten die Seele, die sich des von ihr einst bewohnten Leibes erinnert (…); sie betrachten die lebendigen Leiber, die kleinen Kinder, die zur Welt kommen, älter werden und sterben. (…) Sie beruhigen die Leiche, helfen dem Kind, auf seinen Beinen zu stehen. Wahrscheinlich ist das die Funktion der Poesie. Eine andere vermag ich kaum zu sehen.“
Michon nähert sich den von ihm bewunderten Großautoren und ihrem Blick in manchmal sehr treffenden, assoziativen Bildern, versetzt mit privaten Erzählungen aus Äthiopien oder von einer Veranstaltung in der pompösen französischen Nationalbibliothek und dem vorangehenden Besäufnis. Er schreibt über die beiden Körper, die er bei Beckett sieht: den „ewigen, dynastischen, den der Text weiht und inthronisiert (…) und einen zweiten, sterblichen, funktionalen, relativen Körper“. Und schwärmt in der Literatur vor allem für den „Text, der einen erschlägt“. Findet dieses Bild wieder in „Madame Bovary“, wo Emma Bovary eine zwanzig Tonnen schwere Glocke sieht und ihr erzählt wird, dass der „Arbeiter, der sie goss, darüber vor Freude gestorben“ ist. So sollen Texte sein, dass man „vor Freude darüber umzukommen“ vermag.
Eine schöne, leichtfüßige, kurze essayistische Erzählung in all diesem doch etwas schweren und pathetischen Nachsinnen über die Literatur erzählt von Ibn Mangli, einem Edelmann aus dem 14. Jahrhundert, der vier Bücher geschrieben hat, drei sind noch bekannt, u.a. ein Handbuch für Jagdfalken. Hier fabuliert Michon am Schluss den Tod dieses Mannes, und sein Text wird zu einer phantastischen, mystisch-philosophischen Schau, wie sie sonst nur Jorge Luis Borges geschaffen hat.
Fixpoetry 2015
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.



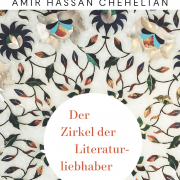





Neuen Kommentar schreiben