„Ausmaß der Kaputtheit“
GEORG-BÜCHNER-PREIS 2015 für Rainald Goetz
08.Juli 2015
In den Feuilletons musste Rainald Goetz in den vergangenen Wochen für seinen neuen Roman „Johann Holtrop“ viel Prügel einstecken. „Goetz als Romancier – muss nicht mehr sein“, schrieb Andreas Platthaus in der FAZ. Und in der ZEIT konstatierte Iris Radisch: „Tiefere Einblicke in die großen Wirtschaftsskandale der jüngsten Vergangenheit“ liefere das Werk nicht. „Allenfalls ein kleiner Literaturskandal mag dabei herauskommen“. Im Grunde aber unterscheide sich Goetz’ Buch nicht von der „Berliner Postpopliteratur“. Zur Untermauerung setzte das Hamburger Wochenblatt, dem die Aufklärung seiner Leserschaft seit jeher ein pädagogisches Anliegen ist, gleich noch einen Wirtschaftsredakteur auf Goetz’ jüngstes Machwerk an. Dieser legte kleinteilig dar, dass so manches ökonomische Detail, das der Mediziner und Historiker Goetz da vor seinen Lesern ausbreitet, gar nicht stimme. Etwa würde sich kein Unternehmen den Namen Arrow PC geben, da das Kürzel PC – wie allseits bekannt sei – für Personalcomputer stehe. Dass er „von derlei Dingen keine Ahnung hat“, offenbare Goetz auch dadurch, dass er Hedgefonds in Taiwan oder Saudi-Arabien verorte. Korrekt sei: „Hedgefonds sitzen typischerweise in New York, London oder in Steueroasen.“ Noch kleinkarierter geht kaum. Wenngleich man bei der ZEIT mittlerweile schon froh sein muss, wenn Bücher überhaupt noch nach ihrem Inhalt besprochen werden, und nicht Großschriftsteller damit beauftragt werden, ihre Lektüreumwelt (und am Rande: ihre generellen Leseeindrücke) zu skizzieren – zum Beispiel wenn Thomas Glavinic auf einer vollen Seite davon berichtet, wie er am Neusiedler See ein Buch von Thomas Bernhard gelesen hat. („Während vor mir auf dem See ein ungarischer Segler mit seinem Boot kämpft und mit seltsam hoher Stimme Flüche über das Wasser schreit, ziehen allerhand Gedanken durch meinen Kopf. Sie haben viel mit Thomas Bernhard, aber auch viel mit mir selbst zu tun [...].“)
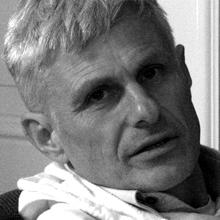
Foto: Quelle Suhrkamp Verlag
Aber zurück zu Goetz: Der Aufstieg Johann Holtrops (Thomas Middelhoff) zum allmächtigen CEO des weltweiten Konzern-Konglomerats der Assperg Medien AG (Bertelsmann) mit Sitz im provinziellen Schönhausen (Gütersloh) fällt politisch in die Ära Schröder/Fischer und wirtschaftlich in die Zeit des „anything goes“: New Economy, billiges Geld, explodierende Aktienkurse! Wie ein Besessener jettet Holtrop um die Welt, New York, Hongkong, Peking, Schönhausen, schließt dabei immer waghalsigere, da überteuerte Deals ab – die sich aber, so sein Glaube, allesamt in der goldenen Zukunft auszahlen werden –, tyrannisiert seine Untergebenen und verachtet seine Umgebung. Doch spätestens mit dem 11. September 2001 ist die Party vorbei. Mit dem Absturz der Börsen kommt auch Holtrops Karriere bei Assperg an ihr Ende. Er wird durch seinen Rivalen Wenningrode („Schleimflasche“) ersetzt und erhält eine Millionenabfindung. Das Geld wirft er seinem neuen „Freund“ und Finanzberater Mack (Josef Esch) in den Rachen, der es verzigfachen soll; auch eine schöne Yacht an der Côte d’Azur soll dieser ihm besorgen. Doch wachsen mit Holtrops Einkünften auch die Schuldenberge, die zwecks maximaler Steuerlast-Reduzierung in exorbitanten Höhen – und im blinden Vertrauen in das Finanzgenie Mack – aufgehäuft werden. Und wie schon zu Assperg-Zeiten erweist sich das Transaktionen-Konstrukt, das Holtrop längst nicht mehr überblickt, nicht nur finanziell, sondern auch rechtlich als ein Desaster. Als Staatsanwälte sein Haus durchsuchen, glaubt er seine Ehre, seinen guten Ruf endgültig verloren – und wirft sich vor einen Zug.
Um es gleich vorwegzunehmen: Rainald Goetz hat mit „Johann Holtrop“ einen großartigen, streckenweise sogar einen brillanten Roman geschrieben. Deutlich wird das unter anderem im kurzen Auftritt des Malerfürsten, der bei der Eröffnung seiner Ausstellung in der Asspergstiftung die versammelten Honoratioren von Schönhausen mit Unsinn zumüllt, besoffen redet, und am Ende sogar selbst ein wenig überrascht ist, damit durchgekommen zu sein. Im Grunde seines Herzens ist auch Holtrop davon überzeugt, ein Künstler zu sein, nur dass die Kulissen, die er verschiebt, auf einer anderen, größeren Bühne stehen.
Leider ist Goetz bei der Konzeption seines Romans ein Fehler unterlaufen, der ihn angreifbar macht für Kritik. Denn offenkundig hat es ihm nicht gereicht, mit „Johann Holtrop“ eine herausragende Satire geschrieben zu haben. Stattdessen hat er den Text auch noch überfrachtet mit zahlreichen hasserfüllten Tiraden über die Verdorbenheit unserer Gesellschaft, ja, der Welt insgesamt. Bezeichnend dafür ist auch der doppeldeutige Untertitel, den er dem Buch verpasst hat: „Abriss der Gesellschaft“.
„Johann Holtrop“ ist aber nicht der Abriss einer ganzen Gesellschaft. Vielmehr ist es die Darstellung eines bestimmten Typus, der, das mag sein, unter den Bedingungen des New Economy Booms einen besonders fruchtbaren gesellschaftlichen Nährboden vorgefunden hat, und der – Nachwirkungen dieser Zeit? – auch heute noch vor allem in den Berufen anzutreffen ist, die Aussicht auf Karriere, Geld, Einfluss und öffentliche Geltung bieten, also vornehmlich in Wirtschaft, Politik, Medien und Wissenschaft.
Was zeichnet diesen Typus, dem Goetz in Holtrop ein so würdiges, da unwürdiges Denkmal gesetzt hat, aus? Da kommt einiges zusammen: Etwa die Reduzierung auf den Marketing-Aspekt einer Sache, eng verknüpft – weil für den Verkauf unerlässlich – mit der Hochschätzung alles Rhetorischen; außerdem Mediensucht; oder auch das Getrieben sein von permanenten sinnfreien Ideen, die, da temporär als genialisch empfunden, allesamt sofort nach draußen müssen, ganze Mitarbeiterstäbe auf Trab halten, aber wenige Stunden später bereits wieder vergessen sind, was unter anderem zur Folge hat, dass die selbsternannten Effizienzfanatiker – ein weiteres Charakteristikum! – in der Summe recht ineffektiv agieren, das aber im Strudel des eigenen Aktionismus untergeht. Ein Paradebeispiel ist die kurze, geniale Szene in einer Hotelsuite in China, als Holtrop, von Selbstmitleid, Sinnsuche und der Wirkung diverser Psychopharmaka überwältigt, binnen weniger Minuten Gliederung, Inhaltsangabe und Exposé seiner Autobiografie zu Papier bringt, und obendrein noch ein rühriges erstes Kindheitskapitel über seine geliebte Großmutter skizziert – und das umgehend seinem Mitarbeiter zur Lektüre vorlegt. („Und?“, sagte er und deutete auf das Manuskript. „Großartige“, antwortete Magnussen.“) Unnötig zu betonen, dass aus dem Buch – vorgesehener Titel: „Die Freiheit der Wirtschaft, oder so ähnlich“ – nie etwas wird.
Mit Johann Holtrop hat Rainald Goetz ein globalisiertes Pendant zu Heinrich Manns treuen „Untertan“ Diederich Heßling geschaffen. Dass es dieser großartige Roman dennoch nicht auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft hat, ist bedauerlich und nicht nachvollziehbar. Stattdessen setzt die Jury auf Unterhaltungsliteratur à la Stephan Thome.
Fixpoetry 2012
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.









Neuen Kommentar schreiben