Geschichten von Not und Elend
Muss man Shakespeare nacherzählen? Muss man ihn in unsere Gegenwart übertragen? Und kann das überhaupt gelingen? Über die Bedeutung jenes englischen Theatermannes, dessen Werk übermächtig über der europäischen Kultur ragt und von dem selbst man kaum etwas weiß, braucht man nicht zu streiten, zumal dann nicht, wenn man akzeptiert, dass es Shakespeare gelungen ist, Kernthemen der europäischen (und nicht nur dieser) Kulturen zusammenzutragen und paradigmatisch auszuarbeiten. Macht, Herrschaft, Rache, Mord, Liebe, Eifersucht. Fast nichts von dem, was interessiert, hat er ausgelassen und in eine Form gebracht, die bis heute an Brillanz nichts eingebüßt hat. Und mehr. Shakespeare ist nicht nur ein genialer Nacherzähler seiner Vorgänger, er hat außerdem die Produktion von Geschichten, die seinem Werk verpflichtet sind, angestoßen und sich so vielfach multipliziert.
Denn keine der großen Erzählungen der letzten Jahrhunderte kommt ohne ihn aus, keine Liebesgeschichte ohne „Romeo und Julia“, keine Geschichte von Herrschaft und Verrat ohne die Königsdramen und keine Geschichte von der zerstörerischen Wirkung der Eifersucht ohne das „Wintermärchen“ oder „Othello“. Und dennoch kommt man immer wieder auf Shakespeare selbst zurück.
Die von Virginia und Leonard Woolf 1917 gegründete, mittlerweile bei Random House untergekommene Hogarth Press hat nun ein ganz spezielles Shakespeare-Projekt gestartet: International renommierte Autorinnen und Autoren erzählen ihre Fassung eines Shakespeare-Werkes neu. In 20 Ländern soll das Projekt präsentiert werden. Der gleichfalls zu Random-House gehörende Knaus-Verlag, der immerhin für eine lange Geschichte populärer aber, brechtisch gesprochen, brauchbarer Literatur, steht betreut das Projekt in Deutschland.
Dass dabei keine Theaterstücke, sondern Romane entstanden, kann einen nicht wundern, hat doch der Roman das Theater als literarisches Leitmedium bereits weit hinter sich gelassen. Mit Romanen von Jeanette Winterson und Howard Jacobson hat die Reihe begonnen. Jeanette Winterson hat sich des „Wintermärchens“ angenommen, Jacobson des „Kaufmanns von Venedig“, was immerhin für spektakuläre Texte sorgen sollte. Denn wenn die Vorlage es schon richtig krachen lässt, sollten die Adaptionen wohl gleichfalls hinbekommen.
Wobei man freilich nicht vergessen sollte, dass die historische Hochliteratur heute häufig genug in der trivialen Ecke zu finden ist. Und das aus dem einfachen Grund, dass es schwierig genug ist, die Themen, Plots und Geschichten beizubehalten, auch wenn man zumeist die Besetzung ändern muss. Denn wer entspräche denn heute noch den Montagues? Wer den Königen, Fürsten und Kaufleuten des 16. und 17. Jahrhunderts? Die Geschichten einfach in die Eliten der Gegenwart zu verlagern, ist wahrscheinlich ebenso verfehlt wie sie einfach nach unten absinken zu lassen. Sie aus den hochherrschaftlichen Gefilden ins kriminelle Milieu zu verschieben, wird vielleicht praktikabel sein, aber wer wird ernsthaft das englische Königshaus mit einer Streetgang vergleichen wollen?
 Jeanette Winterson: Der weite Raum der Zeit, Knaus Verlag 2016 Jeanette Winterson und Howard Jacobson haben sich allerdings für den einfachen (den zuerst genannten) Weg entschieden – womit erstmal nichts gegen sie gesagt sein soll. Sie belassen die Geschichten halbwegs in dem Milieu, in dem sie angesiedelt waren, auch wenn das ungewünschte Konsequenzen hat.
Jeanette Winterson: Der weite Raum der Zeit, Knaus Verlag 2016 Jeanette Winterson und Howard Jacobson haben sich allerdings für den einfachen (den zuerst genannten) Weg entschieden – womit erstmal nichts gegen sie gesagt sein soll. Sie belassen die Geschichten halbwegs in dem Milieu, in dem sie angesiedelt waren, auch wenn das ungewünschte Konsequenzen hat.
Was also ist aus der Geschichte von der gescheiterten Rache des geschundenen Juden, was aus der Parabel über die katastrophischen Folgen der Eifersucht und der Chance, sie wieder zu kompensieren geworden? Ohne Winterson und Jacobson zu nahe zu treten: Die Sprachmacht und den Sprachwitz Shakespeares erreichen sie nicht. Wollen das aber auch nicht. Denn ihr Ziel ist es offensichtlich, den Plot der beiden beräumten Stücke ins Moderne zu wenden, eben nicht nur mit Kostüm und Bühnenbild, sondern auch in Handlung und Erzählweise.
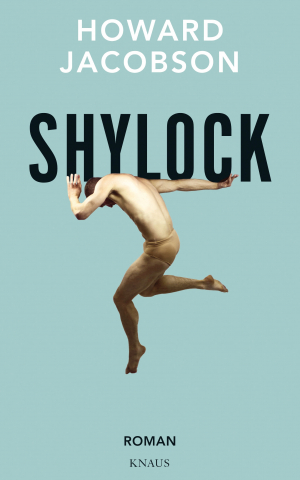 Howard Jacobson: Shylock, Knaus Verlag 2016 Aber dabei greifen die beiden mächtig in den Schmustopf. Wintersons König ist zum Investmentbanker verkommen, Jacobsons Shylock zum reichen Fremden, der seinem nicht minder reichen Freund Strulovitch rät, die Liaisons seiner Tochter hinzunehmen, auch wenn dies einen dämlichen Fußballspieler in die Familie bringen sollte.
Howard Jacobson: Shylock, Knaus Verlag 2016 Aber dabei greifen die beiden mächtig in den Schmustopf. Wintersons König ist zum Investmentbanker verkommen, Jacobsons Shylock zum reichen Fremden, der seinem nicht minder reichen Freund Strulovitch rät, die Liaisons seiner Tochter hinzunehmen, auch wenn dies einen dämlichen Fußballspieler in die Familie bringen sollte.
Damit das Ganze Tiefe und Dramatik hat, ja meinethalben auch Psychologie, müssen die Protagonisten Wintersons, Leo und Xeno, in ihrer Jugend ein homosexuelles Verhältnis gehabt haben. Das tut freilich der Eifersucht Leos keinen Abbruch, aber er behält seinen Sohn bei sich und verstößt nur den angeblichen Wechselbalg, Perdita, die dann in den USA aufwächst. Tochter und Vater finden schließlich wieder zusammen, nur die Mutter darf nicht mehr lebendig vom Sockel steigen als wäre nichts geschehen.
Das ist zweifelsfrei ein wenig klischeehaft angelegt, allerdings dennoch ganz unterhaltsam erzählt, wenn man denn nicht mehr von einer modernen Shakespeare-Adaption erwartet.
Jacobsons „Kaufmann“ ist aus dem fernen Venedig nach London verlegt, was immerhin ganz passend ist. Befremdlich sind allerdings die Verschiebungen, die Jacobson vornimmt. Statt des Pfundes Fleisch, das dem Garantiegeber aus dem Leib geschnitten werden soll, verlangt der geschmähte Vater, dass der mögliche Schwiegersohn oder wenigstens der, der für ihn einstehen muss, sich beschneiden lässt. Und statt der Tochter, die den Vater verlässt und ihn dabei beraubt, gibt es hier einen konventionellen Vater-Tochter-Konflikt: der überbehütende Vater und das frühreife Töchterchen.
Wieso aber nun die Beschneidung, wo der Vater, Strulovitch, ein laikalisierter Jude ist, also mit der Religion und deren Ritualen nichts mehr am Hut hat. Was verlangt er also von seiner Tochter, dass sie nur einen Juden, laikal oder fromm, zum Mann nimmt? Nimmt man das Judentum als Bekenntnis, dann ist das absurd. Nimmt man es als ethnische Kategorie, muss man sich über deren Sinnlosigkeit unterhalten. Das aber blendet Jacobson rundweg aus. Strulovitch kämpft um seine Tochter und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Dass er sie dabei verliert, die dabei doch in Wahrheit zu ihm steht, ist der Clou des Romans, der eben totreitet, was er angeblich so außerordentlich vorzuführen versteht.
Mal sehen also, was die anderen zustande bringen. Lesbare Texte werden es in jedem Fall sein, allein schon weil es Shakespeare ist, der die Vorlage abgibt.
Fixpoetry 2016
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

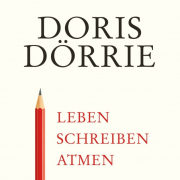





Neuen Kommentar schreiben