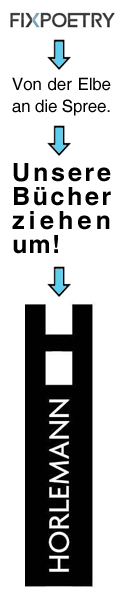weitere Infos zum Beitrag
Poesie
Der scharfsinnige Zugriff aufs Bewusstsein – über Poetiken der Gegenwart
Die junge Literatur inszeniert sich heute wesentlich anders als in früheren Jahren. Wer hätte denn bspw. beim Aufkeimen des socialbeats es je für möglich gehalten, daß sich in Deutschland ein mehrtägiges Festival der Poesie feiern lässt, welches sich in ernstzunehmender Weise mit zeitgenössischer, junger, avantgardistischer Literatur beschäftigt und dessen Protagonisten Bukowski als einen ähnlich skurilen Opa wie Hermann Hesse empfinden. Den theoretischen Unterbau für dieses Happening lieferte nicht eine schlecht layoutete, im Flattersatz getippte Broschür aus dem Copy-Shop, sondern ein richtiges Buch mit Farbfotostrecken, in dem zehn Stimmen der jüngsten Autorengeneration sich mit poetologischen Texten erklären und anschließend zu bestimmten Stichworten (: Generation, Figur, Narration/Struktur, Perspektive, Relevanz, Markt, Universalismus/Fokus, Wirkung und Gegenwartsliteraturen) Stellung beziehen. Und auch dieses Buch ist nicht einfach ein auf Einladung hin zusammengefügtes Textkonvolut, sondern ein Ereignis. Die zehn Autoren – in alphabetischer Reihung: Jörg Albrecht, Ann Cotten, Daniela Danz, Florian Kessler, Harriet Köhler, Jagoda Marinic, Thomas Pletzinger, Steffen Pop, Lennart Sakowksy, Thomas von Steinaecker - trafen sich auf Einladung der Literaturzeitschrift BELLA triste in Hildesheim Anfang Februar 2008 für einige Tage in einer Villa im Stadtteil Himmelsthür, stellten sich gegenseitig ihre daheim geschriebenen Essays vor, diskutieretn und erarbeiteten weitere Statements zu auftauchenden Stichworten. Das ganze wurde dokumentiert in diesem Werkstattbuch, das den schlichten Namen „Treffen“ erhielt und das nun Auskunft gab über Positionen, aus denen die junge Literatur heraus schreibt und schreibend lebt.
Damit ist aber erst die Hälfte der Geschichte erzählt. Das als Thesensammlung konzipierte Buch hatte nämlich, so war es ja geplant, Folgen und Nachwirkungen. Das eigentliche Festival fand statt Ende Mai auf dem Gelände der verlassenen Phoenix-Werke in Hildesheim, das dazu aber erst einmal vorzubereiten war. Fast eine Hundertschaft Studenten machte klar Schiff und besuchsfertig. Martin Bruch von BELLA triste, einer der Veranstalter, erinnert in einem Gespräch mit Lutz Steinbrück an die Verflechtung mit der Universität und dem dortigen Studiengang „Kreatives Schreiben“, daß „ ein Festival in der Größenordnung aber nur denkbar (ist), mit der großartigen Unterstützung, die uns von universitärer Seite entgegengebracht wird“ und weiter: „Schon im letzten Semester durften wir ein Seminar zum Festival geben, zu den inhaltlichen Schwerpunkten, zur Konzeption, in diesem Semester halfen die über 70 Studierenden intensiv an der Vorbereitung der vier Tage Ende Mai mit.“
Über die Festivaltage gibt es einen wunderbaren Rückblick von Peer Trilke, dessen Aufsatz „Wir sind Sprachparty“ man dazu googlen sollte. Festzuhalten bleibt, daß es hier (zu nennen wäre der Herausgeberstab von BELLA triste) offensichtlich literaturliebende Enthusiasten gibt, die sich nicht mit den althergebrachten medialen Möglichkeiten der Literatur zufrieden geben, sondern es schaffen ihr einen zeitgemäßen Rahmen zu verleihen, aus dem heraus sie Präsenz und Ausstrahlung potenzieren kann. „Eine dramatische Auftragsproduktion, das Leuchtwerk, illuminierte die größte der Werkshallen. Szenische Lesungen, literarisches Picknick, Live Poetry, eine Hörspiellounge, literarische Gespräche zum Brunch über Markt, Musik und Film, Präsentationen der jungen Verlags- und Zeitschriftenszene, eine wissenschaftliche Tagung, ein Lyrikwettbewerb und ein Fußballspiel zwischen Angehörigen der Leipziger und Hildesheimer Schreibschulen stellten nur das Rahmenprogramm. Höhepunkte aber waren die Abendveranstaltungen, die sich den Positionen von Autoren zu Pop, Politik und Poetik widmeten.“ erzählt Guido Graf in „Bestattung eines Hundes“.
Doch zurück zum Buch: es ist für jeden Schreibenden – nicht nur für Insider der aktuell angesagten Generation – ein inspirierender Katalog verschiedenster individueller Muster, die alle aus mehr oder weniger denselben Elementen erzeugt sind. „Eine heterogene Wunderkammer häufig autobiographisch kolorierter Überlegungen, nicht frei von Germanistenweisheiten, mitunter jedoch scharfsinnig im Zugriff.“ urteilt Peer Trilcke. Dabei sind es sehr offene und klare Ansagen, vor allem findet man darin Unmengen von Zeit und Raum gespiegelt, die dazu verwandt werden, wirklich tief das eigene Schreiben zu reflektieren. Das Schreiben passiert nicht mehr einfach, es geliert nicht ohne den Zusatz umfassend angestellter, eigener poetologischer Überlegungen und Verortungen, so scheint es. Es gewinnt spürbar Reife dadurch, daß es im Vergleich geschieht und sich misst, nicht ganz so offensiv wie in einer Hitparade, aber innerlich wird doch ein Kontext gesucht, in dem das Abbilden sinnvoll erscheint, nicht nur weil er das Abzubildende am besten wiedergäbe, sondern auch weil er die Chance auf eine Deutlichkeit beinhaltet, die das Eigene vom Gewöhnlichen sichtbar trennt. Im schlimmsten Fall verrennt sich das zu einem Originalitätswahn, im besten wird daraus der eigene Stil.
Dem aufmerksamen Leser entgeht dabei nicht, daß alle diese Positionen im Grunde nicht ganz neu sind, aber durchaus neu formuliert, erweitert dargestellt, aus einem ganz eigenen Kontext gefiltert. Zukünftiges kann sich immer nur aus dem Moment entwickeln, der ja genug Vergangenheit in den Schichten, der Geschichtlichkeit seiner Zellwände enthält. Um konstruktiv mit dem Moment umzugehen, muß wenigstens ein Teil seiner Geschichtlichkeit verstanden werden und das ist keine leichte Arbeit. Hinsetzen und Losschreiben ist nicht. Dazu kommt eine generelle Verlorenheit. Weitgreifende inhaltliche Utopien oder weltgreifende Visionen gibt es nicht, grundlegend neuartige Perspektiven sind aus dem ererbten Wust kaum zu entwickeln. Alles windet sich schließlich doch wieder auf den Moment zurück. Jedem wachen Menschen bleibt als sicherer Aufenthalt nur die Gegenwart und genau dort singt er dann seinen eigenen Song. Das Betreiben einer eigenen Poetik ist das Präsentieren von eigenem Kontext. Ein in jedem Fall besonderes und weites Feld. Als "Refugium der Komplexität" hat das Daniela Danz bezeichnet, worauf sich die Literatur beziehen lasse.
Das Schreiben hat letzten Endes, so befindet Steffen Popp – und er entschuldigt sich, sehr signifikant, für das altmodische „Unwort“ – immer mit dem Bewußtsein zu tun. Was ist Bewusstsein? fragt er und beantwortet es gleich selbst: das Bilden von Erinnerungen. Ein bemerkenswerter Gedanke, den ich so verstehe: das Betrachten von Existenz schlechthin ist nicht ganz ausreichend, es fehlt die zeitliche, also geschichtliche Komponente. Der pure Moment dringt erst ins Bewußtsein, wenn er nicht nur ist, sondern wird. Das Werdende enthält nicht nur das entschieden Vorhandene, sondern auch das sich zusätzlich Bildende. In ihm nun ist zusätzlich vorhanden die Art und Weise wie ich etwas betrachte und als was ich es erinnere. Mein Anteil ist das als erinnerbar Extrahierte und dann das Erinnerte, ich mische es in die Gegenwart und bilde damit Geschichtliches. Wir alle mischen uns auf sehr spezielle und eigene Weise in die Gegenwart, anders geht es nicht, auch als Betrachter. Unsere Anteile machen uns zu Geschichten. Unser Leben lässt sich also erzählen.
Natürlich ist das meine eigene und sehr spontane Interpretation, die ich eigentlich schon wieder aus dem Text streichen wollte. Ich laß sie hier trotzdem stehen, um beispielhaft zu zeigen, in welchen Regionen die Auseinandersetzung mit dem „Treffen“ stattfinden kann (muß). Gerade Steffen Popp schafft es immer wieder als Reizfigur zu fungieren, vielleicht hat man deshalb geglaubt, ihn in einer Rezension gar als „spleenig“ bezeichnen zu müssen. Für Popp eigentlich ein Lob, denn genau diese kraftvolle Individualitätsabgrenzung bildet für ihn ein zentrales Moment des schriftstellerischen Überlebens. Wahrhaftigkeit ist dabei ein weiteres Stichwort, das von Jagoda Marinić eingeführt wird, die insgesamt dem Treffen eine sehr geerdete und lebensnahe Komponente beimischt. Auch ihre nach Stichworten geordnete Poetik liest sich spannend und ungeheuer gewinnbringend. Viele Sätze von ihr behaupten sich gegen die Verkopfung und die Auswalzung zur Fläche. Es ist hier leider nicht der Raum weiter detailliert auf die Inhalte einzugehen, es gibt viele interessante Ansätze und persönliche Noten, Name für Name wäre zu nennen und die spezifische Sichtweise jeweils herauszuarbeiten.
Eine Arbeit, die der Leser des Buches machen sollte, denn sie allein führt zu dem Gewinn, der letzten Endes im Abgleich, in der eigenen Verortung liegt. Dazu ist das Buch gedacht. Die manchmal doch als so quälend empfundene Ichhaftigkeit sehr wohl zu begreifen als Chance den Weltdurchfluß, einen ganz individuellen, immer einzigartigen, in die Beschreibung zu holen in einer ganz eigenen Sprache. Jedes authentische Einholen und Beschreiben wird zu einem individuellen Ausgesetztsein, was die Literatur lebendig macht. Und natürlich ist es weiterhin möglich, gute Bücher auch ohne diese theoretischen Auseinandersetzungen zu schreiben. Die interessantesten, finde ich und das wird so bleiben, schreibt nach wie vor das Leben.
Martin Bruch u.a. (Hrg.) „Treffen“. Poetiken der Gegenwart – ein Werkstattbuch. BELLA triste, Hildesheim 2008.