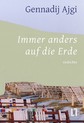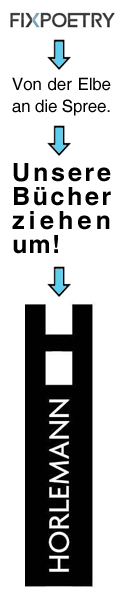Gedichte
Platon auf dem Feld. »Immer anders auf die Erde« von Gennadij Ajgi.
27.07.2013 | Hamburg
und der mensch geht über das feld
wie die Stimme und wie der Atem
durch die bäume, die gleichsam warten
ihren Namen zu hören zum ersten mal.
Erdnah ist das Erste was einem zu Gennadij Ajgis Gedichten einfällt. Die Gedichte des tschuwaschischen Dichters sind erdig und warm und zugleich schwindelerregend luftig und kühn. Das macht das Eigentümliche, das Besondere dieser Dichtung aus. Ihre Wurzeln hat sie in der tschuwaschischen Volksdichtung, in der Ajgi begonnen hatte zu schreiben und in dem, was man die Feld- und Waldkultur der russischen Sprache nennen könnte, in die er auf Anraten von Boris Pasternak wechselte.
Das ist der Boden, von dem aus Ajgi abhebt zur „abstrahierten Verabsolutierung von Welterscheinungen durch den Dichter“. Zur Konstruktion von Welten und Wirklichkeiten, die nur in der innersprachlichen Realität des Gedichts existieren. Sein Schreiben kreist um diesen Schöpfungsvorgang einer rein immanenten, innersprachlichen Welt. Ein Vorgang, den Anja Utler in ihrer Münchner Rede zur Poesie, in der sie sich mit Ajgi befasst, treffend als „das Ersprechen einer Wirklichkeit“ bezeichnet hat. Es verwundert also nicht, dass Ajgi die französischen Symbolisten Rimbaud und Baudelaire seine Vorbilder nennt, deren Texte sich ebenfalls gegen einen außersprachlichen Verständniszugang des Lesers verwehren.
Vollendung des Feldes; mitten auf dem Feld; Feld-ohne uns; schon die Titel zahlreicher Gedichte verweisen dabei darauf, dass „Feld“ der zentrale Begriff in Ajgis Poetologie ist. Einmal das konkrete irdische Feld. Eine vom Menschen abgesteckte und bebaute Fläche, die bestimmte Früchte tragen soll. Und zugleich der Raum des Gedichts. Ein luftiger, abstrakter Raum, der erst durch das Betreten und Abschreiten entsteht; im Schreib- und Lesevollzug durchmessen und ausgelotet wird. Einem luftigen Drahtseilakt, bei dem nie sicher ist, ob er gelingt. Weder dem Schreibenden noch dem Lesenden.
Denn auf der Oberfläche sind Ajgis Gedichte zunächst sperrig; wirken struppig und kahl. Durch das Prinzip radikaler Verknappung und Verdichtung zerfallen die Verse, werden zerfleddert von Bindestrichen, Klammern, Fragezeichen, Anführungsstrichen und Auslassungspunkten.
GOGOLS HAUS: RENOVIERUNG
und um mitternacht
treten zeichen hervor
aus gleichsam unter dem mantel – verborgenen –schnittwunden
(sie sind auch in gedanken
immer –da):
ähnlich den blutstropfen der vögel! –
und in der müd-verlassenen seele des moskauer dunkels:
„RENOVIERUNG
GOGOLS HAUS
RENOVIERUNG“ –
wie das rote flimmern der lampe
1966
Der Verkapselung, Verdichtung und Verknappung ist es wohl auch zuzuschreiben, dass Ajgis Gedichte dunkel, oder hermetisch genannt werden.
Man muss sich erst mal in diese Sprache hineinlesen. Dann aber trägt sie.
Die Verkapselung, der Schutzmantel, das Erdige, es birgt – wie das Mohnkörbchen in dem Gedicht: Feld – ein plötzlicher Mohn die Mohnkapseln schützt – das Lichte, Fragile, Momentane, Zerfallende.
Denn darin besteht Ajgis (poetologische) Mystik: Den seltenen Moment herbeirufen und mitteilen, in dem der Blick des lyrischen Ichs plötzlich etwas vom großen Leuchten auffängt.
Und dieses Flimmern, Flirren, Leuchten durchzieht für diesen einen Moment die ganze Gedichtwelt: den Käfer an der Wand, die Milch in der Schüssel, selbst die Tapete. Und Ajgi gelingt das Erstaunliche: die Vereinigung des Metaphysischen und Irdischen im Gedicht. Er holt Platon runter auf die Erde.
IMMER ANDERS AUF DIE ERDE
in die gräser der Erde geht nach und nach
das leuchten der erinnerungen des künstlers –
danksagung flüstert wie eine verschwommene
bewegung kraft ihres dastehens – ihrer bereitschaft sich alsbald zu regen –
(atem der welt – wie gleichmäßiger wind) –
und die räume werden immer ähnlicher der hohen ruhe
als ob die sarowsche rede „erwirb die friedliche seele“
in den zweigen flimmert und in den dämmerungen leuchtet –
auf leinwänden den immer hoch-irdischen
Die Rede vom hoch-irdischen fasst die oben beschriebene Bewegung treffend zusammen. Ajgis Gedichte suchen und finden das Leuchten, das Göttliche im irdisch-materiell Alltäglichen. Einem Krug, einem Marmeladeglas oder im Flimmern zweier Zweige, die aufeinanderschlagen.
Gott ist, wie es in dem Gedicht Feld-ohne uns heißt, der „ewig-plötzliche“; eine unvorhersehbare plötzliche aufblitzende Erfahrung, die in das Irdische einbricht und es durchleuchtet. Daran erinnert, dass alles, wenn es offen da steht, auch aus sich selbst heraus leuchtet, durchwoben und durchwirkt ist von jenem großen Licht; sich zu seinem Schutz aber wieder verbergen und verkapseln muss. Wie eben die Gedichte Ajgis.
Bei ihm ist Sprechen und Dichten also ein schöpferischer Akt, bei dem durch das Aussprechen Welt und Wirklichkeit erst entstehen. Die Bezüge zum Neuplatonismus, zu den Helldunkel Dichtungen eines Dionysius Areopagita, zum Johannes-Evangelium und vielen anderen Quellen sind zahllos und Ajgi reiht sich nahtlos und ebenbürtig in die Reihe seiner Vordenker und Dichter ein.
Der Leipziger Literaturverlag, der sich immer wieder um die Vermittlung osteuropäischer Literatur im deutschsprachigen Raum verdient macht, hat mit dem Band Immer anders auf die Erde eine breite und wohlkomponierte zweisprachige Auswahl von Ajgis Gedichten vorgelegt. Chronologisch geordnet bietet sie einen Überblick über das Schaffen dieses Monolithen der russischsprachigen Literatur von den Jahren 1965 bis 2003. Wer des Russischen nicht mächtig ist, kann auch beim Lesen der deutschen Übersetzung von Walter Thümler Gänsehaut bekommen.
Gennadij Ajgi: Immer anders auf die Erde. Ausgewählt und übertragen von Walter Thümler, 184 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3866600751. Leipziger Literaturverlag 2009.
Mónika Koncz hat zuletzt über »hochaufgetürmte Tage« von Emmy Ball-Hennings.auf Fixpoetry geschrieben.
© Fixpoetry.com 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com
Sie können diesen Beitrag gerne verlinken