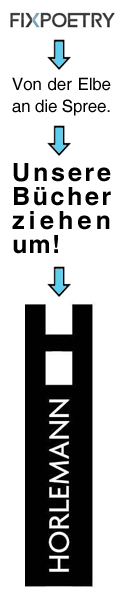weitere Infos zum Beitrag
Lyrik und Prosa
Über das Menschenmögliche hinaus. »Sind Flügel wohl…« von Momčilo Nastasijević.
07.08.2012 | Hamburg
Momčilo Nastasijević, geboren 1894 im südserbischen Gornij Milanovac, war zeitlebens ein literarischer Außenseiter und ist posthum zu einem der bedeutendsten serbischen Dichter des 20. Jahrhunderts avanciert.
Seine leicht sperrige und von Archaismen durchzogene Sprache, seine tiefe Religiosität und seine zuweilen rätselhaften Gedichte, in denen er den Klang und die Melodik über den zu vermittelnden Sinn stellt, passten nicht zu einer Zeit, in der in der serbischen Literatur Expressionismus und surrealistischer Marxismus die vorherrschenden Strömungen waren.
Seinen Lebensunterhalt bestritt er als Französischlehrer in einem Belgrader Gymnasium, veröffentlichte hier und da einige Gedichte, erhielt aber kaum Anerkennung. Sein Hauptwerk pet lirskih krugova (fünf lyrische Kreise) veröffentlichte er privat und scharte – gleich Stefan George – einen kleinen Kreis von ebenfalls schreibenden Bewunderern um sich, die in ihm den Auserwählten sahen.
Dumpf da Unhörbares
in mir sich krümmte.
Gesprungen, verstummend im Tod sich
die Saite verlauten lässt.
Und ob von Galle oder Honig
dieser Becher voll,
Schmerz mich, –
bis auf den Grund ich schlürfe,
ich sterbe als Unaussprechliches
ins Wort.
Das Charakteristische auf syntaktischer Ebene sind die Inversionen, sowie der verfremdende in mittelalterliche und volkspoetische Schichten zurückgreifende Sprachgebrauch.
Nastasijević schreibt selbst, in seinem poetologischen Essay Für eine Mutter-Melodie: „Hören wir eine unbekannte Sprache, nehmen wir ihre Melodie umso deutlicher wahr. Indem sie abweicht, wirkt sich wunderlich, sie liegt einem nicht wie die eigene; man muss sich wie ein Instrument beharrlich auf sie einstimmen, dass sie den Nerv trifft.“
Die Verfremdung ist also Programm; sie fordert das Einstimmen auf diesen Ton. Und Melodik ist es auch, die für Nastasijević über allem steht. Nicht als Dichter, sondern als Sänger sieht er sich selbst, der beständig auf der Suche nach dem Ton aus der Tiefe ist, der „wie durch ein Wunder, Herbes zu Weichem macht und umgekehrt.“
Aus der Einsamkeit
Bleib wo du bist,
und fließe wie ein Fluss,
und wachse wie ein Baum,
und als Sturm heule auf,
oder blühe wie eine Blume.
Es wäre ein grundlegendes Missverständnis diese Gedichte als hermetisch, dunkel oder gar schwermütig zu bezeichnen. Kraftvoll und trotzig, selbstbewusst und mit dem Sendungsbewusstsein eines biblischen Propheten präsentiert sich dieser Dichter. Die Kunst stellt er gleich mit Gott. Den Geist, aus dem heraus sie geschaffen werden soll, nennt er die „singfreudige Beschwingtheit“, die imstande ist „ein Maximum an Freude und ein Maximum an Schmerz zu ertragen“ und fordert apodiktisch, dass „über das Menschenmögliche hinaus geschaffen werden muss.“
Der zentrale Begriff, um den dieses singende Dichten kreist, ist das Ganze. Das eine enthält bei ihm immer auch sein Gegenteil und ist ohne es gar nicht erst zu denken.Setzte Gottes halber der Satan an/ des Satans halber Gott? Fragt er in dem Langgedicht Worte im Stein. Verzehrende und Verzehrte, Jagende und Gejagte, das Heilige und das Abgründige, all dies kann Nastasijević immer nur zusammen denken und der Dichter selbst ist sich „Rettung und Grab“ zugleich. Als geistige Väter dieser Philosophie könnte man Aristoteles, Leibniz, Hegel und auch Hölderlin anführen.
Diesen Holismus gründet er auf ein neuplatonisches, emanatistisches Weltbild. Der Vorstellung, dass die Vielheit aus dem Urgrund, der Einheit ausfließt. Gott ist der Überfluss, aus dem heraus alles andere wie Lichtstrahlen aus der Sonne hervorbricht. Das Dunkel, die verdichtete Materie entsteht durch die Entfernung von der Quelle, bleibt aber dennoch immer in ihr aufgehoben. Gott, Licht, Fließen undStein sind daher auch die zentralen Begriffe in Nastasijevićs Dichtung.
Wie also die Schöpfung im emanatistischen Weltmodell aus einem Überfluss Gottes heraus entsteht, so bringt für Nastasijević auch der Dichter die Dichtung durch ein Überfließen seiner Kraft „in der Zier hervor.“ Wobei sich diese Zier in seiner Dichtung leider auch in der extremen Manieriertheit des Stils offenbart.
Eigensinnig, stolz und kunstvoll gelingt ihm immer wieder der Perspektivwechsel von der Niederlage in den Sieg: Nicht ihr schlugt den Sohn an/ er kreuzigte sich selbst./ (…) Finsternis dies, wenn die Mücke der Spinne/ Übersättigung ist. Schachtelt Welten und Perspektiven ineinander, dass einem schwindelt. Lässt durch das Mittel des Satzabbruchs immer wieder offen, ob die Worte syntaktisch nach rechts oder links gelesen werden sollen; evoziert Bedeutungsvielfalt durch Verknappung.
Die Lektüre erweckt den Eindruck, die Gedichte brauchen keinen Leser, der Leser braucht die Gedichte.
Der Band Sind Flügel wohl… der dieses Frühjahr im Leipziger Literaturverlag erschienen ist, stellt den ersten und sehr lobenswerten Versuch dar, Nastasijevićs Texte umfassend ins Deutsche zu übertragen. Er gliedert sich in eine siebzigseitige und gefühlt etwas zu gut gemeint ausführliche Biographie; dem lyrischen Hauptwerk fünf lyrische Kreise auf Serbisch und in deutscher Übersetzung; sowie das Prosastück Aufzeichnung über die Mitgaben meiner Verwandten Marija und zu guter Letzt den poetologischen Essay Für eine Mutter-Melodie.
Schon im Vorwort betont Robert Hodel, der Herausgeber und Übersetzer, dass sich die Übertragung der Gedichte stärker an ihrem Sinn, als an ihrer Form orientiert, was z.B. auf Kosten der Reime geht. Es ist ihm auch gelungen die eigentümliche Stellung der Worte und ihren Sinn zu übertragen. Schwieriger wird es dann mit Melodik und Ton, die in Nastasijević Dichten eine derart zentrale Rolle einnehmen, und der daher jeglichen Übersetzungen von Poesie in eine andere Sprache skeptisch gegenüberstand. Die zweisprachige Ausgabe ist daher eine gute Möglichkeit sich auf der einen Seite in den Inhalt und auf der anderen in den Klang vertiefen zu können.
Momčilo Nastasijević: Sind Flügel wohl… Herausgegeben und übertragen von Robert Hodel, 284 Seiten, 29,95 Euro, ISBN 978-3866601604. Leipziger Literaturverlag 2013.
Mónika Koncz hat zuletzt über »Immer anders auf die Erde« von Gennadij Ajgi auf Fixpoetry geschrieben.
© Fixpoetry.com 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com
Sie können diesen Beitrag aber gerne verlinken