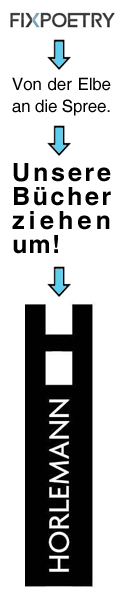weitere Infos zum Beitrag
Ein Essay zur Würde des Menschen im Spätkapitalismus.
Die Kehrseite des Überflusses oder: Können wir den Überfluss beeinflussen?
12.09.2013 | Hamburg
Seit 2010 gibt der Residenz Verlag die Reihe „Unruhe bewahren“ heraus. Was auf den ersten Blick möglicherweise paradox scheint, hat durchaus seine Logik. Denn Unruhe bewahren, meint aufmerksam zu bleiben für das, was nicht stimmt, meint aber auch, Unruhe zu stiften, meint vor allem den kritischen Diskurs, die Auseinandersetzung mit den Problemen der Gegenwart aufrecht zu erhalten und weiterzuführen.
Vom 18. bis 20. März des Jahres fand in diesem Rahmen Ilja Trojanows Frühjahrsvorlesung „Der überflüssige Mensch“ statt, die seit dem 07. August als Buch vorliegt. Bereits kurz nach Erscheinen des Essays gab es zahlreiche Berichte zu dieser Streitschrift. Was sehr erfreulich ist, da es sich um ein wichtiges Buch handelt. Nicht zuletzt wegen des Impulses, den es aussendet. Wegen der Erkenntnis, dass wir verantwortlich sind. Und etwas tun können. Ilja Trojanow deckt nicht allein Missstände auf, spricht Dinge aus, die bislang unter das Redetabu fallen, in erster Linie hat er vielmehr versucht, ein Buch gegen die Überzeugung zu schreiben, unter der unsere Überflussgesellschaft am meisten leidet: „Wir können ja ohnehin nichts tun.“
Aber der Reihe nach. Dass wir in einer Überflussgesellschaft leben, dürfte weder Verwunderung noch Widerspruch herausfordern. Im Großen und Ganzen leben wir ganz gut damit. Jedenfalls solange wir uns beim Begriff der Überflussgesellschaft auf den wirtschaftlichen Rahmen beschränken, auf den Überfluss an Waren. Ganz am Rande tauchen vielleicht auch die Folgen zunehmender Technologisierung und der Globalisierung auf, die immer mehr Menschen die Arbeit nimmt. Ilja Trojanow geht in seinem Essay einen Schritt weiter und denkt das Phänomen des „Überflusses“ konsequent zu Ende.
Der Mensch ist überflüssig, wenn er weder als Produzent noch als Konsument auftritt. Menschen außerhalb des Wirtschaftskreislaufs sind überflüssig. Oder mit Trojanows Worten: „Die Gesetze des Marktes markieren die Grenzen der Freiheit. [¡K] Auf wen können wir verzichten? Diese Frage wird niemals im Sinne der Gemeinschaft reflektiert, sondern von der Evidenz der Machtverhältnisse beantwortet ¨C die Schwächsten gehen über Bord oder werden aufgefressen. [¡K] Insofern birgt der oft leichtfertig dahingesagte Satz: es gibt zu viele Menschen enormen ethischen Sprengstoff.“
Das Grundproblem des Spätkapitalismus, sagt Ilja Trojanow, ist, dass er keinerlei Perspektiven für einen Großteil der Menschheit bietet. Sie also überflüssig macht. Nicht nur in den Augen derjenigen, die Thomas Robert Malthus, den Ökonomen aus dem 19. Jahrhundert, wiederentdeckt haben, dessen Lehre sich zugespitzt in folgendem Zitat wiedergeben lässt: „Ein Mensch, der in einer schon okkupierten Welt geboren wird, wenn seine Familie nicht die Mittel hat, ihn zu ernähren oder wenn die Gesellschaft seine Arbeit nicht nötig hat, dieser Mensch hat nicht das mindeste Recht, irgend einen Teil von Nahrung zu verlangen, und er ist wirklich zu viel auf der Erde. Bei dem großen Gastmahle der Natur ist durchaus kein Gedeck für ihn gelegt. Die Natur gebietet ihm abzutreten, und sie säumt nicht, selbst diesen Befehl zur Ausführung zu bringen.“
„Neomalthusianer haben nicht nur in den USA Hochkonjunktur. Die russische Zeitschrift Ekologitscheski Postmodern (Ökologische Postmoderne) publizierte vor einigen Jahren einen Bericht zu diesem Thema, der unter anderem eine Tabelle für das Jahr 2007 über „Länder der Welt mit überflüssiger Bevölkerung“ enthielt, definiert gemäß den oben skizzierten, rein ökonomischen Kriterien: als überflüssig gilt derjenige, dessen Arbeitskraft in den kapitalistischen Kreisläufen nicht profitabel genutzt werden kann.“
Trojanow bricht das Tabu, auszusprechen, was nicht nur einige neoliberale Denker glauben und zeigt wie menschenverachtend die globalisierte Überflussgesellschaft längst geworden ist, dass Menschen sprichwörtlich als Abfall betrachtet werden. Er führt in seinem Essay eindrücklich die Kehrseite einer Gesellschaft, die im Überfluss lebt vor, indem er aufzeigt, auf wessen Kosten der Gewinn einiger weniger erwirtschaftet wird.
„Es kann in diesem Zusammenhang nur zwei logische und konsequente Positionen geben: Entweder es ist genug für alle da und wir können mit dem globalen Wachstum weitermachen wie bisher, bis eines Tages alle Länder der Welt unseren Lebensstandard samt unserem Verbrauch erreicht haben. Oder die Ressourcen sind begrenzt und das Wachstum wird gegen eine Decke stoßen, woraus folgt, dass wir unseren Wohlstand reduzieren müssen, um den anderen wenigstens das Recht auf Nahrung und ein würdevolles Leben zu garantieren. Jede andere Haltung impliziert, dass es wertvolles und unwertes Leben gibt.“
Und Trojanow findet viele Beispiele, dass unsere Gesellschaft eben diese Haltung längst eingenommen hat. „33 Prozent der Deutschen glauben gar, dass wir uns in Zeiten der Wirtschaftskrise nicht mehr leisten können, allen Menschen gleiche Rechte zu garantieren.“
Durch die permanente Bedrohung der eigenen Existenz wird Solidarität verhindert. „Es gilt die Armen zu bekämpfen, nicht die Armut. [¡K] Im Jahre 1955 waren in den USA noch 34 Prozent der Lohnempfänger gewerkschaftlich organisiert, heute sind es nur noch sieben Prozent. Die Tendenz geht bei uns in die gleiche Richtung, in Deutschland sind es laut Angaben des DGB 16 %, Rentner und Arbeitslose mitgerechnet. [¡K] Ein Duktus der folgenlosen Empörung hat sich eingebürgert [¡K].“
Trojanow stellt die Frage, ob Demokratie mit Vermögenskonzentration überhaupt vereinbar ist. Er plädiert dafür die Reichen und Superreichen auch in unserem Land als Oligarchen wahrzunehmen, was impliziert, dass sie neben ihrer großen wirtschaftlichen Macht, auch politisch Einfluss nehmen, um ihr immenses Vermögen zu verteidigen. Nur noch ein Zitat, um das Ausmaß der Vermögenskonzentration zu verdeutlichen: „Die zehn erfolgreichsten Hedgefonds-Manager rafften im Jahre 2012 10,1 Milliarden Dollar zusammen mit diesem Geld könnte man 250 000 Grundschullehrer oder 196 000 Krankenschwestern einstellen.“
Trojanow geht aber zum Glück noch einen Schritt weiter, nachdem er Wut gesät hat, indem er Tatsachen aufgedeckt hat, die wir in unserer Lethargie einfach so hinnehmen, plädiert er zum Schluss für utopische Entwürfe, für Träume und den Glauben daran, diese Vorhaben umsetzen zu können. „Wir müssen uns fragen, ob nicht die individuelle Verzweiflung samt der daraus folgenden Lähmung ein Luxus der Wohlhabenden ist.“
Trojanows Buch rüttelt auf, weckt auf, und stiftet zum Handeln und Denken an. Und er tut es nicht, indem er z.B. einen „Veggie Day“ verordnet, sondern indem er aufdeckt und ausspricht. Aufklärung im besten Sinne des Wortes.
Ilja Trojanow. Der überflüssige Mensch. Essay. Aus der Reihe „Unruhe bewahren“. ISBN 978 3 7017 1613 5. 16,90 Euro. Residenz Verlag Wien, 2013.
Elke Engelhardt hat zuletzt über Die halbe Sonne von Aris Fioretos auf Fixpoetry geschrieben.
Fixpoetry 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken.