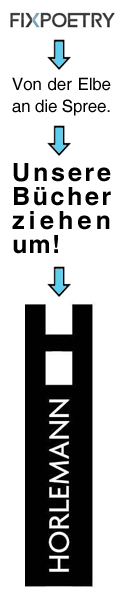weitere Infos zum Beitrag
Gedichte
Tatenlosigkeit als Dauerzustand
17.09.2013 | Hamburg
Das mit den Klischees ist so eine Sache: Sie lassen sich beim Schreiben so schlecht umgehen und jeder Versuch, sie überhaupt zu umgehen, kann schnell bemüht wirken. Hilft nur, sie zuzulassen – oder aber die Konfrontation. Nicht, dass es dann nicht trotzdem Kritik hageln könnte. Denn Klischees zu benutzen, das wird häufig gleichgesetzt mit mangelnder Kreativität, kurz: Einfallslosigkeit. Und die hat in der Literatur, zumal der Lyrik, die sich schon immer mit Vorurteilen und Missverständnissen herumplagen muss, eh nichts verloren. Vom Klischee ist es nicht weit zum Kitsch und nichts braucht die Gattung weniger als noch mehr Innerlichkeitsvorwürfe.
Es gibt natürlich auch SchriftstellerInnen, die sich hervorragend mit den Klischees arrangiert haben und sie tatsächlich für sich zu nutzen wissen. Der Anfang des Jahres verstorbene Jean Krier kommt in den Sinn: Sein Band Herzens Lust Spiele trägt die großen Worte bereits im Titel und umging auch zwischen den Buchdeckeln keine Klischees, sondern stapfte genüsslich durch jedes hindurch. Herausgekommen sind Gedichte, die selbst den überholtesten Tropen noch neue Impulse entlocken konnten. Die nah am Kitsch standen und trotzdem, gerade deswegen berührten. Was sich als gefälliges Geseiere ankündigte, entpuppte sich bei genauerem Hinsehen als das Gegenteil.
Auf den ersten Blick stakst auch der mittlerweile vierte Gedichtband Sophie Reyers durch die problematischen Zonen der Klischeehaftigkeit. die gezirpte zeit – schon der Titel erinnert an Ingeborg Bachmann (Die gestundete Zeit) und wahlweise Paul Celan (»Dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun«) oder Rainer Maria Rilke (»Nennt ihr das Seele, was so zage zirpt in euch?«). Dass bereits im ersten Gedicht, gitter, schon wieder Celan (Sprachgitter) evoziert wird, in einem nachfolgenden Gedicht die Zeilen »zeitig ist es / es ist zeit« Rilke unumwunden zitiert und auch Bachmanns poetischer Gassenhauer wieder aufgegriffen wird (»es stundet gegen die zeit an«) – ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Ist das nicht, na ja, klischeehaft: Ausgerechnet diese drei herbeizurufen? Oder sind das Hommagen? An drei, die die deutschsprachige Dichtung zwar dermaßen geprägt haben, dass ihre Dichtungen zum Allgemeingut verkommen sind, sodass allein schon das bloße Zitat aufstößt?
Und wie sieht das aus in Bezug auf die anderen AutorInnen und ikonischen Texte, die anscheinend auf die eine oder andere Art durch die Texte geistern? Bei der Wahl der Farbadjektive scheint sich Reyer zumindest ganz an Benn zu orientieren, der nur »blau« wirklich gelten lassen wollte – und fügt häufiger noch ein »rot« hinzu, wie es bei dessen ZeitgenossInnen im expressionistischen Jahrzehnt beliebt war. Die monotonen Wiederholungen à la »und der himmel gehört mir und die gezirpte zeit. / und die wolken decke und die wolle der abende. / und der halbe mond gehört mir und die blauen schuhe« und so fort – ist das vielleicht als Riff auf Rolf Dieter Brinkmann zu verstehen? Überhaupt: Diese nicht immer konsequent durchgezogene Trennung der Komposita – »lebens- hilfe«, »die vogel perspektive«, »im // hinter zimmer (flimmer quadrat)« und so fort – sind wir da nicht gleich schon bei Jean Krier angelangt? Stellt sich nun die Frage: Was stellt Reyer in ihren referenzreichen Texten mit diesen ganzen möglichen Assoziationen an? In welche Kontexte bettet sie sie? Und gelingt es ihr schlussendlich, den viel zu oft gelesenen Metaphern und Phrasen noch Leben zu entlocken?
Kurz gesagt: Nein. Keineswegs. Nicht in einer einzigen Zeile. Was sich ohne Mühe entweder als Spiel mit den Erwartungen einer in moderner Lyrik zumindest oberflächlich vertrauten Leserschaft oder aber als liebevoller Tribut an die großen Vorbilder interpretieren ließe, findet leider in Gedichten statt, die nicht nur viel bemühte Topoi – Liebe, Sex, Kindheit, Weltschmerz – abhandeln, sondern auch selten angerührte Themen wie Depression (»liegen bleiben. / in tage gepresst. // zwangs jacken sekunden. / aufgeplatzt. aus der // sicheren kapsel gespuckt: / stuck an den // wänden«) oder neurologische Erkrankungen (»ringende arme / körper shake / herzens epilepsie // auch ohne / halte seile / kannst du nicht // loslassen«) mit ihrem Pathos und ihrer Fabulierlust in die Bedeutungslosigkeit hinab reißen. Am Ende lässt sich alles auf Empfindsamkeit – das große Klischee, von dem die Lyrik so schlecht wegzukommen scheint – reduzieren lassen.
Selbst, wenn es zumindest ansatzweise politisch oder sozialkritisch wird, verfallen die Gedicht doch nur wieder in einen lamentierenden Duktus. Fragen aufwerfen ist Reyers Sache ebenso wenig wie Antworten zu liefern – die Beschwerde reicht, über die reine klagende Selbstbezogenheit des lyrischen Ichs oder des angesprochenen Dus geht kaum eines der Gedichte hinaus. Eine kurz skizzierte Szene, mit bedeutungsschwangeren Metaphern aufgeladen und resignativer Pointe findet sich in nur:
blumenköpfe, die auf den gehsteigen
liegen. rostige rosen und anderer abfall.
spielt wer herzweh auf dem armaturenbrett
deiner konditionierungen, schattenrisse im
bewusstsein, ranzig, das dazwischen immer
aufgeschoben. blecherne himmel. nur das
licht des fernsehapparats hält dich warm.
Klischeehafte Bilder treffen auf mehr oder minder wahlloses Pathos. Das ist nicht mal sprachlich elegant in Szene gesetzt und natürlich schalten sich schnell die Geschmacklosigkeiten ein: »wir denken wir wären die / anderen und bleiben / bildschirm gesichter // wir sagen es / keinem wir haben / hitler im herzen«, heißt es an anderer Stelle. Im Gedicht fukushima lässt sich Reyer sogar zur Phrase »die schlitze der augen« hinreißen. Was hier provoziert, ist aber kein wohlüberlegter Gestus, Reyer tritt niemandem auf den Schlips, um zum Nachdenken anzuregen. Es steckt eine zeigefingernde Selbstgefälligkeit in diesen Versen, die ihresgleichen sucht – und vermutlich sogar findet. Gerade das Gedicht über das konsequente Schweigen der japanischen Regierung über die Vorfälle und lebensbedrohlichen Nachwirkungen der Reaktorkatastrophe vor zwei Jahren adressiert einerseits tatsächlich ein Problem, aber die nach und nach fallenden Vorurteile beziehungsweise, na ja, Klischees (»weiße lappen vor den mündern«) und aufgebauschten Sensationsmeldungen (»ein kaninchen, ohne ohren geboren«) sind nicht als Appell zu verstehen. Sie kommen viel eher einer Selbstversicherung gleich: Wir wissen es besser. Wir haben nicht »hitler im herzen«, wir sind andere, das heißt, andere als die anderen, die die Hölle sind.
Reyers Gedichte versickern in einer obskuren Art von Lethargie, der nur zu einfach mit Apathie geantwortet werden kann. Nochmal: »wir denken wären die / anderen« – die Gedichte aus die gezirpte zeit scheinen eben gerade für dieses, wenn nicht sogar aus diesem Denken heraus geschrieben worden zu sein. Sie zeichnen ein bitteres Bild von der Welt, halbwegs wortgewandt aufbereitet, damit wir uns daran ergötzen können. Das ist vielleicht das größte Klischee, das Reyer nicht zu umgehen weiß: Die Tatenlosigkeit ist bei ihr Dauerzustand. Lyrik, die klagt und es bei der Klage belässt. »es wird totgeschwiegen«, endet fukushima. Hier wird alles totgelabert, aus einem Überlegenheitssinn heraus. Lyrik von einer, die Hitler nicht im Herzen trägt für Menschen, die Hitler nicht im Herzen tragen.
So reproduziert Reyer auch auf den zweiten und dritten Blick nichts als Klischees. Auf sprachlicher Ebene, weil sich die Zitate nicht als smart angelegtes referentielles Netzwerk entpuppen, sondern nur von Epigonentum zeugen. Das muss vielleicht nicht gleich mit Einfallslosigkeit gleichgesetzt werden. Trotzdem wirft es die Frage auf, welchen ästhetischen Genuss, poetischen Mehrwert oder intellektuellen Anstoß dieser Band überhaupt bietet. Oder ob es sich überhaupt lohnt, sich darüber Gedanken zu machen. Hinsichtlich der inhaltlichen Fehltritte, die sich die gezirpte zeit leistet, sollte die Antwort klar sein.
Sophie Reyer: die gezirpte zeit. Broschur, 64 Seiten, 16,50 Euro. ISBN: 978-3-85028-576-6. Berger Verlag, Horn 2013.
Kristoffer Cornils hat zuletzt über Analog von Thomas Meinecke auf Fixpoetry geschrieben.
© Fixpoetry.com 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com
Sie können diesen Beitrag gerne verlinken