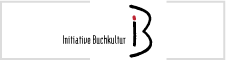Der schräge Blick von unten – Genazino in den Augen des Feuilletons
5. Juni 2004 | Von WT | Kategorie: AllgemeinVerschrobenheit ist eine Tugend des Schwebeforschers und Zweifelschützers. Der Ausserirdische Flaneur mit dem Rucksack schreibt auf leisen Sohlen mit dem schrägen Blick von unten Kontemplatives für die Ewigkeit: Trostbücher für eine ungewisse Zukunft. So lässt sich die Reaktion des deutschen Feuilletons auf die Verleihung des Georg-Büchner-Preises an Wilhelm Genazino zusammenfassen.
In der ‘Süddeutschen Zeitung’ resümiert Thomas Steinfeld:
[...] “Zu den Ausserirdischen, die der Film “Men in Black” in unserer Welt ansiedelt, gehört ein etwas träger, biederer, unauffälliger Geselle, der einen Rucksack trägt. Bei manchen, meist unerwarteten Gelegenheiten schnellt ein skurril-hässlicher Drachenkopf daraus hervor, ein überwaches, gnadenlos aufmerksames, ja sogar bösartiges Wesen. Manchmal geraten die beiden Hälfte dieser Doppelexistenz aneinander. Doch dann ist es stets das unscheinbare Wesen, das gewinnt und seine spektakuläre andere Seite in den Rucksack zurück stopft.
Könnte man diesem Wesen das auftrumpfend Sensationelle nehmen, könnte man es zurückführen auf das Alltägliche und Gewöhnliche in einer mittelgrossen westdeutschen Stadt, auf ein Leben mit Trottoir und Strassenbahn – vielleicht hätte man dann den¸”anteilnehmenden Abwesenden”, also den Schriftsteller Wilhelm Genazino vor sich.
[...] Doppelwesen und ein wenig unirdisch sind alle Helden von Wilhelm Genazino. Es sind Menschen, die sich von den scheinbaren Notwendigkeiten des Erwerbslebens , auch wenn sie ihnen Tribut zollen, gelöst haben und zu Beobachtern geworden sind – und dabei nicht zuletzt zu Beobachtern ihrer selbst.
[...] Es ist ein auch unter Dichtern beliebter Gedanke, die Vogelperspektive sei eine der Literatur besonders förderliche Art der Betrachtung – Günter Grass etwa ist davon überzeugt. Andere Schriftsteller sind der Meinung, man müsse den Dingen und Menschen geradewegs ins Auge sehen, aus möglichst geringer Distanz – Martin Walsers etwa. Wilhelm Genazino hingegen hat einen anderen Blick kultiviert: Was ihm begegnet, sieht er von schräg unten an. So verleiht er den Dingen der Welt, den ausserordentlichen (selten) wie den ordentlichen (häufig), Grösse, Leben und Überlegenheit.
[...] Harmlos wirken daher die Helden und Ich-Erzähler bei Wilhelm Genazino. Sie neigen zum Plaudern, sie verwischen den Unterschied zwischen Erzählen und Reflektieren, sie fühlen sich im Epischen unwohl und suchen die kleine Form. Doch es wäre falsch, dieses Parlando – ein Erbstück von Robert Walser vielleicht – für eine gutartige Angelegenheit zu halten. Denn was die Figuren in diesen Geschichten beobachten und bedenken, scheint, inklusive ihrer selbst, im Nichts aufgehängt, einem erbarmungslosen Existentialismus unterworfen zu sein. Das stetig Beglückende, das die Lektüre von Genazinos Büchern begleitet, ist nur deshalb von so ergreifender Wirkung, weil sich darunter eine so schwarze Leere auftut.
[...] Weil er nichts beschönigen, nichts verfälschen, nicht lügen will. Zack – da hat ein Drachenkopf hervorgeguckt und ist gleich wieder im Rucksack verschwunden. Das ist die grosse Kunst des Erzählers Wilhelm Genazino. Wir gratulieren.”
In der ‘Tageszeitung’ (taz) beschäftigt sich Gerrit Bartels mit der Überraschung, die Genazinos Roman “Ein Regenschirm für diesen Tag” bei Publikum und Kritk seinerzeit auslöste.
“[...] Als Wilhelm Genazino vor drei Jahren mit seinem Roman “Ein Regenschirm für diesen Tag” ausgerechnet vom Literarischen Quartett entdeckt wurde, sorgte das allerorten für eine gelinde Überaschung. Das grosse Publikum war überrascht, weil es Genazino überhaupt nicht kannte – obgleich der 1943 in Mannheim geborene Schriftsteller seit Anfang der Siebzigerjahre regelmässig Romane veröffentlicht und in den späten Siebzigerjahren mit seiner “Abschaffel”-Trilogie präzise die Welt der kleinen, vor allem männlichen Büroangestellten beschrieben hatte.
Und der Literaturbetrieb wunderte sich, dass Genazino mit “Ein Regenschirm für diesen Tag” tatsächlich Erfolg an den Buchhändlerkassen hatte – so leise war das Buch, so fein hingetuscht war es.
[...] Die Kritik glaubte nicht, dass sich in Genazinos Figuren ein grösseres Publikum wiederfinden könnte. Auch sie fand zuweilen in seinen neueren Büchern eine “Vielzahl belangloser Momentaufnahmen” oder “bedeutungsloser Prosabausteinchen”, bevor sie ihn Ende der Neunzigerjahre endgültig für sich entdeckte.
[...] Wilhelm Genazino ist ein Mythologe des Alltags. Seine Figuren, kleine Angestellte, Schuhtester, aber auch arbeitslose Intellektuelle, sind meist ein wenig angeschlagen und Leid gewohnt. Das aber hält sie nicht davon ab, sich in alltäglichen Details zu ergehen, ja sich gerade in ihnen zu verlieren und am Wegesrand der grossen Städte die tollsten Wahrnehmungen zu machen.
[...] So versteht es Wilhelm Genazino, in seinen Büchern kleine Dinge gross zu machen. Kontemplation in Ewigkeit. Trostbücher für eine ungewisse Zukunft.”
Hubert Spiegel sieht in der FAZ den Schwebeforscher und Zweifelschützer am Werk und zollt der Beharrlichkeit Genazinos seinen Respekt.
“[...]. Mit geradezu eisern anmutendem Griff hält Genazino die Dinge, die er beschreibt, in der Schwebe. Weniger, weil sie dort hübscher aussehen und besser zu beobachten sind, als vielmehr, weil sie seiner Ansicht nach dort hingehören. Für Wilhelm Genazino ist der Schwebezustand der natürliche Lebensraum der Dinge, aber auch der Menschen. Das Eindeutige ist immer ein Konstrukt, ein fauler Kompromiss, der geschlossen wurde, um das Leben erträglicher zu machen. Denn es gehört ja auch Mut und Kraft dazu, sich einzugestehen, dass wir nie so recht wissen, was eigentlich los ist.
[...] Zweifel werden von Genazinos Figuren nicht ausgeräumt, sondern ausgehalten, ja, sie werden sogar liebevoll gehegt und gepflegt, als gehörten der Zweifel, das Ungewisse, das Vieldeutige einer vom Aussterben bedrohten Tierart an.
[...] Wie wenige Autoren neigt Genazino dazu, seine Poetik offenzulegen und sein literarisches Programm auszustellen. [...] Wie Thomas Mann ist der leidenschaftliche Spaziergänger Genazino der Ansicht, literarische Phantasie erweise sich nicht in der Erfindungskraft, sondern in der Fähigkeit, sich aus den Dingen etwas zu machen.
[...] Respekt vor Genazinos Beharrlichkeit
Fast vierzig Jahre ist es her, dass Wilhelm Genazino, damals dreiundzwanzig Jahre alt, in dieser Zeitung eine kurze Erzählung mit dem Titel “Napoleon” veröffentlichte. Sie handelt von einer Frau, die ihren betrunkenen Mann in einen Bus schleppt, aus dem sie ihn einige Haltestellen später wieder hinausbugsiert. Hinten, in einer der letzten Reihen, sitzt der Erzähler; er “sah von allen Fahrgästen nur den Hinterkopf”. Jetzt wird diesem beharrlichen Beobachter der bedeutendste deutsche Literaturpreis zugesprochen, der mit 40 000 Euro dotiert ist. Keine seltsame Entscheidung, sondern eine, die Respekt bezeugt vor der Dauer dieses Werks und der Beharrlichkeit, mit der sein Schöpfer das grenzenlose Recht auf Unentschlossenheit verteidigt.”
Uwe Wittstock in der ‘WELT’ beschreibt den Verfechter der literarischen Moderne, der mit seiner inneren Stimme spazieren geht.
“[...] Man hat Genazino gern einen literarischen Flaneur genannt, einen poetischen Stadtwanderer, der seine Figuren gern ruhe- und auch ein wenig ziellos durch die Strassen unserer Gegenwart streifen lässt. Es ist nicht das wohl organisierte Leben einer modernen Gesellschaft, das seine Helden auf ihren einsamen Ausflügen interessiert. Ihr Blick fällt vielmehr regelmässig auf die unbedeutenden Randerscheinungen, die beiseite geschobenen Reste, auf funktionslose Details oder verunglückte kleine Gesten unbekannter Passanten.
[...] Anders jedoch als Walter Benjamin etwa, der als Grossstadtflaneur in der metropolitanen Flut flüchtiger Impressionen schwelgte, litten Genazinos Helden lange unter dem für sie mausgrauen Wust trister Normalität. Da Genazino zudem in seinen frühen Romanen streng darauf achtete, auch nicht die geringste Spannung aufkommen zu lassen, war die Lektüre seine Bücher kein Vergnügen für jedermann.
[...] Doch Genazino zielte mit seiner Prosa nicht auf eine sozialkritische Literatur der Arbeitswelt. Ihm ging es, so zeigten seine folgenden Romane, vielmehr darum, in der Tradition der literarischen Moderne schreibend Wirklichkeitsbereiche auszukundschaften, die von unserem Alltagsbewusstsein üblicherweise ausgeblendet werden. Doch ganz allmählich begannen Genazinos Figuren neben den schäbigen und faden Aspekten des Lebens auch dessen heitere und lockende Seiten zu entdecken.
[...] Es gibt Schriftsteller, und zu ihnen gehört der gestern gekürte Büchnerpreisträger des Jahres 2004, die mit einer inneren Stimme spazieren zu gehen scheinen. Man verbindet mit ihnen, ganz unabhängig vom Thema, dem sie sich gerade widmen, eine Melodie und eine Farbe, und auch: ein Licht.”
In der Frankfurter Rundschau revidiert Ina Hartwig ihre Fehleinschätzung, die sie dem Preisträger gegenüber hegte.
“[...] Genazino war auf diese [Gegenwartsliteratur] nicht besonders gut zu sprechen, und so habe ich den falschen Eindruck gewonnen, in ihm einen Nostalgiker sehen zu müssen. In Wirklichkeit gibt es kaum einen Schriftsteller, der so realitätsnah erzählt wie Wilhelm Genazino; doch nimmt er sich die Freiheit, die Realität ein bisschen, so weit es der Vorstellungskraft eben möglich ist, mit- und umzugestalten. Hierzu nützt ihm die wegen ihrer Langsamkeit altertümlich anmutende Haltung des Flaneurs ungemein. Der Flaneur darf nämlich auch wegschauen, während die meisten Schriftsteller heute ja vom Hinsehenmüssen infiziert sind.
[...] Das Verhältnis zwischen dem Autor und seinem Leser rückte ins Zentrum seines Interesses: “Inmitten der totalen Zerstreuung, die uns beherrscht, spekuliert das vereinzelte Kunstwerk auf einen ebenso vereinzelten Rezipienten, damit im Augenblick des Aufeinandertreffens beider Isolation traumhaft und momentweise verfliegt”, sagte er in seiner Vorstellungsrede bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Dieselbe Akademie zeichnet in Wilhelm Genazino jetzt – nach dem Multikünstler Alexander Kluge im letzten Jahr – wieder einen waschechten Schriftsteller mit dem renommiertesten, mit 40 000 Euro dotierten, deutschen Literaturpreis aus.”
Um Artikel über soziale Netzwerke weiterzuverbreiten, müssen Sie diese aktivieren - für mehr Datenschutz.