«Grenzen der Macht» von Andrew J. Bacevich
Petra Bohm | Posted 26/01/2010 | Politik und Gesellschaft | Keine Kommentare »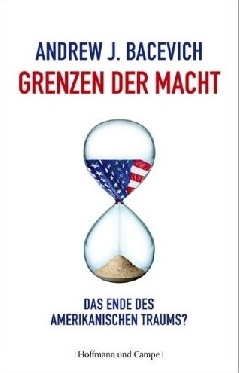
Obama unter Druck
«Obama unter Druck» könnte die aktuelle Schlagzeile in den Medien lauten. Tatsächlich setzt die in den USA grassierende Angst vor dem Terror den US-Präsidenten unter Erfolgszwang. Afghanistan, Pakistan und jetzt der Jemen stehen auf der Liste der Länder, aus denen Terrorverdächtige stammen könnten. Die Amerikaner verlangen von ihrem Präsidenten Härte. Aber welche Erfahrung kann Barack Obama in dieser von vielen Amerikanern als Schicksalsfrage empfundenen Angelegenheit aufweisen? Andrew J. Bacevich findet in seinem Buch «Grenzen der Macht» auf diese Frage recht kritische Antworten.
Wenn Obama mit seiner mangelnden Erfahrung mit dem Komplex der nationalen Sicherheit einen neuen Kurs in der Antiterrorismusbekämpfung einschlagen wolle, «hat er sich eine geradezu beängstigende Aufgabe gestellt», schreibt der an der Boston University lehrende Zeithistoriker. Sein provokantes Werk hat in den USA viel Empörung hervorgerufen und wurde dort ein Bestseller.
Bacevich erinnert daran, dass aus Obamas Wahl ein ebenso tief sitzender wie weit verbreiteter Wunsch gesprochen hat, mit allem, wofür Washington in der Ära von George W. Bush gestanden hatte, zu brechen. Allerdings sieht der Autor Abweichungen des Obama-Kurses von dem seines Amtsvorgängers nicht in den Grundsätzen, sondern nur in den operativen Prioritäten. Im Gegensatz zu all dem, was in vielen Tageszeitungen oder im Fernsehen bis dato zu lesen und zu sehen war, stellt Bacevich fest: «Nie stellte Obama die Klugheit einer Fortsetzung des von Bush ersonnenen globalen Krieges offen infrage; er vermittelt nur den Eindruck, dass er diesen Krieg effizienter führen wird.»
Die Sehnsucht Amerikas nach einem Wandel könne jedoch nicht durch ein bloßes Lavieren von Steuerbord nach Backbord befriedigt werden. Der jetzige Präsident der USA habe einen Wandel angekündigt, darauf vertrauten nicht nur die Amerikaner und ihre Verbündeten. Doch entsprechende Ankündigungen blieben leere Parolen, wenn bezüglich der nationalen Sicherheit das Staatsschiff weiter mit den Navigationskarten gesteuert werde, die veraltet seien.
Bacevich benennt die allgemeine Verunsicherung darüber, wohin das amerikanische Schiff unter US-Präsident Obama steuert. Zumal die Furcht vor Terrorismus keineswegs kleiner werde. Dass Obama einen Weg aus der aktuellen Lage, wie dem Krieg in Afghanistan, findet, dies wünschten nicht nur seine Anhänger. Dazu seien aber nicht nur Ideen notwendig, sondern auch die Leute, die diese Ideen umsetzen werden. Für den Autor bleibt es fraglich, ob sich Obamas führende Mitarbeiter als Akteure eines echten Wandels erweisen, oder ob sie sich, wie es in Washington schon oft der Fall gewesen sei, mit Flickwerk begnügen werden.
Bacevich erinnert daran, dass Michelle Obama, First Lady der USA, Hillary Clinton als Außenministerin und sein Nationaler Sicherheitsberater James Jones trotz ihrer beeindruckenden Lebensläufe «Gestalten des Establishments mit absolut konventionellen Ansichten» seien.
Die Vereinigten Staaten besitzen nicht mehr genügend Reserven an harter Macht und auch an Geld, um die Welt zur Anpassung an ihre Wünsche zu zwingen, warnt der Verfasser. Das Land müsse die Grenzen seiner Machbarkeit erkennen. Anhand vieler Fakten konstatiert der Historiker, dass die USA wirtschaftlich, militärisch und administrativ am Ende seien. Sollte Obama jedoch dem Irrglauben erliegen, dass die Lebensweise in den USA sakrosankt und deren Macht unbegrenzt sei, werde die Hoffnung auf ein besseres und friedlicheres Leben mit Sicherheit in Enttäuschung umschlagen, warnt er.
© Susanna Gilbert-Sättele/dpa









