Ganz anders – aber genauso gut!
Petra Bohm | Posted 15/11/2011 | Belletristik | 1 Ein Kommentar »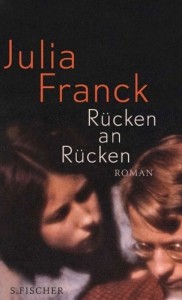 Wie beim aktuellen Buchpreisträger Eugen Ruge in “Zeiten des abnehmenden Lichts” spielt Julia Francks neuer Roman in den 50er und 60er Jahren in Ostdeutschland. Eine ziemlich dunkle Familiengeschichte, die mich 380 Seiten lang gefesselt hat…
Wie beim aktuellen Buchpreisträger Eugen Ruge in “Zeiten des abnehmenden Lichts” spielt Julia Francks neuer Roman in den 50er und 60er Jahren in Ostdeutschland. Eine ziemlich dunkle Familiengeschichte, die mich 380 Seiten lang gefesselt hat…
Besonders die Figur der wirklich fiesen Mutter hat mich mitgenommen. Die ist in Julia Francks Romanen ja nicht neu, doch während in der “Mittagsfrau” die Mutter jedenfalls teilweise sympathisch und herzlich daher kommt, ist “Käthe” nur hämisch und verbirgt ihre Egozentrik unter dem Deckmäntelchen der engagierten Künstlerin.
Und darum geht’s:
Ostberlin, Ende der 50er Jahre. Protagonisten sind die Bildhauerin Käthe und ihre beiden Kinder Ella(11) und Thomas(10). Käthe hat sich für das kommunistische Deutschland entschieden und vertritt leidenschaftlich die Erfindung einer neuen Gesellschaft. Ebenso leidenschaftlich gibt sie sich ihrer Kunst hin, der sie alles unterordnet. Auf der Strecke bleiben dabei ihre Kinder, die mehr oder minder auf sich allein gestellt aufwachsen. Gegen die Mutter und deren schroffen Umgangston können sie sich nur schwer behaupten. Beide sehr sensibel, geben sie sich gegenseitig halt – Rücken an Rücken. Ella flieht mal in Krankheit, manchmal flackert Aufbegehren, Thomas flüchtet zunächst in die Beziehung zu seiner Schwester und dann in eine unglückliche, tragische Liebe.
Von Anfang an spürt man es – und die dunkle Ahnung nimmt im weiteren Verlauf zu – dass Julia Franck kein Happy End für ihre Leser bereit hält. Berührend auch, wie die Kinder immer wieder nach Entschuldigungen für die trotz allem geliebte Mutter, nach einer anderen Wahrnehmung für die Realität der Verletzung suchen. Doch die Figuren bleiben nicht eindimensional – haben ihre Brüche. Da gibt es noch die jüngeren Zwillinge – kleine Geschwister, für die sich Ella und Thomas so wenig interessieren wie ihre Mutter für sie selbst. Auch Käthes Vergangenheit hat Spuren in ihrer Seele hinterlassen, die ihr Verhalten zwar nicht entschuldigen, aber in Teilen erklären.
Wie nebenher zeichnet Julia Franck so auch das Bild einer Epoche, von Krieg und Nachkriegszeit und vom eingeschränkten Leben in der frühen DDR. Sie erzählt eine Familiengeschichte, die zum Zeitroman wird.
Übrigens: auch dieser Roman kann autobiografische Bezüge nicht verleugnen: Julia Francks Großmutter war Bildhauerin, sie selbst hat ihre Kindheit teils im Heim, teils in Pflegefamilien verbracht.











„Niemand habe ein Recht auf Liebe und Schutz!“ Ein Leitsatz von Käthe, Jüdin, Überlebende der faschistischen Auswüchse Nazi-Deutschlands, politische Linientreue der DDR zum Ende der fünfziger Jahre und letztendlich Mutter von Ella und Thomas.
Dieser Leitsatz prägt die gesamte Handlung des Romans, in dem ein schockierendes Leid dem nächsten folgt. Ella und Thomas leiden Hunger und Kälte, werden von Käthe nicht wahrgenommen. Ihre Körper werden benutzt, Ellas sexuell von mehreren Männern seit ihrer Kindheit und Thomas’ als Material, als Model für Käthes zu schaffende Körper. Jeder Versuch der Kinder und später Jugendlichen, Käthes Aufmerksamkeit zu erringen, etwas Wärme und Liebe von ihr zu bekommen, scheitern. Lediglich Ella und Thomas geben sich halt, „Rücken an Rücken“ sitzen sie beisammen, stützen sich, entfliehen dem Geschehen in Träumereien, wobei Ella die Erzählende, Thomas der Zuhörer ist. Als beider Leid nicht mehr aushaltbar ist, wehren sich auch die Körper und die Psyche. Ella verarbeitet ihr Leid durch extremste Hautkrankheiten und geistige Flucht, kommt schließlich in eine Nervenklinik zur Erholung, nicht jedoch zur Behandlung oder gar Ursachenforschung. Thomas bricht unter den Demütigungen seiner Umgebung irgendwann zusammen, sieht kurz eine Hoffnung in der Liebe zu Marie, nimmt sich aber letztendlich zusammen mit ihr das Leben, weil beide nach dem Mauerbau keine Perspektive, keine Änderung der Verhältnisse mehr erkennen können.
Die Handlung um Ella und Thomas kann als Wiederholung der Biographie Käthes gesehen werden, auch sie vom Vater nicht beachtet, auch sie von Männern benutzt, wenn auch aus anderen Motiven heraus.
Julia Franck macht es dem Leser nicht einfach, inhaltlich nicht aber auch sprachlich ist dem Roman zeitweise nur schwer standzuhalten. Sie schreibt in den entsprechenden Passagen aus Sicht der beiden jugendlichen, behält dabei auch deren Sprache, die größtenteils sehr ungeschliffen ist. Am Anfang, in einigen Teilen des Romans und am Ende sind Gedichte von Thomas eingefügt. Auch diese sehr bemüht in der Sprache des Jugendlichen bzw. jungen Mannes. Auf der letzten Seite ist vermerkt, dass die verwendeten Gedichte dem Nachlass von Gottlieb Friedrich Franck entnommen sind, gestorben 1962 im Alter von 18 Jahren. Auch Thomas nimmt sich mit 18 Jahren das Leben, eine erneute Übernahme aus dem familiären Umfeld der Autorin scheint stattgefunden zu haben. Das ist der Autorin in ihrem prämierten Buch „Die Mittagsfrau“ m. E. nach wesentlich besser gelungen.