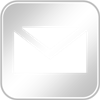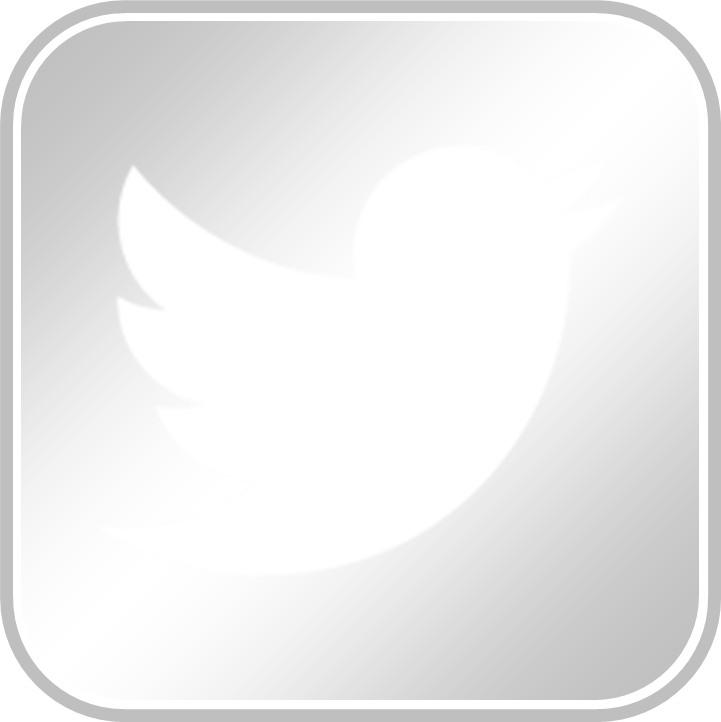-
Das sind allein die Artikel, die es in den letzten Stunden auf die Startseite von Rivva geschafft haben. Jeder dieser Artikel hat hunderte von Tweets und Facebook-Likes erhalten. Keiner dieser Artikel stellt die Sachlage korrekt dar.
Google News zählt aktuell allein 1.820 Artikel mit den Wörtern “Instagram” und “verkaufen”.
Wird einer der Autoren irgendwann darüber berichten, dass Instagram doch keine Nutzerfotos verkauft? Haben sie sich die Debatten zu anderen ToS-Änderungen angeschaut und darauf hingewiesen, dass die damals beschriebenen Horrorszenarien nicht eingetreten sind, weil dieser Vergleich einen sinnvollen Kontext herstellen würde?
Denn es passiert immer wieder und die Journalisten, die die Experten sein sollten, die dem im Social Web aufgebrachten Volk erklären, was genau gerade passiert, gehören selbst zu den aufgebrachten Laien.
Die in den meisten Artikeln zur Schau gestellte, hirnrissige Sichtweise auf Webdienste, die tief im Wesen vieler deutscher Journalisten verankert zu sein scheint, informiert die Bürger nicht nur falsch und hat mit gesundem Menschenverstand nichts mehr zu tun, sie ist, glaube ich, auch ein Beweis dafür, warum die Reihen in den Redaktionen beim Thema Leistungsschutzrecht trotz der begleitenden Skandale so geschlossen sind.
Wer sein Wissen über die Internetwirtschaft aus Titelstories im Spiegel und Focus und den Ressorts von Welt bis Süddeutsche bezieht, der bekommt ein erstaunlich einheitliches, verzehrtes Bild: Im Silicon Valley sitzt der amerikanische Feind, der seine Nutzer, diese willfährigen Sklaven, die man vor sich selbst retten muss, ausnutzt, wo es nur geht. Die kalifornischen Datenkraken spähen ihre Nutzer aus und wollen jedes Datenfitzelchen an jeden verkaufen, der sie haben möchte. (Entgegen den deutschen Datenkraken natürlich.) Mit ihrem Erzkapitalismus walzen sie ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Gefangene zu machen über unsere deutschen Unternehmen, die sich doch bemühen, nach Regeln zu spielen, die für die Amis nicht gelten. Die halten sich ja nicht einmal an Gesetze! Google klaut! Die ganze Zeit! Google News nimmt unsere Artikel und macht damit, was es will. Und die anderen sind bestimmt auch nicht besser! Das liest man seit Jahren in jeder Zeitung, also muss es stimmen.
Seit Jahren amüsieren wir uns über oder verzweifeln wahlweise an dieser Berichterstattung. Je renommierter eine Publikation in Deutschland, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den letzten Jahren sehr viel einseitigen und oft offensichtlich faktisch falschen Quatsch über Internetunternehmen veröffentlicht hat.*
Manche stricken wildeste Verschwörungstheorien, warum das geplante Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse, das doch in den Augen von uns, die sich täglich im Web bewegen, so offensichtlich fehlgeleitet ist, trotzdem von den führenden Presseverlagen und ihren Redaktionen vorangetrieben wird.
Dabei ist die Antwort so einfach wie schrecklich: Die überwiegende Mehrheit der deutschen Journalisten hat ein simples, verzerrtes Bild vom Web und den Unternehmen darin. Dieses Bild ist überwiegend negativ bis maximal skeptisch und zeigt sich jedes Mal, wenn über Webdienste berichtet werden muss. Denn dieses Bild formt natürlich Berichterstattung über und Haltung zu allen Internetthemen.
Die deutsche Presse ist mehrheitlich auch nach Jahren nicht in der Lage, halbwegs objektiv über erfolgreiche, also große, in der Regel aus den USA kommende Webdienste zu berichten. Das lässt sich nur mit Vorurteilen gegenüber der Internet-Branche erklären.
Wenn dank eines Leistungsschutzrechts auf user generated content setzende Plattformen wie Instagram, Tumblr oder Twitter aus Deutschland verschwinden würden, weil sie der Lizenzzahlungspflicht nicht nachkommen wöllten, was wäre dann daran so schlimm? Das deutsche Volk würde damit als Nebeneffekt noch dafür beschützt, sich von diesen Diensten ausbeuten zu lassen. Und überhaupt, sind das nicht sowieso alles Klowände, die unserer Hochkultur eher schaden? Im besten Fall sind es Spielzeuge, auf die wir auch verzichten können, wenn der Preis der Erhalt unserer Presse (und, hoppla, wie passend, unserer Arbeitsplätze) ist.
Was wir viel zu lang in seiner Tragweite vielleicht nicht ernst genug genommen haben, ist eine täglich sichtbare Schere, die wir wie den Wald vor lauter Bäumen nicht wahrhaben wollten:
Die Webfeindlichkeit der meisten deutschen Journalisten, worin auch immer sie begründet sein mag, ist das größte Hindernis für Deutschland als Wirtschaftsstandort als auch als Gesellschaft auf dem Weg in ein 21. Jahrhundert. Diese Webfeindlichkeit ist in den letzten Jahren aufgrund der wirtschaftlichen Probleme der Verlage nicht zurückgegangen.
Das geplante Presseleistungsschutzrecht ist die furchteinflößendste Folge dieser destruktiven Einstellung der deutschen Presse.
Aber wir können die Resultate auch an vielen anderen Stellen sehen.
Etwa daran, dass der Politik auch 2012 das Internet noch mehrheitlich egal war. Oder daran, dass die Rahmenbedingungen für Internetunternehmen von Datenschutz über Button-”Lösung” im E-Commerce bis hin zu Cookie-Gesetzen (auf von Deutschland gesteuerter EU-Ebene) und Abmahnwahn dank Impressumswahn tendenziell eher schlechter statt besser werden. Und man kann es eben auch sehen an der schlicht falschen Berichterstattung en masse, wann immer ein Social-Web-Dienst seine ToS ändert, an die Börse geht oder Microsoft eine Studie veröffentlicht.
Wir haben keine angemessene Berichterstattung über diese Themen, weil die Expertise der damit beauftragten deutschen Journalisten so aussieht, dass sie mehrheitlich glauben, ein Webdienst, der darauf angewiesen ist, dass dessen Nutzer ihre Fotos hochladen, diese Fotos ohne Zustimmung der Nutzer an andere verkaufen wollen würde.
Zur Expertise der jeweiligen Journalisten zählt also nicht einmal grundlegende Logik.
-
*Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Zu diesen zählen wie immer bei diesen Themen die Publikationen des heise-Verlags, welche sich schon immer wohltuend vom Rest der deutschen Presselandschaft abgesetzt haben.