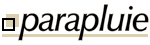
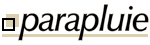 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 20: ohr
|
Kognitives Hörversagen |
||
von Thomas Wägenbaur |
|
Daß es einem in der täglichen Kommunikation eher um die Sicherung des eigenen Image zu tun ist, als seinem Gesprächspartner tatsächlich sein Ohr zu leihen -- diese profane Wahrheit tritt ans Licht, wenn man Anspruch und Realität der hohen Regeln der Konversation einmal gegenüberstellt. Ob unbewußt oder bewußt, häufig manipuliert man das Gespräch für die eigenen, egoistischen Zwecke. |
||||
Wenn es um Kommunikation geht, wollen wir in der Regel alles richtig machen, und das fängt mit dem Zuhören an. Merkwürdig ist nur, daß andere das anscheinend nicht immer so sehen. Und wie sehen die uns überhaupt? Vermitteln wir immer den Eindruck guter Zuhörer? Oft genug kommt es einem doch so vor, als ob man zwar miteinander spricht, aber keiner dem anderen zuhört -- so etwa auf Cocktailparties, Stehempfängen oder VIP-Apéros. Kommunikative Regel und Realität klaffen da weit auseinander, und die Kunst der Kommunikation besteht dann darin, den Eindruck erwecken zu können, als ob man, so wie's sich gehört, zuhört, gleichzeitig aber mit den Gedanken und den Sinnen ganz woanders zu sein. |
||||
Kognitives Hörversagen -- also Hören, ohne zu verstehen --, das ist etwas, was uns passieren kann, aber wir können es auch praktizieren, und es fällt meist schwer, hier Unschuld von Absicht zu unterscheiden. Wir können beim Hören versagen, aber wir können einem anderen auch das Zu-Hören versagen. Wenn wir kommunizieren, sollte uns natürlich daran liegen, den anderen zu verstehen, sich an dem, was das Gegenüber sagt, zu erfreuen, vielleicht etwas zu lernen oder gar schon durch bloßes Zuhören Hilfe oder Trost zu spenden. Auf keinen Fall sollte unser Schweigen, wenn wir zuhören, ohne solch unschuldige Absichten sein. Es sei denn, wir täuschen eine Unschuld vor, die voller Absichten ist, d.h. wir mimen das Zuhören und verfolgen dabei ganz andere Ziele. Verlassen wir also einmal die Pfade der regelrechten, kommunikativen Sittlichkeit und überlegen uns, wie unsittlich wir uns verhalten können, wenn wir die Regeln mißbrauchen -- denn eben das tun wir regelmäßig. |
||||
Wenn wir anderen unser unschuldiges Zuhören vortäuschen, können all dies unsere Absichten sein: Die anderen sollen denken, wir interessierten uns für sie, damit sie sich ihrerseits für uns interessieren. Man paßt nur darauf auf, ob der andere einen nicht vor den Kopf stößt oder sonstwie zu erkennen gibt, was er/sie wirklich von einem hält. Man interessiert sich nur für eine ganz bestimmte Information, und alles andere rauscht an einem vorbei. Man schindet Zeit, um den nächsten eigenen Beitrag zur Konversation vorzubereiten. Man hört dem anderen nur zu, damit der nachher einem selbst zuhören muß. Man läßt den anderen reden, um herauszufinden, wo der andere seine Schwächen hat, um dann so im Vorteil zu sein. Man achtet besonders aufmerksam auf die Argumentation des anderen, um ihm/ihr dann umso besser widersprechen oder ihn/sie richtig in die Pfanne hauen zu können. Man achtet darauf, wie das Gegenüber reagiert, um ja selbst die gewünschten Reaktionen hervorzurufen. Man hält jemandem sein Ohr hin, weil man eben nett sein möchte oder weil man den anderen nicht verletzen will. Sicher ist diese Liste unlauterer Kommunikationsabsichten nicht vollständig, aber sie steckt ungefähr den Rahmen ab für die folgenden Phänomene kognitiven Hörversagens, mit denen wir nur allzu vertraut sind. |
||||
Vergleichen: Einer, der sich ständig überlegt, ob der andere gescheiter, attraktiver oder besser situiert ist, wird sicher nicht intensiv zuhören. Stattdessen wird er zu sich selbst sagen: "Kann ich das auch? ... Ich könnte das besser ... Ich habe, weiß Gott, Schlimmeres durchgemacht ... Meine Freundin gefällt mir besser." |
||||
Gedanken lesen: Sie will wissen, was er eigentlich denkt, nicht, was er zu sagen hat, und denkt bei sich: "Er sagt zwar, er möchte mit ins Kino, aber wahrscheinlich hat er gar keine Lust und möchte nur nicht, daß ich ihn bitten muß." Gedanken lesen heißt, eher auf Intonation und körpersprachliche Zeichen zu achten als auf die Worte des anderen, um die Wahrheit herauszufinden. Die Gedankenleserin macht sich auch laufend Gedanken darüber, wie die Leute wohl auf sie reagieren mögen, und das rührt eher von eigenen Intuitionen und Vermutungen her als von dem, was der andere zu sagen hat. |
||||
Proben: Wer im Geiste sich schon mal überlegt, also probt, was er gerne sagen möchte, dessen Aufmerksamkeit für den anderen ist eingeschränkt. Man schaut zwar noch interessiert drein, aber wartet nur auf den richtigen Moment für die Aufführung der Sätze, die man sich bereits mehrfach vorgesagt hat. |
||||
Filtern: Jeder filtert, mehr oder weniger, was er hören will. Man muß nur so aufmerksam sein, um wahrzunehmen, ob der andere böse oder unglücklich ist oder ob man selbst sonstwie in emotionaler Gefahr ist. Ist das nicht der Fall, kann man die Gedanken laufen lassen. Solange es nichts Beunruhigendes ist, was die Freundin von der Arbeit berichtet, kann man sich gerne den eigenen mentalen Projekten widmen. Bei anderen ist es genau umgekehrt: Sie hören nur, was positiv ist und überhören mehr oder weniger geflissentlich, was negativ ist, und erinnern sich später auch nicht mehr daran. |
||||
Urteilen: Etikettierungen sind ein Ausdruck von Macht. Halte ich jemanden für blöd und zumindest für nicht qualifiziert, hat er von vorneherein keine Chance, mir etwas zu sagen. Wir haben ihn schon abgeschrieben, und er kann sagen, was er will. Auch wenn wir das, was wir hören, vorschnell als Quatsch oder zumindest als falsch bezeichnen, hören wir auf, zuzuhören. Dabei könnten wir erst am Ende der Rede des anderen den Inhalt wirklich beurteilen. |
||||
Träumen: Man hört nur mit halbem Ohr hin, aber auf einmal löst etwas, was die andere Person gesagt hat, eine private Assoziationskette aus. Jemand sagt, sie sei arbeitslos geworden, und du erinnerst dich an deine eigene Arbeitslosigkeit, während der du Zeit gehabt hast, eine Weltreise zu machen, was du übrigens wirklich noch einmal tun solltest etc. Während dann der andere zu dir sagt: "Ich wußte, daß du das verstehen würdest!", weißt du schon nicht mehr, wovon eigentlich die Rede war. Natürlich fängt man eher an zu träumen, wenn man sich im Gespräch langweilt oder man mit dem Kopf bei etwas anderem ist. Manchmal ist es ja auch wirklich unendlich schwer, dem anderen seine Aufmerksamkeit zu schenken. Aber über kurz oder lang merkt das unser Gegenüber und verabschiedet sich von uns, ohne von uns den besten Eindruck bekommen zu haben -- den zu hinterlassen wir offensichtlich auch nicht nötig hatten. |
||||
Identifizieren: Egal wovon ich erzähle, sie unterbricht mich sofort und erzählt davon, wie ihr genau das gleiche wiederfahren sei. Wenn ich über Zahnweh klage, kommt sie mir mit ihrer Zahnwurzelbehandlung und wie schrecklich das gewesen sei. Ihre eigenen Erfahrungen sind ihr so wichtig, daß sie nicht nur meine nicht interessieren, sondern sie mich eigentlich gar nicht wahrnimmt und also auch gar nicht kennenlernen kann. |
||||
Ratgeben: Er ist fixiert darauf, Probleme zu lösen, und egal wovon man auch erzählt, schon meint er, heraushören zu können, wo es klemmt, und meint, ich suche ihn um einen Rat nach. Aber im Grunde bekommt er von mir nichts mit, teilt meinen Schmerz nicht, und einfach nur für mich dazusein, ist für ihn undenkbar. |
||||
Streiten: Manche Leute suchen fortwährend verbalen Streit. Sie widersprechen immer, egal was man sagt, sie sind unfähig, auch einmal etwas so stehen zu lassen, wie es gesagt ist. Stattdessen erwidern sie mit "Nein, ..." und wiederholen dann häufig das Gesagte nur eben in ihren eigenen Worten. Richtig fertig machen kann man jemanden auch, wenn man generalisiert und die Konversation auf bereits bekannte und minderwertige Muster reduziert: "Nein, jetzt kommst du schon wieder mit dieser Maso-Masche", sagt er, wenn sie ihm anbietet, zu Hause zu bleiben, weil er keine Lust hat, ins Kino zu gehen, nur damit er daraufhin ihretwegen ins Kino gehen soll. Ähnlichen Streit programmiert auch ein Verhalten, welches jede Form von Kompliment ablehnt: "Nett, daß du das sagst, aber eigentlich war ich schlecht." Macht man sich hier selber klein, lehnt man nicht nur die Bewunderung des anderen ab, sondern würdigt ihn selbst auch herab. Indem man dem anderen die Autorität abspricht, einen einschätzen zu können, erteilt man sie sich selbst. |
||||
Rechthaben: Jeder verdreht mal die Fakten, fängt an lauter zu reden, kommt mit irrelevanten Anschuldigungen usw., nur um Recht zu behalten. Dann verträgt man keine Kritik, möchte nicht verbessert oder korrigiert werden, und für Alternativen ist man dann schon gar nicht offen. Unsere Überzeugungen sind dann unerschütterlich, obwohl eigentlich nur verbohrt. Nur wenn man seine Fehler nicht als solche zugibt, wird man sie weiterhin machen. |
||||
Ablenken: Plötzlich lenkt er vom Thema ab und kommt auf ein ganz anderes. Hat es ihn gelangweilt oder wurde es heikel? Vielleicht macht er einfach nur einen Scherz und redet dann von etwas ganz anderem, oder er schaut auf die Uhr und muß entweder gleich gehen oder noch von etwas anderem reden. Manchmal macht er nur noch Scherze, und das ist dann gar nicht mehr lustig, denn offensichtlich interessiert er sich überhaupt nicht dafür, wovon ich rede. |
||||
Jasagen: Das Gegenteil von Streiten ist Jasagen: "Ja, sicher ... Klar ... Ich weiß ... Da hast du Recht ... Unglaublich! ... Wirklich?" Nur um nett und angenehm zu wirken, sagt man gar nichts, sondern spielt nur Pingpong mit dem, was der andere gesagt hat. Damit geht man auf Nummer Sicher, und häufig genug denkt der andere tatsächlich, man habe sich wieder einmal gut unterhalten. In Wirklichkeit hat man gar nicht recht zugehört und schon gar nicht Anteil genommen, sondern sich nur möglichst unauffällig benommen. Wir wissen dann schon warum, entweder weil wir einen verschwiegenen Zweck mit dem Kommunikationspartner verfolgen, oder weil wir diese Kommunikation lediglich über uns ergehen lassen müssen. |
||||
Meist wissen wir in der Kommunikation unschuldige Absicht von hier skizzierter absichtsvoller Unschuld zu unterscheiden, aber so richtig sicher dürfen wir uns nie sein, denn schließlich sind wir selber nicht so recht in der Lage, sicherzustellen, daß der andere uns so sieht, wie wir gerne gesehen werden wollen: als ehrlichen oder auch als quasi intriganten Zeitgenossen. Es gibt darüberhinaus Situationen, wo es gerade gut ist, wenn dies nicht zu entscheiden ist, vor allem dann, wenn sich Kommunikation fortsetzen soll, wie z.B. wenn sich einer interessant machen möchte. Aber auch das wäre zu entlarven mit dem Effekt, daß eine Kommunikation auf ihre Weise beendet worden ist. |
||||
Zuletzt wäre noch zu fragen, wieso hier von "kognitivem Hörversagen" die Rede ist und nicht einfach nur von Hörversagen. Das Problem zwischen passivem Hörversagen und aktivem Versagen des Zu-Hörens ist eines der sehr alltäglichen Probleme, dem sich die Kognitionswissenschaft stellen muß, wenn sie auf allein neurologischer Basis oder über Computersimulationen mentale Funktionen biologisch oder funktional bestimmen will. Es handelt sich hier um eine Abart des freien Willens, den uns manche Hirnforscher absprechen möchten. Fern jedoch von aller Metaphysik wird sich dies als Problem der Physik wieder stellen: Auch wenn das Hirn unsere Hardware bleibt, läßt dieses kaum Schlüsse auf unsere entschieden personalisierte Software zu. Manchmal tun wir ja auch so, als ob wir nicht zuhörten, nur um umso aufmerksamer zu sein, ohne daß der andere es merkt. Es ist unwahrscheinlich, daß solche Simulationen von Kommunikation in nächster Zeit auf PET-Scans zu lesen oder am Computer zu rekonstruieren sein werden, aber dennoch handelt es sich um ganz normales kommunikatives Verhalten, das die doppelte Kontingenz zwischen Sprecher und Hörer immer weiter potenziert, weil gerade das den Reiz menschlicher Kommunikation ausmacht. |
||||
|
autoreninfo

Prof. Dr. Thomas Wägenbaur M.A. in Komparatistik, University of California/Berkeley; Ph.D. in Komparatistik, University of Washington/Seattle, 2000-2009 Prof. of Cultural and Cognitive Studies und Director of Liberal Arts an der International University in Germany/Bruchsal. Zur Zeit freier Dozent und Kommunikationsberater. Veröffentlichungen zu Literatur-, Kultur- und Medientheorie. Forschungsschwerpunkte: natürliche vs. künstliche Sprachverarbeitung (Philosophy of Mind); Postkolonialismus und Globalisierung; Kognition in der Entscheidungstheorie.
|
||||
|
|