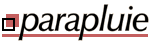
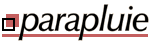 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 21: warschauer pakt
|
Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins oder die unsichtbare Hand des MarktesTschechien 15 Jahre nach der 'Samtenen Revolution' |
||
von Martina Zschocke |
|
Die Nachwendepolitik in Tschechien ist geprägt von zwei Präsidentschaften wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: der weltoffenen Pop-Politik von Václav Havel, gefolgt und begleitet von der ausschließlich marktorientierten und Europa-skeptischen Politik von Václav Klaus. Einen dritten Weg hat es in der Übergangszeit nach der 'Samtenen Revolution' auch hier nicht gegeben, dafür aber einen sehr eigenwilligen, sehr bunten und sehr böhmischen. |
||||
Wenn sie bei Milan Kundera nicht gestorben wären, würden sie wohl jetzt Rentner sein und irgendwo im Neubaugebiet in der Prager Südstadt wohnen oder in den neugebauten Häusern in Barrandov. Immerhin wieder in Prag. Die Wohnung haben sie vor ein paar Jahren gekauft. Teresa sieht aus dem Fenster, ihr Blick fällt auf den Carrefour-Supermarkt und ein paar sanierte Häuser. Tomas liest Lidové noviny und kann nur mühsam seine Wut über den Skandal um Premierminister Gross unterdrücken, dessen Immobilienankäufe zwischen windig und mafiös rangieren. Hin und wieder fotografiert Teresa noch für eine Werbeagentur. Und hin und wieder fragt sie sich auch, ob sie glücklich sind. Tomas fragt sich das schon lange nicht mehr. Sabina indes weigert sich beharrlich zurückzukehren. Von Zürich zog sie nach Paris und in die USA. Von dort nach Buenos Aires. Inzwischen lebt sie in Kanada. Ihre Bilder stellt sie immer noch aus. Wie viele tschechische Emigranten interessiert sie sich nicht mehr für ihre Heimat. Und ihre Heimat interessiert sich nicht mehr für sie ... So oder so ähnlich könnte Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins heute aussehen. |
||||
Um es gleich zu sagen: Auch ich habe beim Schreiben dieses Artikels geschwankt zwischen der unerträgliche Leichtigkeit und der unerträglichen Schwere des Seins. An meinem Fenster auf der Prager Kleinseite sitzend, blicke ich auf das überbordende Barock des Malteserplatzes und auf die Brückentürme der Karlsbrücke. Bin also mittendrin. (Inzwischen lebe ich seit drei Jahren in Prag, wo ich anfangs für einen Verlag arbeitete und seitdem für die Kulturredaktion von Radio Prag tätig bin.) Aber Prag ist nicht Tschechien. Und Politik ist nicht Kultur: Auch wenn in Tschechien Schriftsteller zu Politikern wurden. Doch es ist Frühling. Prager Frühling. Also fange ich damit an. |
||||
Der Frühling 1968 -- der genau genommen mit einer zunehmenden Lockerung der Verhältnisse 1964 begann und im Frühjahr 1968 kulminierte -- brachte nicht nur viel Schwung, sondern auch unendliche Hoffnungen mit sich: Bücher, die vorher in Schubladen lagen, konnten endlich frei veröffentlicht werden, unschuldig Gefangene der 50er Jahre (aus der Zeit des Slánský-Prozesses) wurden rehabilitiert, Radiosender spielten bisher verbotene Musik, alles kam in Bewegung: Demokratisierungsprozesse begannen unter der Reform-Regierung von Alexander Dubcek. Dubcek jedoch hatte nicht die Größe eines Michael Gorbatschow und auch sein Land hatte nicht die Größe und Macht der Sowjetunion. Der Traum von Demokratie und Freiheit endete schnell und schmerzhaft. Am 21. August, dem Tag an dem die ersten sowjetischen Panzer auf dem Wenzelsplatz eintrafen. Die tschechoslowakische Regierung unter Dubcek unterschrieb noch selbst die Kapitulation. "Die Hoffnung war von kurzer Dauer", schreibt der ehemalige Rundfunkredakteur Lubos Dobrovský, "die Demoralisierung aber dauerte zwanzig Jahre". Der Prager Frühling wich der Eiszeit der sogenannten 'Normalisierung'. Aus Protest gegen die Resignation der 'Normalisierung' verbrannte sich 1969 der Student Jan Palach auf dem Wenzelsplatz. In wohl keinem anderen sozialistischen Land landeten so viele Intellektuelle, Künstler und Schriftsteller als Kartenabreißer im Kino, bei der Straßenreinigung, als Lagerarbeiter, Antiquare oder Heizer. Sie emigrierten oder wurden in die Provinz abgeschoben. Die meisten Schriftsteller wurden zum Schweigen verdammt und unzählige Intellektuelle in eine Nichtexistenz abgeschoben. "Die Folgen der Okkupation und der anschließenden Politik der Normalisierung durch tschechoslowakische Quislinge waren tragisch [Quislinge sind so etwas wie mißtrauische, kleinkarierte Bürokraten -- Anmerkung der Autorin]. Bis heute haben wir den wirtschaftlichen, vor allem aber auch den moralischen und den Bildungsrückstand nicht aufgeholt. Die intellektuelle Erstarrung des Geistes und die schlaffe Moral hatten eine Reihe von Ursachen: der Auszug der gebildeten Elite aus den Universitäten, die Massenemigration ins Ausland, die Zensur und die ermüdende Propaganda des Regimes, zusammen mit einem unglaublich dichten Netz von Denunzianten und Spitzeln", schreibt Lubos Dobrovský, während der 'Normalisierung' selbst als Fensterputzer tätig. |
||||
Einzig im Untergrund konnten freie Worte und Texte erscheinen, in den vielen Samizdat-Ausgaben oder in Verlagen im Ausland. Eine der bedeutendsten Rollen spielte dabei sicher Josef Skvorecký, ein bekannter und nach Kanada emigrierter tschechischer Schriftsteller, mit seinen 68 Publishers. Aber auch Radio Free Europe kam ein wichtige Rolle zu, konnte es doch auch in der Tschechoslowakei empfangen werden und sendete in Tschechisch. Hier wurde offen die Abscheu vor dem totalitären Regime der eigenen Heimat kundgetan, hier publizierten Havel und Co, was auch deren spätere Amerikatreue zu großen Teilen erklärt, denn Radio Free Europe wurde im wesentlichen von den USA finanziert. |
||||
Die 'Samtene Revolution' brachte dann endlich die lange ersehnten Dinge: Demokratie und Freiheit. Die Revolution erreichte Tschechien später als alle anderen ehemals sozialistischen Länder. Den Auftakt hatte Polen gemacht. Darauf folgte Ungarn, dann die DDR. Nur eine Woche nach der Mauereröffnung knüppelte die Polizei in Prag noch eine Demonstration von Studenten zusammen. Das ganze Jahr 1989 hatte sich die tschechoslowakische Regierung massiv gegen die Vorboten des Wandels und aufkommende Proteste gesperrt und auf das Dialog-Angebot der Charta 77, das von immerhin 40 000 Menschen unterschrieben wurde, mit wüster Polemik reagiert. Mitte November war die Tschechoslowakei das letzte der diktatursozialistischen Regimes in Mitteleuropa, ringsherum nur Aufbruch, Öffnung, Demokratisierung. In den folgenden Tagen brach das Regime dann -- begleitet von sympathischem Chaos und friedlich demonstrierenden Massen -- einfach in sich zusammen. Gustav Husák trat ab und Václav Havel wurde zum Präsidenten gewählt. |
||||
Und tatsächlich gab es einen ungeheuren Wandel. Der Schriftsteller Jáchym Topol beschrieb mir die Veränderung in einem Interview im letzten Jahr als eine Art Zeit-Explosion, als Beschleunigung: "Vor 15 Jahren lebte ich, wie die anderen Millionen Leute, in einem Staat, der einen Zaun hatte. Man konnte nicht raus und nicht reisen. Diese Dinge vergißt man. Und plötzlich passierte diese gigantische Veränderung. Das war eine totale Explosion der Zeit, eine totale Veränderung. Das war eine Bewegung. Und plötzlich geht alles rasant. Das war auch eine Anspielung, auf Bohumil Hrabal und sein Werk: Ein Städtchen, wo die Zeit stehen geblieben ist. Die Zeit des Kommunismus, war die Zeit, wo sich nichts bewegt hat. Und plötzlich ging alles rasend schnell." |
||||
Die Zeit nach der Wende sah in Tschechien etwas anders aus als in Polen oder Ungarn. Die wohl wichtigsten Nachwendeereignisse waren die -- eher beiläufige und eigentlich auch nicht notwendige -- Trennung von der Slowakei und eine ziemlich katastrophalen Privatisierung ehemals volkseigener Betriebe, deren pseudomafiöse Hintergründe bis heute nicht aufgeklärt sind. Das ökonomische Abenteurertum der frühen 90er Jahre, die kontinuierliche Enttäuschung von der Politik, eine träge Rechtssprechung und die Unfähigkeit bzw. Unwilligkeit, die moralische Vergangenheit des alten Regimes offen zu diskutieren, tragen alle zur spezifischen sozialen Spannung im Nachwende-Tschechien bei. Und immer existierte dabei alles nebeneinander: finsterste Bürokratie kafkaesker Prägung (z.B. in Prags Ausländerpolizei), Pragmatismus und verschmitzte Schweijkiaden. Samt und Filz. Bedingungslose Ehrlichkeit und grenzenlose Korruption. |
||||
Auf der anderen Seite schafften Tschechien und einige seiner Nachbarn etwas, was im Nachkriegseuropa viel länger gedauert und weit mehr Hilfe von außen erfordert hat: ökonomische Stabilität und Demokratie auf der Basis von Pressefreiheit und Menschenrechten. 15 Jahre sind keine lange Zeit, um etwas komplett Neues aufzubauen. "Ich bin ziemlich froh, wie sich die Dinge entwickelt haben. Ich habe erwartet, daß der Übergang zur Demokratie viel länger dauern würde", sagte Vladimira Dvorakova, Leiterin der Abteilung Politikwissenschaft an der Prager Ökonomischen Universität, kürzlich gegenüber der Prague Post. Und bei all dem gab es in der politischen Öffentlichkeit einige sehr integre Figuren von weltweiter Ausstrahlung wie Václav Havel und Simon Panek, der 2003 zum 'Europäer des Jahres' gewählt wurde. |
||||
Die Nachwendepolitik in Tschechien ist geprägt von zwei Präsidentschaften wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: der weltoffenen Pop-Politik von Václav Havel, gefolgt und begleitet von der ausschließlich marktorientierten und Europa-skeptischen Politik von Václav Klaus. |
||||
Havel und Co: Pop-Politik und Amerikatreue | ||||
Die erste Nachwende-Regierung, vor allem das erste Parlament in Tschechien war einzigartig, bestand es doch zu großen Teilen aus ehemaligen Schriftstellern, Schauspielern, Dichtern und Dissidenten. Vor zwei Jahren beendete der Schriftsteller Václav Havel seine Amtszeit als Präsident der Tschechischen Republik. Nun werde er wieder schreiben, ließ er verlauten. Die Prager Nachwende-Regierung unter Havel ernannte auch verschiedene andere Schriftsteller und Dissidenten zu Botschaftern der neuen Republik im Ausland. Der Schriftsteller Pavel Kohout etwa wurde tschechischer Botschafter in Deutschland. Der Dichter und Schriftsteller Jirí Grusa war 1997/98 tschechischer Kultusminister und vertrat danach sein Heimatland als Botschafter in Wien. Seine Botschaftsresidenz befand sich bezeichnenderweise in der Wiener Pointengasse. Pointierte Formulierungen und gut geschriebene Reden sind ja üblicherweise nicht gerade eine Stärke von Politikern. Havel, Grusa und Kohout konnte man das aber ganz gewiß nicht vorwerfen. Wenn Schriftsteller Regierungsreden ausarbeiten, dann haben die schon mal von vornherein eines: handfesten Inhalt und formalen Schliff. Nicht selten ein himmelweiter Unterschied zu denen anderer Politikerkollegen. Es hat allerdings auch seine Tücken. Mitarbeiter, die Havels Reden zu korrigieren hatten, sollen bisweilen an seinem Hang zur Originalität gelitten haben, betrachtete er Redenschreiben doch als schriftstellerisches Werk, weshalb er es sich nur ungern -- wie allgemein üblich -- abnehmen ließ. Wie Ivan Medek, ein früherer Vertrauter, berichtete, sah sich Havel mitunter gezwungen sogar einleuchtende Formulierungen abzulehnen, einfach deshalb, weil sie von einem anderen kamen. Und jede Form des Plagiats ging gegen seine schriftstellerische Ehre. |
||||
Václav Havel war zweifellos ein außergewöhnlicher Präsident. 13 Jahre, in denen er nicht nur weltweite Anerkennung gewonnen hat, sondern auch Unkonventionalität und guten Geschmack beweisen konnte. Ein Präsident, von dem bekannt wurde, daß er die langen Gänge der Prager Burg zeitweilig mit einem Kinderroller abkürzte. Ein Präsident, der noch dazu einen Kostümbildner vom Film anstellte, die rot-weiß-blauen Uniformen der Burgwache zu entwerfen. Und ein Präsident, der seine Unterschrift regelmäßig mit einem Herz verzierte. Václav Havel war es auch, der Frank Zappa seinerzeit zum amerikanischen Botschafter in Prag machen wollte, nachdem dieser trotz seiner Kampagne 'Zappa for President' nicht Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Zappa wurde leider nicht zum amerikanischen Botschafter in Prag ernannt. Dafür empfing Havel die Stones, den Dalai Lama und Salman Rushdie. Immerhin hatte Havel mit dem saxophonspielenden Bill Clinton dann jemanden, mit dem er nicht nur Prager Jazzclubs, sondern auch die Warhols in der Slowakei besuchen konnte. Es ist anzunehmen, daß Václav Havel in seiner 13jährigen Amtszeit durchaus auch Spaß hatte. Havel war ein bewundernswerter Präsident, darin sind sich die meisten einig. Und er war originell dabei. So viel Pop-Appeal verbunden mit Glaubwürdigkeit hat kaum ein anderer zu bieten. |
||||
Die Tätigkeit eines Botschafters scheint jedoch besser mit schriftstellerischem Schaffen kompatibel zu sein als die des Präsidenten. Aber wen wundert das. Dafür ist das Präsidentenamt ja keine Lebensanstellung und im Falle Havels hofft man doch immer noch inständig, daß er zum Schreiben zurückkehren wird. Pavel Kohout und Jirí Grusa hatten es da schon leichter. Beiden gelang es trotz ihrer Diplomatentätigkeit weiterhin zu schreiben. Mit guter Regelmäßigkeit veröffentlichten sie neue Bücher und traten in Tschechien und jenseits der Grenze zu Lesungen auf. |
||||
Zur Ära Havel gehörte auch eine so integre Persönlichkeit wie der Journalist Jirí Dienstbier als Außenminister. Ursprünglich Kommentator beim Tschechischen Radio wurde er nach 1968 gezwungen als Nachtwächter zu arbeiten. Von 1969 bis 1989 veröffentlichte er Samizdat-Zeitschriften und gehörte zu den Erstunterzeichnern der Charta 77. 1989 war er Mitbegründer der Zeitung Lidové Noviny, die die 'Samtene Revolution' symbolisierte und die inzwischen zu einer der einflußreichsten tschechischen Tageszeitungen avanciert ist. Später arbeitete er für die Vereinten Nationen. |
||||
Doch Václav Havel, der es in frühen Interviews als Schriftsteller und Dramatiker immer abgelehnt hatte, Politiker zu werden, war sicher der Höhepunkt. Obwohl man Havel tatsächlich vorwerfen kann, sich in den letzten Jahren seiner Amtszeit mehr und mehr von der Innenpolitik entfernt zu haben, fehlt seine Stimme heute, "um den Leuten im Land das zunehmend fremdenfeindlicher geworden ist, die deutsch-tschechische Versöhnungserklärung näher zu bringen. Sie fehlt um den verzagter werdenden Tschechen zu sagen, daß die unsichtbare Hand des Marktes keine Religion ist, die sofort ins Paradies führt" wie es Christian Schmidt-Häuser in der Zeit ausdrückte. |
||||
Bestand die erste Regierung unter Havel zu großen Teilen aus Oppositionellen, Dissidenten, Schriftstellern und Leuten mit ebenso bunten, wie ehrlichen und gebrochenen Biographien, setzt sich die jetzige Regierung überwiegend aus Ökonomen und Personen mit eher geradlinigen Politik- und Universitätslebensläufen zusammen. |
||||
Klaus: Ökonomie und Skandale | ||||
Seit dem 7. März 2003 ist Václav Klaus Präsident. Er trat die Nachfolge von Havel an, der nach zwei Amtsperioden verfassungsgemäß abtreten mußte. Klaus war einer der Mitbegründer der Bürgerlichen Demokratischen Partei (ODS), an deren Spitze er bis 2002 stand und man kann ihn mit Fug und Recht als den letzten Meisterschüler des Thatcherismus bezeichnen. Er brachte in den 90er Jahren den Slogan von der "unsichtbaren Hand des Marktes" in Umlauf, die nicht nur alles regiert, auch Wissenschaft, Kunst und Kultur, sondern auch alles automatisch aufs Beste regelt. |
||||
In gewisser Weise war Klaus eine natürliche Folge der Entwicklung der meisten Post-Wende-Staaten. Das Problem Tschechiens wie vieler anderer post-sozialistischer Staaten war, daß die Bürgerbewegungen zwar die Revolution ausgelöst, aber kein tragfähiges Konzept hatten, wie es weitergehen sollte, nachdem die Nahziele Demokratie und Freiheit erreicht worden waren. Immerhin war in Tschechien mit Václav Havel tatsächlich lange Zeit jemand an der Regierung, der die Revolution mitbestimmt hatte und der sich als Politiker 13 Jahre lang bewährt hat, ohne in vorgefertigte Schemata zu verfallen oder zur Marionette wie auch immer gearteter Fremdeinflüsse zu werden. Zweifellos war problematisch, daß der Binnenmarkt der alten sozialistischen Länder zusammengebrochen war und eine Orientierung am Westen unumgänglich war. Daß diese dann eine neoliberale Prägung bekam, war Klaus zu verdanken, der 1992 Premierminister wurde und als einer der wenigen in der Regierung Havel ein wirtschaftliches Konzept hatte und tatsächlich etwas von Ökonomie verstand. Tschechiens gute Ausgangsposition mit einer veralteten, aber noch intakten Industrie, ohne erdrückende Schuldenlast wie Ungarn und ohne hoffnungslose Landwirtschaft wie Polen hatten das Land schnell zu einem der Spitzenreiter im Osten gemacht (bessere Wirtschaftszahlen haben nur Estland und Slowenien). Auch in der Anzahl der Investitionen aus dem Ausland gehört Tschechien nach wie vor zu den Spitzenreitern in der Region. Die Arbeitslosigkeit ist vergleichsweise niedrig -- am niedrigsten in Prag, in anderen Regionen deutlich höher --, allerdings ist die Arbeit auch niedrig bezahlt, was dazu führt, daß ein beachtlicher Teil der Bevölkerung Zweitjobs hat. |
||||
"Ministerpräsident Klaus' Credo der 'Marktwirtschaft ohne Adjektive' passte zu den neuen westlichen Litaneien der Deregulierung und des Sozialabbaus. Neoliberale in aller Welt gerieten in Verzückung über das alte Prag." (Christian Schmidt-Häuser) |
||||
Doch diese Euphorie ist inzwischen vorbei. Zu oft ist von Kriminalität und Korruption die Rede -- in der Politik und in der Ökonomie. Der vielbeschworene Samt der Revolution ist zum Filz geworden. Elf private Kreditinstitute brachen noch Mitte der 90er Jahre zusammen. Auch die Prager Börse erinnert nach Schmidt-Häuser eher an Wallensteins Lager als an die Wall Street. Insidergeschäfte gelten als Kavaliersdelikte. Ökonomische Schwierigkeiten führten auch dazu, daß Klaus 1997 als Premier zurücktreten mußte. Für die Alten und die unteren Schichten ist die Transformation zum schwarzen Loch geworden. Zumindest sie glauben nicht mehr an die märchenhaften Theorien der unsichtbaren Hand von Santa Klaus, die alles regelt. |
||||
Dennoch sieht der Alltag in Tschechien noch deutlich sozialer aus als beispielsweise im Osten Deutschlands. Es gibt noch ausreichend und billige Kindergartenplätze, eine fast kostenlose Krankenversicherung und stark subventionierten öffentlichen Nahverkehr. Auch Post und Bahn sind noch überwiegend staatlich. Vladimir Mlynár, Chef der Wochenzeitung Respekt, schätzte die Lage Ende der 90er Jahre so ein: "Das meiste ist richtig gelaufen. Klaus redet nur erzkonservativ, aber er betreibt eine soziale Marktwirtschaft. Von unserem Kindergeld, unseren Subventionen für die öffentlichen Verkehrsmittel und den gebundenen Mietpreisen können Polen und Ungarn nur noch träumen." Inzwischen äußert auch er sich deutlich kritischer. |
||||
Die wirklich authentischen Tschechen mit der mutigen Vergangenheit und unbescholtenen Gegenwart befinden sich derzeit eher nicht in der Regierung, sondern gerade in den Nicht-Regierungsorganisationen. So zum Beispiel Simon Panek, einer der Studentenführer von 1989. Er stand 1989 neben Havel und Dubcek auf dem Balkon der Zeitung Svobodne slovo. Simon Panek ist ein unkonventioneller Kämpfer für Freiheit und Demokratie geblieben. Er sitzt heute im Souterrain des Fernsehgebäudes und leitet das Komitee 'Menschen in Not', eine der größten humanitären Organisationen Zentraleuropas, die er 1992 mit Freunden gründete. "Dissidenten können bei uns nicht lange Helden bleiben, weil sie bewiesen haben, daß man sich nicht anpassen muß, und deshalb der Mehrheit ein schlechtes Gewissen machen." Im Ausland gilt er aber dennoch als Held: wurde er doch 2003 zum 'Europäer des Jahres' gekürt. Auch er sieht die Entwicklung grundsätzlich positiv. Aus seiner Perspektive hat die Regierung Klaus das Land halbwegs vernünftig in die Moderne katapultiert. "Aber inzwischen ist Klaus ein hoffnungsloser Ideologe geworden, der jede nichtprofitorientierte Bewegung ablehnt." Dieser Trend und der immer wieder zitierte Slogan von der "unsichtbaren Hand des Marktes" inspirierten den Schriftsteller Michal Viewegh zu einem wunderbar ironischen Roman Die wunderbaren Jahre unter Klaus (Bajecna leta pod Klausem). Auch in der Bevölkerung wird die Mär von der unsichtbaren Hand von Santa Klaus inzwischen eher belächelt. Als allerletztes verlieren die Tschechen ihren Schwejkschen Humor. |
||||
Tschechien, Europa und die Welt | ||||
Schlüsselthema des Streits der ewigen Rivalen Václav Havel und Václav Klaus war lange Zeit die Europäische Union. Der eher philosophisch orientierte Havel war starker Europa-Befürworter, Klaus ist vehementer Europa-Skeptiker. Die außenpolitische Orientierung Havels, die auf die USA, sowie die Integration der Tschechischen Republik in die NATO und die Europäische Union ausgerichtet war, kontrastiert und konterkariert Klaus mit einer national gefärbten Politik. Er wird oft als Patriot beschrieben, was offensichtlich gut ankommt. "Die Tschechische Republik war auch einer der ersten Staaten, die in der EU-Osterweiterung aufgenommen wurden, die einen stark europhoben Standpunkt in politischen Debatten vertrat," sagte Heather Grabbe, EU-Osterweiterungsexpertin mit Sitz in London in einem Interview mit der Prague Post. Gewiß, es gibt nicht unberechtigte Sorgen in der Bevölkerung um die Renten-, Gesundheits- und Bildungspolitik. Aber diese bestimmen nicht die Anti-Politik der Regierung Klaus, die eine europäische Sozialcharta als Überregulierung ablehnt, sondern diese Skepsis von Regierungsseite trägt einen stark provinziellen Akzent. Was über die Landesgrenzen hinausgeht, wird mißtrauisch betrachtet. Dennoch sangen meine tschechischen Freunde nach den gelungenen Beitrittsverhandlungen lauthals die Ode an die Freude. |
||||
Genauso scheint Tschechien auch generell zwischen provinziellem Patriotismus und Weltoffenheit zu schwanken. Die Fremdenfeindlichkeit wächst, wie die Umfragen des Soziologen Ivan Gabal zeigen. Aber auch die Weltoffenheit. Dieser Zwiespalt zeigt sich auch an den Debatten um die Rückkehr der Emigranten, die in Tschechien viel härter und viel weniger generös geführt werden als in vielen anderen ehemaligen Ostblock-Ländern. Es ist auch wenig verwunderlich, daß Milan Kunderas literarisches Werk in Tschechien nahezu unbekannt ist. Er selbst hat die Übersetzung seiner in Französisch erschienen Bücher ins Tschechische verboten und ist deshalb -- und wegen seiner Sicht auf die Tschechen -- weitestgehend unbeliebt. Ob es nun die Emigranten selbst sind -- wie im Falle Kundera -- die ihre Veröffentlichung und Rückkehr ablehnen oder ob sie nach ihrer Rückkehr nur skeptisch betrachtet werden, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Interessant ist, daß -- glaubt man der Übersetzerin Eva Profousová -- die tschechische Exilliteratur keinerlei Einfluß auf die tschechische Gegenwartsliteratur hat, ganz im Gegensatz zur Samizdat-Literatur. "Ich denke, es gibt einen großen Einfluß der Underground-Literatur, also der Literatur des Dissens. Aber die Exilliteratur -- in dem Sinne, daß sie moderne oder junge Schriftsteller beeinflußt, würde ich sagen überhaupt nicht." |
||||
Die Schatten der Gegenwart und der Vergangenheit: Korruption und fehlende Aufarbeitung | ||||
Schattenseiten der Politik nach der Wende sind zweifellos die fehlende Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit und die immer mehr überhand nehmende Korruption. Der Skandal um Stanislav Gross ist nur die Spitze des Eisbergs und bei weitem nicht die erste Affäre in die tschechische Politiker verwickelt waren, aber immerhin die erste die Konsequenzen hatte, und das kann man mit etwas Optimismus als gutes Zeichen betrachten. Doch auch vorher gab es schon zahlreiche Affären führender Politiker. Genannt seien da nur Namen wie Klaus, Zeman und Kávan. Kávan ist Vorsitzender der UN-Vollversammlung, obwohl er nachgewiesenermaßen inoffizieller Mitarbeiter des Geheimdienstes war -- oder wie das in Tschechien heißt: STB. Trotzdem fühlen sich die Tschechen weiter gut von ihm in New York vertreten und die UN spart mit Kommentaren und sagt, die Konsequenzen müßten aus dem Land kommen. |
||||
Als ich Ivan Klíma im Winter 2002 zum Interview besuchte, sagte er -- der immer schon die Lage in seinem Heimatland wie kein anderer reflektierte -- daß er derzeit an einem Roman arbeitet "der sich sehr von meinen anderen Romanen unterscheidet. Es ist ein politisches Pamphlet und beschäftigt sich mit Korruption und der Art, wie die postkommunistischen Länder ihre Demokratie entwickeln." Dabei geht es nicht nur um die Tschechische Republik "aber postkommunistische Länder, weil der Protagonist Premierminister ist. Ich habe nicht vor Klaus, Zeman oder Spidla zu kritisieren, weil es nicht gegen irgendeine Person geht, sondern gegen das System. Es geht um Werte und Moral. Ich habe versucht einige ungarische, polnische und tschechische Namen auszuwählen, so daß es ein postkommunistisches Land wird. Meine Inspiration ist natürlich Tschechien." |
||||
Auf die Frage, ob er mit der 'Samtenen Revolution' und der Situation heute zufrieden ist, antwortete er: "Ich bin nicht enttäuscht. Ich war immer sehr realistisch und eher skeptisch, also bin ich nicht überrascht. Der letzte Satz, den ich gerade geschrieben habe, bevor Sie kamen, war der Satz: 'Ein Land zu regieren und von Leuten umgeben zu sein, die kein Gesetz und keine Moral anerkennen, ist unmöglich.' Das ist der Satz, den ich gerade beendet habe und er ist meine Meinung zu der Situation. Wir haben nicht genug Moral, es gibt so viele Skandale, die wirklich unglaublich sind -- bis in die höchsten Ebenen." |
||||
Und er sollte Recht behalten. Der Fall des Premier Gross zeigte, daß die Situation drei Jahre nachdem er diesen Satz schrieb, immer noch unverändert ist. Gross konnte und wollte nicht offenlegen, woher das Geld für seine Luxuseigentumswohnung kam, und auch das Geld für das Haus, in dem die Firma seiner Frau sitzt, kommt aus seltsamen Quellen. Die Zeitschrift Respekt recherchierte, daß es auf eine Prager Bordellbesitzerin zurückzuführen ist: eine wunderbar regierungsnahe Geldwäsche also. Die Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Wohnungskauf sind bei weitem nicht die einzigen Fragezeichen, die im Zusammenhang mit Stanislav Gross aufgetaucht sind. Gross ließ auch spezielle Teams von verdeckten Polizeiermittlern aufstellen, die gegen Wirtschaftskriminalität (sic!) ermitteln und ihm -- entgegen allen Vorschriften -- höchstpersönlich unterstellt waren. |
||||
Eine andere Schattenseite im Nachwende-Tschechien ist die fehlende Aufarbeitung der Diktatur-Vergangenheit. Jirí Musil, Soziologieprofessor an der Karls-Universität, betont, daß Polen und Ungarn in dieser Hinsicht deutlich erfolgreicher seien. Nur zwei der Hauptfiguren der tschechoslowakischen Regierung wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt, wovon einer seine Haftstrafe aus Altersgründen nie antreten mußte. Bis jetzt gibt es wöchentliche Enthüllungen in den Zeitungen über ehemalige Mitarbeiter der tschechischen Staatssicherheit, die in Regierungsministerien arbeiten. Musil bedauert die fehlende Aufarbeitung nicht nur im Zusammenhang mit der kommunistischen Vergangenheit, sondern auch in der Verbindung zum 2. Weltkrieg und der Vertreibung der Deutschen. Den Preis, den Tschechien für diese fehlende Aufarbeitung zu zahlen habe, sieht Musil in Mißtrauen, politischer Apathie und Frustration unter den Leuten. "Zu viel Samt, denke ich", ergänzt er. |
||||
Ähnliches hörte ich auch vom Schriftsteller Jáchym Topol, als ich ihn im letzten Jahr interviewte. Sein letztes Buch widmet sich ganz massiv der Vergangenheitsbewältigung und das ist neu für ihn. "Mich interessieren aus irgendeinem archäologisch-literarischen Grund die Leichen im Keller. Ich bin Tscheche und wir haben einige solcher Leichen im Keller. Die Deutschen haben das auch. Und diese Leichen sind wie wilde Katzen, die beißen dich in den Hintern, wenn du nicht springst. ... Ich bin einfach fasziniert von der tschechischen Vergangenheit. Und es ist ein gewaltiger Unterschied zu Deutschland, wo es eine Denazifierung gab. Aber in Tschechien fand keine Dekommunismisierung statt, überhaupt nicht." Er verwendet in seinem Buch den Zeitraum nach dem sowjetischen Einmarsch 1968. "Das beantwortet auch die Frage, warum ich als Kulisse die Invasion im Jahre 1968 gebrauche. Für mich ist die Invasion eine schreckliche Spur aus der Vergangenheit. Und wir Tschechen gehen ins neue Europa verblutet von der Vergangenheit und wir denken wir kommen jetzt dahin ganz neu und sauber und unbekümmert, aber es stimmt nicht." |
||||
Er kennt dieses fehlende Wissen um die eigene Vergangenheit aus eigener Erfahrung. "Ich war Lehrer an der Universität und habe zum Beispiel Literatur der 50er Jahre unterrichtet. Und eine Menge tschechischer Schriftsteller und Dichter war damals in Lagern und da habe ich plötzlich festgestellt, daß die Studenten darüber eigentlich nichts wissen. Und plötzlich fragen sich diese zwanzigjährigen Leute, was hat eigentlich mein Vater gemacht oder mein Großvater. Wo waren sie, waren sie im Uranbergbau oder im Gefängnis und waren sie da Aufseher oder Häftling." |
||||
Dennoch bleiben gerade Jáchym Topol aus seiner Dissidenten- und Samizdat-Vergangenheit einige sehr wertvolle Sachen: Freundschaften zum Beispiel. "Ich denke, daß mir aus der Zeit einige Freunde bleiben. Und es bleibt mir aus der Zeit eine dissidentische Art und Weise des Denkens und der Arbeit. Diese Zeit hat mich gelehrt, mich auf den engsten Kreis der Freunde zu verlassen. Das heißt, daß ich ihnen vertraue. Und das heißt, daß ich mich nicht so stark von der Zeit, von dem Terror der Mode, des Marketings und der Medien beeinflussen lasse und daß ich diesen Kreis, diese kleinen Inseln authentischer Kultur vorziehe." |
||||
Tschechien heute ist mehr als Knödel, Bier und Märchenfilme. Frage ich meine tschechischen Freunde, was die besten Ergebnisse der Revolution waren, dann werden neben Demokratie und Reisefreiheit auch andere Dinge genannt, zum Beispiel daß der Braunkohlenabbau eingestellt wurde und dadurch einige schöne Dörfer und Städtchen gerettet werden konnten; daß es mehr Cafés und Kneipen gibt; die Städte bunter und vielfältiger geworden sind und die Menschen sich besser kleiden; der Prager Stadtteil Zizkov vor dem Abriß bewahrt wurde (die dortige Altbausubstanz sollte abgerissen und gegen 'hygienischere' Plattenbauten ausgetauscht werden); man verschiedene Zeitungen lesen kann, nahezu jedes Buch bekommt und daß die Geschäfte auch am Wochenende geöffnet sind. Dennoch bleiben Wunden und Vernarbungen. "Alles ist viel komplizierter und braucht mehr Zeit, als wir in der Atmosphäre des generellen Enthusiasmus gedacht hätten", sagte Václav Havel. Einen dritten Weg hat es auch hier nicht gegeben, dafür aber einen sehr eigenwilligen, sehr bunten und sehr böhmischen. |
||||
"... Und wer spricht für den Menschen für den Schmerz |
||||
|
autoreninfo

Dr. Martina Zschocke ist Journalistin und Psychologin, studierte in Deutschland, den Niederlanden und den USA. Sie lebt seit einigen Jahren in Prag und Leipzig und arbeitet für Radio Prag und die Bauhaus-Universität Weimar.
E-Mail: mrzsch@aol.com |
||||
|
|