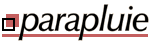
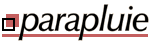 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 21: warschauer pakt
|
Exil zum ZweitenDer zeitgenössische tschechische Roman |
||
von Elena Deem |
|
Nachdem zeitgenössische tschechische Autoren nun ohne Schere im Kopf in ihrer Heimat publizieren und öffentlich auftreten können, ist man versucht anzunehmen, daß sie sich aus der einstigen künstlerischen Zwickmühle zwischen verbittertem Engagement und skeptischem Einsiedlertum haben befreien können, um sich der postermodernen Oberflächlichkeit und Experimentierlust hinzugeben. Weit gefehlt. Der tschechische Roman nach 1989 wird immer noch von der Sehnsucht nach einem unmöglichen Exil inspiriert. Die Form des Genres mag sich gewandelt haben -- die spezifische Gemütslage der Autoren aber, die diese unter widrigen Lebensbedingungen jahrzehntelang kultiviert haben, ist dieselbe wie eh und je. |
||||
|
||||
|
||||
Es mag unpassend erscheinen und vielleicht auch nicht besonders einladend klingen, einen Essay über den zeitgenössischen tschechischen Roman mit diesen beiden Zeilen Lyrik und Prosa einzuleiten. Die in ihnen enthaltenen Motive jedoch tragen das zentrale Thema, das die tschechische Literaturproduktion der kapitalistischen Gegenwart mit der kommunistischen Vergangenheit verbindet. Beide Zeilen entstammten Werken, die kurz vor und nach der sogenannten 'samtenen' Revolution verfaßt wurden, und stehen stellvertretend für den Inbegriff einer ganzen Generation künstlerischer Opposition in den siebziger und achtziger Jahren: die Tendenz, das Trauma in Erinnerung zu rufen, und zugleich eine starke Sehnsucht danach, dem Trauma zu entkommen. In seiner Interpretation des Gedichts von Jáchym Topols markiert der Kritiker Jiri Jolz das ihm zugrunde liegende Problem und analysiert die Haltung, die zu dieser Zwickmühle führte: "Die gesellschaftliche Wirklichkeit erscheint Topol völlig unakzeptabel. Sie ist inhaltsleer. Sie macht krank. Das lyrische Ich der Gedichte sieht sich selbst als ein Ausgestoßenes voller Verzweiflung." |
||||
Aus der 'Verzweiflung' des Helden läßt sich außerdem schließen, daß diese Generation die Unmöglichkeit einer Flucht zögerlich einräumte -- in der Gegenwart wie auch in der Zukunft. Diese Doppelstrategie von Auseinandersetzung und Verdrängung wurde noch verstärkt durch die Existenzformen literarischer Opposition, die ins sprichwörtliche und buchstäbliche Versteck abgedrängt wurden: 'Zuhause' in Form der geheimen Samisdatschriften und außer Landes in Form von Exilliteratur. |
||||
Es wäre zu simpel, einen theoretischen Bruch zwischen vor- und nachrevolutionärer literarischer Produktion zu konstruieren und zu behaupten, daß die Autoren sich aus der einstigen künstlerischen Zwickmühle von verbittertem Engagement und skeptischem Einsiedlertum hätten befreien können, um sich der postmodernen Oberflächlichkeit und Experimentierlust hinzugeben. Das Argument, die tschechischen Autoren hätten das Exilmotiv abgestreift oder gänzlich aufgegeben, nachdem sie sich in die 'postmoderne Spaßkultur' stürzten, läßt sich empirisch kaum aufrechterhalten: Wenigstens in einigen Fällen ist zu erkennen, daß die Sehnsucht nach der möglichen Flucht immer noch das Kennzeichen des zeitgenössischen tschechischen Romans ist. Während sich die Form des Genres gewandelt haben mag, blieb die spezifische Gemütslage der Autoren, die diese unter widrigen Lebensbedingungen jahrzehntelang kultiviert hatten, unverändert. Es ist in diesem Zusammenhang unwesentlich, ob diese Erfahrung direkt erlebt oder durch das Medium selbst vererbt wurde. |
||||
Es ist charakteristisch für die tschechische fiktionale Literatur, sich sowohl auf die Welt zu beziehen, als auch eben diese Welt ins Exil zu befördern, etwa indem man eine alternative Welt entwirft, während man gleichzeitig ohne Unterlaß betont, daß ein solches Exil unmöglich ist und ins Reich der Fantasie gehört. Das Augenmerk der Autoren richtet sich derzeit auf die Bedingungen des sich formierenden kapitalistischen tschechischen Staates, der scheinbar neue, aber in Wirklichkeit nur allzu bekannte Traumata produziert, wie z.B. zwielichtige Machenschaften in der Politik, Umweltverschmutzung und Zerstörung des sozialen Netzes. Diese Ästhetik der Exilliteratur, die ständig zwischen Konfrontation and Flucht oszilliert (was nicht notwendigerweise bedeutet, eine bessere Welt vor Augen zu haben), ist alles in allem immer noch das populäre Thema des Tages. Die Versionen dieses 'Exils' werden von parallelen Metaphern besetzt, die in der zeitgenössischen Fiktion wiederholt vorkommen, wie z.B. die negative Utopie die Utopie, die Verlegung der Erzählhandlung ins Ausland, der Einsatz des magischen Realismus, sowie die nostalgische Träumerei. Anders gesagt: die tschechischen Autoren haben es sich gemütlich eingerichtet im reichlich metaphorischen Exil ihrer Romanwelt. Und so setzt sich die Tradition tschechischer Auswanderung fort, mit dem einzigen Unterschied, daß diese sich für die ältere und mittlere Schriftstellergeneration in eine andere formale und metaphysische Kategorie verwandelt hat. Die jüngsten Schriftsteller verlassen das Land sowohl metaphorisch als auch physisch. |
||||
Jáchym Topol (*1962) ist der exemplarische Fall einer Übergangsfigur, dessen Erfahrungen als oppositioneller Untergrundkünstler zahlreiche Begegnungen mit der eisernen Faust der kommunistischen Partei einschließt, und auch eine ganze Reihe Ausbruchsversuche, einschließlich Experimente mit harten Drogen und Alkohol. Sein Fall steht also ziemlich stellvertretend für die jüngere Generation der siebziger und achtziger Jahre, die jenseits der Grenze des neuen Jahrtausends weiter schreiben und veröffentlichen. Die inoffizielle Kulturszene in den Jahren vor der Revolution trug die Handschrift dieser Art 'Fluchtkünstler', die sich nach dem Exil sehnen aber in aller Regel ausharren, welche die Auseinandersetzung nicht scheuen aber sich gleichzeitig alleingelassen werden wollen ("Laß mich allein und schieb ab"). Topol ist bis heute weder auf die (schönen) Aussichten der Gegenwart hereingefallen noch auf die Idee, daß er ihr jemals entkommen könnte. Um dieses unmögliche Exil jedoch dreht sich alles, heute und damals. So räumt Jáchym Topol denn auch in einem Gedicht von 1992 ein: "Das wird übel". |
||||
Die Lektüre der Topol'schen Prosa ist keineswegs ein einfaches Unterfangen. Binnen Sekunden taucht man ein in den Strudel eines paranoiden Albtraumes, der nicht einfach auf der letzten Romanseite aufhört. Die klaustrophobische Idee der totalen Einengung konnotiert die Stacheldrahtzäune, die einst die Grenzen der Tschechoslowakei säumten, obwohl diese Erzählung der Zeit nach der Revolution entstammt. Topol ist niemals explizit politisch, doch stellt er gnadenlos der dem korrupten Polizeistaat abgerungenen Wahrheit nach, dergemäß die Ruchlosen niemals Ruhe geben, während die Unschuldigen immer das Schlimmste abbekommen. Eins ums andere Mal wird die Unschuld zu Brei geschlagen, und Topol setzt dieses Schlagstock-Moment wiederholt in seiner vielfach metaphorisch gebrochenen Beschreibung zwischenmenschlicher Beziehungen ein. Gnadenlos malt Topol die gläserne Wand der conditio humana blutrot. Seine Romanwelt reicht weit über die Grenzen der sozialistischen und post-sozialistischen Zustände in der tschechischen Republik, hinein in ein apokalyptisches Porträt menschlicher Existenz. Die Dinge entwickeln sich vom Gutem zum Schlechten in seinen Romanen, in denen Topol das Bild eines ewig lockenden und ewig abwartenden Schwarzen Loches entwirft, einem magischen Ort des ultimativ Bösen, das alle Unschuldigen magnetisch anzieht und verschluckt. Wir alle kennen die Flucht, und so endet die vom Amphetamin-Rausch getriebene Reise ins Exil ein ums andere Mal da wo sie begann, mit dem einzigen Unterschied, daß die in Blut getünchte Dunkelheit von Mal zu Mal nor noch zunimmt. Manchmal, unter besonders glücklichen Umständen, verspricht der Roman einen Ausweg, doch die Bedingungen dieses Auswegs sind vorläufig und unsicher. Die Suche nach diesem Ausweg korreliert häufig mit der Suche der Romanfiguren nach Unschuld, Liebe und wahrem Leben, wie z.B. im Fall der hoffnungslosen Frau in Die Schwester (2004), die den liebevollen Spitznamen "kleine weiße Schlampe" trägt, oder im Falle einer Mädchenfigur in Engel exit (1997) und Nachtarbeit (2003). |
||||
Topols bedeutender Roman Die Schwester (2004) spielt hauptsächlich in Prag, in der Zeit kurz vor, aber hauptsächlich nach der Revolution, und zeichnet die sich ständig wandelnden Verhältnisse des neuen sozialen und wirtschaftlichen Systems nach. Potok, der Held des Romans, ist bezeichnenderweise ursprünglich ein Schauspieler, der sich nach der Wende zum 'Businessman' mausert. Aber die Geschäftswelt entwickelt sich in der neuen Demokratie eher nach den Grundsätzen der halblegalen osteuropäischen Mafia. Diese undurchsichtige and zunehmend zynische Welt des Betrugs, der Gewalt und der Korruption hat Verbindungen zu den höchsten Regierungskreisen und kollidiert letztlich mit Potoks eigener Gruppe. Während diese Gruppe, dieser Familienclan, sich ausdrücklich am System beteiligt, fällt sie letztlich aufgrund ihrer Skrupel und fast utopischen Ideen, die das Kennzeichen ihrer 'geschäftlichen' Aktivitäten sind, auf gewaltsame Weise auseinander. Die Gewalt färbt auch auf Potoks Beziehung zu Frauen ab und macht es ihm unmöglich, eine dauerhafte Beziehung einzugehen. Potok Lebens im Polizeistaat ist anfänglich von der unschuldigen Beziehung zu seiner Freundin geprägt, die er liebevoll (aber ohne den Hauch von Sentimentalität) die "kleine weiße Schlampe" nennt. Als er sie kurz vor der Revolution verliert, wird Potok bewußt, daß ein Teil seiner selbst und seiner Ehrlichkeit und Unschuld aus der Oppositionszeit vielleicht für immer verloren ist. Diese Frau wird zu seiner imaginären 'Schwester', aber auch zu einer neuheidnischen Gottheit und Madonna, nach der er im Verlauf der Romanhandlung fahndet, die er schließlich findet und abermals verliert. Die neue Ära nach der "großen Explosion der Zeit" soll eigentlich die erwünschte Befreiung vom Unterdrückerstaat mit sich bringen -- ein neues Zeit-Raum-Kontinuum. |
||||
Dieser Traum, der jedoch schnell zum Albtraum wird, führt Potoks Fahndung in eine fiktionale Reise unter die Oberfläche der Städte Prag und Berlin, ins Reich der zwischenmenschlichen Beziehungen, und ins individuelle und kollektive Bewußtsein. Prag wird zu einer albtraumhaften negativen Utopie, einem Ort dunkler Visionen und Heimat diverser Untergrund-'Stämme'. Mit großer Phantasie entwirft Topol eine neue Generation von Europäern -- nomadische und halb-legale Stämme aus Tschechen, Immigranten aus der Ukraine, Rußland, Vietnam, Laos, Deutschland und anderen Völkern, die er alle vermischt und von einem Ort zum anderen wandern läßt. Topol verwendet den Neologismus "Kanaken" für dieses Phänomen der ewigen Exilanten, welche die Bevölkerung Europas stellen. Er hebt somit diesen neuen Aspekt eines Europa mit Prag im Zentrum hervor, das sich zu einem Ort ständigen Flusses und dauerhaften Exils gewandelt hat. Das Stammesthema wird noch verstärkt durch den Einsatz archetypischer Figuren aus der Mythologie des kollektiven Unterbewußtsein. Potok führt mit seinem eigenen Stamm eine Reihe von Ritualen aus, um sich potentielle Gefahren vom Leibe zu halten. Einige Rituale sind hilfreicher als andere, wie z.B. das Verfahren einzelner Stammesmitglieder, den anderen ihre Träume mitzuteilen, um sich dadurch selbst zu reinigen. Topol entwirft an dieser Stelle des Romans eine atemberaubende und zugleich fast unerträglich brutale Vision, in der er ganz unsentimental mit der nationalsozialistischen und bolschewistischen Vergangenheit abrechnet. Als Potok beispielsweise seinen persönlichen Traum einer Reise nach Auschwitz erzählt, zerrt er einen Albtraum ans Licht der Öffentlichkeit, der dem kollektiven tschechischen Unterbewußtsein bis heute nachgeht. Diese Enthüllung ist schockierend, aber gleichzeitig heilsam, weil Topol sich traut diesen Albtraum der Nachkriegszeit und damit natürlich gleichsam Potoks eigener Generation anzuhängen. |
||||
Diese C.G. Jung'sche Realität des Zusammenlebens der Stämme im Untergrund aber, mit ihren zunehmend gewaltsamen Aktionen und schwarzen halluzinogenen Visionen, wirkt letztlich zerstörerisch, da sie Potoks Leben komplett durchdringt. Es ist Potok ganz unmöglich dem Untergrund zu entkommen (weil es außer dem Untergrund nichts anderes gibt), seine erste Liebe wiederzufinden, und eine stabile Beziehung mit der Welt und zu sich selbst aufzubauen. Die unfreiwillige Reise in diesen Albtraum veranschaulicht, daß die menschliche Existenz einer Reise in die apokalyptische Nacht gleicht -- eine Vision, die ironischerweise einer Situation entspringt, die Befreiung und Flucht einbringen soll, und sich ankündigte in der neuen Ära nach der "Explosion der Zeit". Jeder Versuch, diesem Albtraum zu entkommen (freiwillig oder zwangsweise, da Potok nach der gewaltsamen Zerschlagung seines Stammes sowohl in 'den Osten' zieht als auch gezogen wird, und von der Realität des Alltags in die halluzinogenen 'Rückfälle' seiner Wohnung hin- und herwechselt) endet in noch größerer Verzweiflung. Einige Kritiker behaupten, es gäbe einen Funken Hoffnung am Ende des Romans, an dem Potok die Schwester der "kleinen weißen Schlampe" trifft, die "Schwarz" heißt. Diese Hoffnung ist jedoch zweideutig, wie sich schon am Namen der Frau ablesen läßt. |
||||
Topols Erzählstil fasziniert in seiner Geschmeidigkeit und in seiner Imaginationskraft. Die Form in seinen Romanen harmonisiert immer mit dem Inhalt. Sein neuester Roman Nachtarbeit beispielsweise hat einen eher linearen Handlungsstrang. Da die Geschichte aus der Sicht eines Kindes erlebt und erzählt wird, formuliert Topol kurze Sätze mit klaren Aussagen. |
||||
Für Die Schwester allerdings, in dem Träumereien, Visionen, Traumzustände und Halluzinationen die Linearität der Handlung durchbrechen, schreibt Topol elastische Sätze, mit denen er die fließende Wahrnehmung und Erlebniswelt des Helden in eine nahtlose Erzählung umsetzen kann. Die langgestreckte Erzählung ohne Punkt und Komma erinnert an Hrabal, and der Autor erzählt die Geschichte so, als säße er direkt neben dem Leser. Die Erzählung nimmt folglich die Form mündlicher Überlieferung an. |
||||
Dieser Effekt ist nach Meinung vieler ein charakteristischer Zug der tschechischen Romanliteratur und geht zurück auf den tschechischen romantischen Schriftsteller Mácha: er stellt eine gewisse Intimität zwischen Autor, Text und Leser her. Diese Intimität (Topol behauptet, tschechische Schriftsteller kommunizierten mit ihren Lesern als säßen sie mit diesen bei einem Glas Bier zusammen) befähigt den Leser, großen Anteil an den Ereignissen und dem Schicksal des Helden zu nehmen. Gleichzeitig akzeptieren Leser das formale Experiment in der Prosa des Romans beinahe als Teil ihrer eigenen Sprache. Und das ist unglaublich, denn Topol kreiert eine Reihe zunächst unverständlicher Neologismen, in denen er den Mafiapaten, den Kapitalisten und die sehr östliche Sicht der Dinge mit der slawischen Stammesmythologie kreuzt. Diese absurde Kombination wird urplötzlich zu einer völlig normalen Sache, und initiiert den Strudel der Ereignisse unter der Oberfläche bis hin ins jämmerliche Stammesexil im zeitgenössischen Prag. |
||||
Fast auf der entgegengesetzten Seite des Erzählspektrums, getragen von den Themenfeldern Hoffnung und Flucht, rangieren die Romane Milos Urbans (*1967). Topols Konzeption des Exils ist eine Konzeption 'ohne Exil' -- sein Held wankt durch die apokalyptische Szenerie mit einer Spur Hoffnung im Gepäck. Milos Urban kontert diese Tendenz, in dem er die Erzählhandlung seiner Romane gegen Ende in Richtung Utopie steuert, speziell in Hastrman (2001; wortwörtlich "Wassermann" -- nicht in dt. Übers. verfügbar) und im Roman Die Rache der Baumeister: Ein Kriminalroman aus Prag (2001). Während Topol das Stammesmotiv aufgreift und sein Erzählton brutal unsentimental daherkommt, wählt Urban einen mittelalterlichen und zutiefst nostalgischen Erzählton. |
||||
Der nostalgische Rückzug in die Zeit vor der industriellen Revolution ist das Merkmal seines Romans Wassermann, der mit "Ein grüner Roman" untertitelt ist. Im ersten Teil des Romans rekonstruiert Urban das Leben im Nordwesten Böhmens während des frühen 19. Jahrhunderts, einer Region, der die Schwerindustrie und der Bergbau in der jüngsten Vergangenheit stark zugesetzt haben. In prächtigen Farben porträtiert er die heidnische Tracht der Dorfbewohner, deren enge Beziehung zur Natur, sowie die Reichweite der Naturkräfte auf dem Lande. Ein heiliger Berg speist das örtliche Flußsystem mit Heilkräften. Mehrere Generationen haben den Fluß akribisch in ein Netz von Kanälen und Teichen verwandelt, und die slawischen Gegenstücke zu Dolmen und heiligen Bäumen dienen als Austragungsort frühzeitlicher Rituale. Die enge Beziehung zur Natur verkörpert Katynka, eine junge Frau im Dorfe, die mehr oder weniger geheimnisvolle Zeremonien ausführt (vor den Augen des jungen Dorfpriesters). Aber das alles geschieht zu einer Zeit, da die Ideale der Aufklärung nachwirken und die industrielle Revolution gerade beginnt. Der Wassermann, ein Tier, das sich in einen gebildeten Aristokraten verpuppt hat, lebt einerseits im Einklang mit der Natur. Andererseits korrumpiert er infolge seiner großen Kenntnisse auf dem Gebiet der Naturwissenschaft und der Philosophie. Am Ende gibt er dem Drängen des habgierigen Verwalters seiner alten Mühle nach und erlaubt ihm, die Mühle mit Steinen aus den heiligen Bergen technologisch aufzurüsten. Diese erste Blasphemie, dieser Sündenfall, soll nicht ungestraft bleiben. Es braucht nur einige Morde und das Martyrium des Wassermanns, um den Schaden zu reparieren, den die industrielle Invasion auf dem Lande verursacht hat. Und Urban behauptet, es sei in der Tat möglich, alles wieder gut zu machen. Es sind jedoch nicht die Morde, die den Wandel zum Guten letzlich möglich machen, sondern gewaltfreie Unnachgiebigkeit und Selbstaufopferung. Im zweiten Teil des Romans erwachen der Wassermann und die junge Frau aus dem Stadium des Winterschlafes -- und finden sich in der Gegenwart wieder. Das Land ist zerstört, das Dorf liegt nun auf dem Grund eines gigantischen Stausees, und der heilige Berg ist dem Bergbau zum Opfer gefallen. Der Wassermann versucht zunächst bei verschiedenen Funktionären Beschwerde einzulegen, vom Unternehmensleiter bis hin zum Minister für 'Ökologie', der das Bergbauprojekt abgesegnet hatte. Jedes Mal schicken ihn die Funktionäre ein Büro weiter mit der Ausrede, sie würden lediglich den ordentlichen Dienstweg einhalten. Nachdem der Wassermann das System der Korruption und Raffgier durchschaut hat, beschließt er, alle zu töten, die darin verstrickt sind. Die Morde reichen jedoch nicht aus, die unersättliche kapitalistische Maschine zum Halt zu bringen, da schließlich alle Funktionsträger ersetzbar sind. Erfolg hat erst die immer größer werdende Bewegung ökologisch eingestellter Jugendlicher, der "Regenbogen-Kinder", die einen gewaltfreien Protest gegen die Regierung inszenieren und sie dazu zwingen, den Bergbau einzustellen und die Region der Führung dieser Gruppe zu übergeben. Diese Bewegung, in der Katynka eine führende Rolle spielt, restauriert den Berg und das Dorf, nachdem der Wassermann glücklich auf dem Berg stirbt und die einsetzenden Wasserfluten den Staudamm zerstören. Nach und nach etabliert sich eine vor-industrielle Gemeinschaft hart arbeitender Leute, und so können die Natur und das Leben wieder in den Zustand der Zeit vor dem industriellen Sündenfall des Wassermanns zurückkehren. |
||||
Der Leser mag sich vielleicht zurecht fragen, was in aller Welt in dieser eher schwerfällig geschriebenen Geschichte vor sich geht. Urban ist kein geborener Schriftsteller wie etwa Topol, und besonders der zweite Teil des Romans wirkt häufig geschmacklos infolge eines Schreibstils, der einen vielleicht zu naiven Inhalt reflektiert. Aber Urban ist ein aufs Detail bedachter Historiker und sorgfältiger Forscher. Seine Schilderung des Lebens im 19. Jahrhunderts, der Trachten und Naturschönheiten ist daher faszinierend und bildet einen interessanten Gegenpol zur öden Gegenwart. Man mag sich außerdem fragen, was am guten alten Idealismus falsch sein soll -- eine Frage, die Urban selbst im Roman aufwirft -- und warum man ihn jedes Mal dem schönen geschmacklosen Schein der Postmoderne aufopfern sollte. Urban ist jedoch intelligent genug, den faulen Zauber zu durchschauen. Während er die wunderbar perfekte Öko-topie im Wassermann als eine Form von Flucht vor der rücksichtslosen industriell-kapitalistischen Gegenwart konzipiert, ist sein zweiter Roman, Die Rache der Baumeister, düsterer und weniger explizit utopisch. Eine Serie bizarrer Mordfälle, die sich im zeitgenössischen Prag abspielen, stellt sich als letztlich gerechtfertiger Kampf einer kleinen Gruppe heraus, die dabei ist, ein mittelalterliches Retro-Paradies in einem besonders geschichtsträchtigen Teil Prags aufzubauen. Nach getaner Tat werden alle Autos verboten und der ganze mittelalterliche Coup fliegt auf. Diese Geschichte ist allerdings so übertrieben und bizarr, daß sie eher als eine ironische Invektive zu verstehen ist in bezug auf den (unmöglichen) Versuch, einen wie auch immer gearteten Ausweg aus dem industriellen System der freien Marktwirtschaft zu finden. Wie dem auch sei, Urbans nostalgische Sicht der Vergangenheit, seine Sehnsucht zurück in die Vergangenheit zu fliehen und seine moralisierenden Tendenzen -- im Stile der mittelalterlichen 'Exempla' -- geben der nachrevolutionären tschechischen Literatur einen interessanten Farbtupfer. Urbans Romanwelt setzt sich mit den Unterschieden zwischen richtig und falsch auseinander und erforscht die Möglichkeit eines utopischen Exils. |
||||
Der magische Realismus als eine weitere mögliche Spielart der Realitätsflucht wurde in der tschechischen Literatur, die generell eher surrealistische Wege einschlug, nie wirklich angepackt. Nie, das heißt bis zu dem Zeitpunkt, da Jiri Kratochvil (*1940), ein genialer in Brünn geborener Schriftsteller, nach 1989 schließlich zu schreiben und zu veröffentlichen begann. Die Literaturkritiker und der Autor selbst haben seinem experimentellen Erzählstil die Etikette 'postmodern' aufgeklebt. Man muß sich dieser Tage allerdings fragen, was diese Etikette wirklich bedeutet und was diese wohlfeile Formulierung, unter der man jede eklektische und studentische Literaturproduktion subsummieren könnte, mit der brillianten Vorstellungskraft dieses Autors zu tun haben soll. Kratochvil hebt in seinem Oeuvre einfach ab. Er setzt wirklich alle nur denkbaren Hebel der Romanproduktion in Bewegung und schöpft das Potential des Genres maximal aus -- er mischt die unterschiedlichsten Erzählstile und Perspektiven, knüpft intertextuelle Bezüge und mixt populäre Kultur mit philosophischen Traktaten und historischen Exkursen. Und seine Kunstwerke sind in der Tat offen im Sinne der Eco'schen Definition. Drei Aspekte seines Schreibens jedoch sind außerordentlich. Sie machen Kratochvil einzigartig und vielleicht in einem weniger allgemeinen Sinne 'postmodern': sein Riecher für eine gut erzählte Geschichte, die Art und Weise, in der er eine enge Beziehung zum Leser aufbaut, sowie der Gebrauch des Fantastischen und Magischen. Kratochvil gelingt es wie zuvor Topol, eine regelrecht intime Beziehung zum Leser herzustellen, z.B. in seinem besten und straffsten Roman Unsterbliche Geschichte oder das Leben der Sonja Trotzkij-Sammler oder Karneval. Obwohl Kratochvil dazu neigt, die Erzählperspektive nach Belieben zu wechseln, spricht die dominante auktoriale Erzählerin Soña die Leser mit "meine Süßen", "meine lieben kleinen Turteltauben" an -- und mit sogar noch mehr absonderlichen, aber übertrieben-freundlichen Formulierungen. Der verschachtelte Satzbau nimmt darüber hinaus die Form einer atemlosen mündlichen Wundererzählung an, besonders immer dann, wenn die Figur ihre Gedanken und Erlebnisse mitteilt. Der Leser fällt so in den magischen Bannkreis eines Textes, der wie für die Ohren der Leser geschaffen ist. Wie schon Topol, oder vielleicht sogar noch mehr als dieser, imitiert Kratochvil den vertraulichen mündlichen Erzählstil, diesen typisch tschechischen Aspekt literarischen Schreibens, und verwandelt den Text damit im Nu in ein Forum, in dem der Leser dem Autor begegnen kann. Diese Nähe ist so weit entfernt von der typischen Distanziertheit postmoderner Texte wie man sich nur denken kann. Kratochvil setzt außerdem ein Mittel ein, das man seine 'Lust zum Fabulieren' nennen könnte. Die Kratochvil'sche Grundbedingung des Romans, eine verteufelt gute Handlung zu konstruieren, ist das Markenzeichen seiner Romane. Ganz gleich, wie Kratochvil die bizarren, übernatürlichen, historischen, intertextuellen und andere Elemente in seinen Erzählstrom integriert -- er entfernt sich nie vom Ziel der perfekten Unterhaltung, mittels einer subtilen und gleichzeitig klar verständlichen Geschichte. Das Übernatürliche und die Magie sind die Markenzeichen der Kratochvil'schen Prosa, wie zum Beispiel in den Romanen Unsterbliche Geschichte (2000) und Lady Carneval (2004). In diesen Romanen entwickelt Kratochvil eine unrealistische Handlung, in der ständig übernatürliche Kräfte auftauchen und in die Handlung eingreifen. Die Handlung wird außerdem mit konkreten historischen und zeitgenössischen Details gespickt (beide Geschichten spielen in Brünn). Die Unsterbliche Geschichte liefert eine spannende und fließende Erzählstruktur, verbunden mit einer bizarren Kollage des erzählten Geschehens, das sich über den Zeitraum von hundert Jahren erstreckt, im Brünn der frühen österreichisch-ungarischen Monarchie. Soña, ein junges Mädchen, geboren in Brünn im Jahr 1900, wird von bärtigen Männern in Zeppelinen entführt. Unter Hypnose (bezeichnenderweise von Charcot, nicht von Freud) übermitteln sie ihr eine 'Nachricht' der hellsten Köpfe des Jahrtausends, die für die Generationen des neuen Millenniums gedacht ist. Soña erreicht in der Folge ein so hohes Alter, daß sie die Nachricht an das nächste auserwählte Mädchen weitergeben kann. Schon seit vor ihrer Geburt ist Soña außerdem instinktiv in ihren zukünftigen Mann Hugo verliebt. Der jedoch stirbt bevor ihre Beziehung im 'richtigen Leben' angefangen hat, und so nimmt eine Serie amouröser Beziehungen ihren Lauf, in der Hugo in der Reinkarnation verschiedener Tiere erneut auftaucht. All dies ereignet sich vor dem Hintergrund des vergangenen Jahrhunderts, während die Erzählung sich langsam am südmährischen Schauplatz in der heutigen tschechischen Republik entwickelt, im Herzen Europas: österreichisch-ungarische Monarchie, die wenigen Jahre der demokratischen Tschechoslowakei, Naziherrschaft, kommunistische Tristesse und Kapitalismus mit unklarem Vorzeichen -- die Geschichte endet niemals mit dem Ende der jeweiligen Epoche. Neben Soñas Begegnung mit der nächsten Inkarnation Hugos in Tierform wird in jeder Epoche eine jeweils neue bizarre Situation geschildert. Ein Familienausflug ins kaiserliche Wien zum Beispiel vermischt sich und mutiert zu einer Handlung in Soñas Pappmodell der Hauptstadt, hinter dessen Fassaden sich leere Schachteln und Kakerlaken finden; oder -- ein weiteres Beispiel -- Soñas Mission im Zweiten Weltkrieg entpuppt sich als Rettungsaktion für eine Gruppe sowjetischer Fallschirmspringer, die sich in einem Park im Herzen Brünns in Wölfe verwandelt haben. Kratochvil legt die Geschichte so an, daß er seine Heldin mit einem unorthodoxen, typisch-zentraleuropäischen Genpool ausstattet: ihr Vater ist der Sohn eines ukrainisch-orthodoxen Priesters, während ihre Mutter einer typisch gemischten, deutsch-tschechischen Familie entstammt, eine Katholikin protestantischer Prägung. In der Familie wird also Russisch, Deutsch und Tschechisch gesprochen; und Soña wächst in gewissem Sinne als 'Mischling' ohne spezifisch ausgeprägte nationale oder religiöse Identität auf, der sie sich zugehörig fühlen könnte. Ihre verrückten Episoden mit den verschiedenen tierischen Inkarnationen ihres Freundes Hugo, die implantierte Nachricht und außerdem ihr hohes Alter verleihen ihr den abnormalen Charakterzug eines Sonderlings. Man beginnt zu verstehen, was Kratochvil hier mit seinem magischen Realismus anstellt: Soñas Geschichte ist für den Autor eine Form von Exil, aber sie ist weit entfernt von einer festgefügten Definition und mehr angelegt gemäß des Rimbaud'schen "Ich ist ein Anderer." Ein einziges Kapitel gegen Ende des Romans unterbricht den Erzählfluß. In diesem Kapitel übernimmt der Autor selbst die Rolle des Erzählers und erinnert sich an seine Kindheit, die er seiner Vorstellung nach mit den quasi-mythologischen Kreaturen aus der religiösen Welt seiner Vorfahren verbracht hat, und nicht mit anderen Kindern. Er sinnt außerdem über die Wurzeln seiner eigenen Familie nach, die Parallelen mit der Geschichte Soñas hat. Und so kulminiert dieses Tierepos voller mythologischer Wiedergeburten, diese fantastische, bizarre und groteske Geschichte einer multikulturellen Frau aus Brünn am Ende in einem Satz, den Kratochvil auch für sich selbst reklamiert: "Jetzt weiß ich, daß ich nicht nur eine Mischung aus Tschechen, Deutschen und Ukrainern bin, sondern auch eine Kreuzung aus Wölfen, Geparden und Schimpansen und mythischen Bastard-Wesen, und so werde ich immer die Partei der Bastarde und Ausgestoßenen ergreifen, die eure Welt niemals akzeptieren wird." Sein Mitleid und seine Anteilnahme am Schicksal der Außenseiter entspringt seinem eigenen Dilemma, und reicht außerdem zurück in die Literatur der Romantik (die Außenwelt kann den Helden unmöglich ganz verstehen) und die der französischen Symbolisten. In seiner Fiktion erfindet Kratochvil eine Welt, in der diese 'Kreaturen' leben und aufblühen können: ein Exil. Sowohl der Einsatz des magischen Realismus als auch das offene Ende seiner Romane deuten an, daß dieses Exil in der Tat fiktiv ist, und daß es keine Lösung oder Rettung in Aussicht stellt, aber daß das Exil zumindest existiert, solange es den Text gibt. |
||||
Somit reiht sich Kratochvil in die Liste der zeitgenössischen Autoren ein, deren Oeuvre auf der Suche nach einer anderen Welt ist. Dieses spezifisch tschechische Merkmal wird dieser Tage nicht oft genug betont, vor allem der Mangel nationaler Gefühle, ein Tatbestand, der von einigen als beschämend empfunden wird (daher auch das Bemühen von Vaclav Klaus, die Bevölkerung mit nationalistischen und anti-europäischen Parolen zu erreichen). Es ist just diese Sehnsucht nach Flucht, dieser Weitblick, der so tief verwurzelt ist in der künstlerischen Wahrnehmung, nicht an die schalen Versprechungen blühender Landschaften zu glauben (ganz gleich welchen Regimes), und just diese unverblümte Art und Weise, die Grenzen der Nationalität und Regierung zu überwinden, und das Dilemma der conditio humana geradeheraus anzusprechen. |
||||
Die jüngste Schriftstellergeneration versteht das Exil also wörtlich. Ein Zitat Jáchym Topols im Magazin Hospodarske noviny spricht Bände und zeigt anschaulich, was hier vor sich geht: |
||||
"Es ist lange her, seit die Literatur der Katakomben über die Ladentische hinwegspülte. Nur einige wenige Schriftsteller sind aus dieser Zeit übrig geblieben. Meistens diejenigen, die wir gewöhnlich ins Land schmuggelten. Nach fünfzehn Jahren betritt eine neue Schriftsteller-Generation die Bühne. Erst diesen Autoren wird es gelingen, zurückzuschauen und über diese unglaublichen Zeiten zu lachen, in denen Dichtung gleich Politik war. Es ist vielleicht kein Zufall, daß tschechische Erstautoren die Geschichte als einen Sarg interpretieren und ihre Manuskripte häufig von außerhalb des Landes in die Tschechische Republik einschicken. Wie zum Beispiel Tomás Kolský, dessen Rutie and the Colors of the World in Israel spielt. Petra Hulová (*1979), die das Thema ihres Romans in der Mongolei entdeckte (Memories for my Grandmother, E.D.), Katerina Rudcenková, die ihr Buch Nights während Schreibstipendien in Deutschland und Österreich schrieb und nicht viel davon hielt. Milena Oda schreibt direkt in Deutsch. Magdaléna Platzová, die ihre Liebesgeschichte in Indien spielen ließ. Es hat den Anschein, als würden junge Talente die Tschechische Republik fliehen." |
||||
Dem gibt es nichts hinzuzufügen, außer, daß das Exil erneut Realität geworden ist. Und Simon Safránek (*1977), der zwischen Prag und Berlin pendelt, und seinen ersten Band Kurzgeschichten in Englisch schrieb, bringt die Perspektive seiner Generation in seinem jüngsten Roman 23 (2004) ins Spiel. Hier resümiert der Held der Geschichte, ein europareisender Handelsvertreter von Techno-Sound-Systemen ohne festes Zuhause, diese neue Spezies des Avantgarde-Nomaden, die zeitgenössische Erfahrung der heutigen Generation ohne Grenzen: "Letzten Endes ist jeder alleine; hoffnungslos alleine und hoffnungslos verloren." |
||||
|
(Aus dem Amerikanischen von Daniel Sturm.) |
||||
|
autoreninfo

Elena Deem fühlt sich als Fremde in allen Ländern zuhause, in denen sie bisher gelebt hat. Zu ihren wichtigsten Lebenserfahrungen rechnet sie die Arbeit an einer Gewindeschneidemaschine in einer Teppichfabrik, die Kartoffelernte, das Waschen von OP-Tüchern in einer Krankenhauswäscherei, sowie das Emaillieren von touristischen Hinweisschildern (besonders eindrucksvoll waren dabei Enten auf Teichen). In einem relativ zarten Alter betrat sie die akademische Welt und sucht immer noch nach einem ehrenhaften Abgang. Sie vertraut niemandem außer ihrem Teddybär.
E-Mail: elenad@u.washington.edu |
||||
|
|