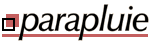
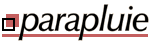 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 21: warschauer pakt
|
Russisches Internet (RuNet)Utopie, Polit-Technologie und schwarze Magie |
||
von Henrike Schmidt / Katy Teubener |
|
Viel Feind, viel Ehr -- von der tatsächlichen Bedeutung des Mediums Internet als einer Befreiungstechnologie zeugen die Äußerungen seiner Widersacher. Im April 2005 berichtet der hochrangige Offizier des Nachrichtendienstes Frolow dem russischen Föderationsrat zur Lage der Nation und zum Infektionspotential durch die revolutionären Umbrüche in 'Rußlands Hinterhof': das Internet habe in Rußland eine solche Stärke erreicht, daß es erfolgreich Meinungsmacht generiere. Frolow nimmt explizit Bezug auf die Entwicklungen in der Ukraine und in Georgien, die maßgeblich durch einen geschickten Einsatz moderner Kommunikationsmedien gekennzeichnet seien. Und fordert eine Kontrolle des Internet in Rußland, bis hin zu einer Registrierung der UserInnen. |
||||
Informationstechnologie = Befreiungstechnologie? Historischer Vorlauf | ||||
Im Jahr 1949 riefen die transatlantischen Verbündeten die so genannte 'Cocom-Initiative' ins Leben: diese stellte eine Liste derjenigen Güter zusammen, die einem Import-Embargo in die Länder des Warschauer Paktes unterlagen. Durch das Embargo sollte die ökonomische und militärische Entwicklungsfähigkeit des Ostblocks geschwächt werden. Als besonders heißes Gut galt die Informationstechnologie. Denn ohne die Entwicklung einer leistungsfähigen kommunikativen Infrastruktur sei langfristig kein Staat zu machen, geschweige denn ein Bündnis zu sichern. Die Cocom-Initiative gehört zu den wenigen erfolgreichen Beispielen für ein politisch motiviertes Embargo: die Computerindustrie in den Staaten des Warschauer Paktes und in der Sowjetunion im besonderen litt schwer unter den Einfuhrbeschränkungen. Im Land selbst gelang es nicht, diesen Wettbewerbsrückstand auszugleichen und eine konkurrenzfähige Informationstechnologie als Wissenschaftszweig und Produktionslinie zu etablieren, anders als dies in der konventionellen und atomaren Wehrtechnik oder dem Prestigeobjekt kosmische Raumfahrt der Fall war. Das wissenschaftliche Potential war dabei durchaus vorhanden. Doch zu brenzlig war der Stoff der Informationstechnologien, als daß man ihn den so genannten 'kreativen Kollektiven', die in den 1960er Jahren den Aufbruch in ein stärker selbstbestimmtes wissenschaftliches Arbeiten und Produzieren wagten, überlassen wollte. An die Stelle kreativer wissenschaftlicher Arbeit trat eine staatlich verordnete Kultur der Raubkopie, schrieb Juri Rewitsch vor einigen Jahren in der russischen Zeitung Iswestja. |
||||
Im Jahr 1991 brach die Sowjetunion zusammen. Damit war auch das Ende des Warschauer Paktes gekommen. Namhafte Soziologen wie Manuel Castells gehen davon aus, daß die Unfähigkeit der Sowjetunion, auf die Anforderungen des Informationszeitalters zu reagieren, ihren endgültigen Fall heraufbeschworen hat. Ein Erklärungsansatz, der seine Berechtigung hat. Der Wandel von der industriellen zur informationellen Wirtschaft sei nicht nachvollzogen worden, was zum ökonomischen Zusammenbruch führte. Man könnte das Argument dahingehend ausweiten, daß die gesellschaftlich Flexibilität im Ganzen fehlte, mit deren Hilfe die Modernisierungsschübe des ausgehenden 20. Jahrhunderts bewältigt werden konnten. Den Herausforderungen der Informatisierung und der Globalisierung hatte das verkrustete Sowjetsystem nichts entgegenzusetzen. Die Förderung des Internet in Rußland durch amerikanische staatliche und gesellschaftliche Institutionen ist dabei durchaus im Sinne einer Befreiungstechnologie zu sehen. Programmatisch nannte sich eine der ersten dieser Initiativen aus dem Jahr 1990 'GlasNet', gefördert von der amerikanischen Association for Progressive Communications Organisation. Glasnost und Network galten als die Zutaten des technologischen Wundermittels. Und in der Tat ist beispielsweise das (geistes)wissenschaftliche Internet in Rußland ohne das Engagement des Mäzen George Soros nicht zu denken. In den Jahren von 1996 bis 2001 förderte die Soros-Stiftung Open Society die Einrichtung von Internet-Zentren an über 30 Hochschulstandorten in Russland, von Jaroslawl bis zum Altai. Insbesondere in der Frühzeit der Verbreitung des Mediums im Land ist die Bedeutung dieser Fördermaßnahme angesichts geringen staatlichen Engagements kaum zu überschätzen. |
||||
Im Jahr 2005 bricht die Sowjetunion ein zweites Mal zusammen. Die gesellschaftlichen Umbrüche in Georgien, der Ukraine, Kirgisien, Usbekistan und Moldawien gehen einher mit einer Abwendung von Rußland, die in ihrer Radikalität über eine neue Qualität verfügt. Wieder spielen die Informationstechnologien -- nicht zuletzt das Internet -- eine zentrale Rolle: per Weblog wird von den Massen-Demonstrationen aus Kiew nach Rußland berichtet; die einzigen Medien, die halbwegs aktuell und objektiv aus den belagerten Städten Usbekistans berichteten sind Internet-Zeitschriften. Die amerikanische Einflußnahme auf diese Prozesse wird im übrigen von einigen russischen Intellektuellen nicht zu Unrecht auch kritisch im Sinne einer Fortführung der US-Interessenspolitik mit anderen Mitteln interpretiert. Die massive Unterstützung beispielsweise der Oppositionsbewegungen in Georgien oder der Ukraine, aber auch in Kirgisien, durch amerikanische Institutionen werden interpretiert als der Versuch, langfristig geopolitische Positionen zu sichern, wie der Direktor des Instituts für politische Soziologie Wjatscheslaw Smirnow im Interview mit der Internet-Zeitung Russisches Journal darlegt. Unabhängig von der jeweiligen Wertung der Vorgänge gerät Rußland, dessen offizielle Repräsentanten sich zunehmend in der Rechts- und Kulturnachfolge der Sowjetunion sehen und immer weniger Kurs auf eine postsowjetische Zukunft nehmen, durch die dramatischen Entwicklungen an seiner Peripherie zunehmend unter Druck. |
||||
Viel Feind, viel Ehr -- von der tatsächlichen Bedeutung des Mediums Internet als einer Befreiungstechnologie zeugen die Äußerungen seiner Widersacher. Im April 2005 berichtet der hochrangige Offizier des Nachrichtendienstes Frolow dem russischen Föderationsrat zur Lage der Nation und zum Infektionspotential durch die revolutionären Umbrüche in 'Rußlands Hinterhof': das Internet habe in Rußland eine solche Stärke erreicht, daß es erfolgreich Meinungsmacht generiere. Frolow nimmt explizit Bezug auf die Entwicklungen in der Ukraine und in Georgien, die maßgeblich durch einen geschickten Einsatz moderner Kommunikationsmedien gekennzeichnet seien. Und fordert eine Kontrolle des Internet in Rußland, bis hin zu einer Registrierung der UserInnen. |
||||
Die Ankündigung rief in den russischen Internet-Medien selbst eine heftige Reaktion hervor. Vergleichbare Drohungen einer staatlichen Regulierung oder sogar Zensur des russischen Internet haben schon fast Tradition, derart freimütige Äußerungen eines FSB-Offiziers, von manchen Kommentatoren als offener Verfassungsbruch gewertet, sind jedoch ein ernstzunehmendes Warnzeichen. Trotzdem werden die Ankündigungen Frolows mit beißendem Spott über seine Naivität, die eine totale Unkenntnis des Mediums offenbare, begleitet. Der Internet-Journalist Waleri Panjuschkin bemitleidet die Nachrichtendienstler gar, die tagein tagaus die E-Mail-Korrespondenz zu kontrollieren hätten. Denn eine totale Kontrolle des Internet sei rein technisch gar nicht möglich. Der Aktivismus Frolows und Konsorten ist dennoch besorgniserregend, schreibt Panjuschkin, denn er zeugt von einer Geisteshaltung, die wieder zunehmend auf Kontrolle setzt, um die eigene Position der Schwäche zu übertünchen. Eine technische Kontrolle ist aber effektiv nur da umzusetzen, wo die Gedanken der Menschen gleich mit kontrolliert werden, so der Journalist. Auf Dauer sei eine Reglementierung der Medien nur um den Preis eines Rückschritts ins Informations-Steinzeitalter möglich, meint auch sein Kollege Dmitri Butrin. Neben dem Internet hat Butrin dabei insbesondere den Mobilfunk im Auge, denn Handys werden nicht nur in den Metropolen mittlerweile exzessiv genutzt. Die derzeitige russische Regierung sieht sich damit einem klassischen Zielkonflikt gegenüber. Um den Anschluß an die globalen Entwicklungen nicht zu verlieren -- schließlich ist die Isolation der Sowjetzeit ein für alle mal passé -- ist die Förderung der Telekommunikationstechnologien nötig, zumal sie über den Konsum auch dringend benötigte Wachstumsraten verspricht. Eine politisch eigenständige -- möglicherweise sogar widerständige -- Nutzung des Mediums ist hingegen nicht im Sinne der Regierung unter Wladimir Putin. |
||||
Wer macht die Meinungsmacht im russischen Internet? | ||||
Wer aber macht die vom Nachrichtendienstler Frolow angeführte Meinungsmacht im russischen Internet, das mit einer Reichweite von circa 15 Prozent der Bevölkerung möglicherweise die kritische Masse erreicht hat, um mit dem Fernsehen als Leitmedium zu konkurrieren? Tatsächlich zeichnet sich das russische Internet -- auch im westlichen Vergleich -- durch eine Vielzahl von 'originären' elektronischen Tageszeitungen aus, d.h. von Ressourcen, die kein Offline-'Muttermedium' in Form einer Zeitung, eines Fernseh- oder Radiosenders besitzen. Diese berichten kritisch und unabhängig über nationale und internationale Politik. Unabhängig bedeutet dabei in erster Linie 'nicht staatlich finanziert', denn viele dieser E-Journals leben von politischem Geld, allerdings dem der so genannten 'gefallenen Oligarchen'. So ist es ein offenes Geheimnis, daß die populäre und auch im Westen oft zitierte Internet-Zeitschrift Gazeta.ru dem heute wohl bekanntesten politischen Gefangenen Rußlands, Michail Chodorkowski, nahe steht. Grani.ru, mit circa 20 000 Besuchern pro Tag gleichfalls eine der zentralen Informationsplattformen, wird von dem im Londoner Asyl lebenden Boris Berezowski finanziert. Das politische Internet, so der Historiker und Analyst Dmitri Iwanow, stellen in Rußland eben die Netz-Medien dar -- und nicht die Websites politischer Institutionen oder Akteure. |
||||
Neben den E-Journals im engeren Sinne spielen natürlich auch in Rußland die Weblogs eine zunehmende politische und gesellschaftliche Rolle. Der russische Internet-Forscher Jewgeni Gorny geht davon aus, daß die russische Mentalität mit ihrem stark ausgeprägten kollektivistischen Charakter die Nutzung dieses Kommunikationsgenres sogar besonders befördere. Besonders beliebt ist der Blogger-Service der amerikanischen Site Livejournal.com, die als quasi exterritorialer Raum auch künftig vor Zensur schütze. Jüngst hat die populärste russische Suchmaschine Yandex.ru einen neuen Service eingerichtet, eine Suchfunktion speziell für Blogs. Bisher sind rund 100 000 russische Blogs indiziert, auf die nun per Suchbegriff zugegriffen werden kann: |
||||
In der Tat ist der neue Such-Service ein Instrument der Navigation durch die öffentliche Meinung im Internet, mit dessen Hilfe wir der sozialen Bedeutung Rechnung tragen wollen, die den Blogs von vielen Internet-Nutzern heute zugesprochen wird, so Projekt-Manager Andrei Sadowski. |
||||
Ungeachtet der offensichtlich wachsenden Bedeutung des Internet als Medium einer kritischen und alternativen Öffentlichkeit in Rußland, versteht sich die Szene selbst in weiten Teilen keinesfalls als Opposition. Während sich -- leicht zugespitzt -- die westliche Netzöffentlichkeit mit wohligem Kampfgeschrei in das virtuelle Getümmel stürzte und gegen Kommerzialisierung, Regulierung und Instrumentalisierung des Freiraums Internet mobilisierte, bleiben die Artikulationen der russischen Netzkultur vergleichsweise still und bescheiden, ungeachtet ihrer ja von höchster Instanz -- den Nachrichtendiensten -- bestätigten Effizienz. Richard Barbrooks Manifest des Cyber-Kommunismus oder Anarcho-Kommunismus, um nur einen populären Ansatz zu nennen, stößt in der 'Heimat' des real existierenden Sozialismus auf eine Mischung von Amüsement und offener Ablehnung. Die wohl erfolgreichste Kampagne des russischen Internet, die auch internationale Aufmerksamkeit erregte, war im Jahr 2004 bezeichnenderweise die 'Stop-Barbie-Aktion'. Als Protest gegen die Dominanz globaler Wert- und Schönheitsmaßstäbe unterstützte die Netz-Gemeinschaft eine Kandidatin im Kampf um die nationale Nominierung für die Miss-Universe-Wahlen, die keinesfalls über die standardisierten Garde-Maße verfügte. Die Resonanz war groß und demonstrierte das Mobilisierungspotential. Die interaktive Abstimmung zugunsten von Aljona Pisklowa, der Undercover-Schönheitskönigin, wurde sogar als basisdemokratischer Wahlsieg gefeiert. Die ungefähr zeitgleich verlaufende Aktion des Netz-Aktivisten Oleg Kirejew, der zum Boykott der Präsidentschaftswahlen aufrief, verhallte dagegen weitgehend ungehört und wurde von den Netz-Kollegen bisweilen nachgerade belächelt. |
||||
Show also statt Substanz? Oder Information statt Agitation? Als Beispiel für letztere Herangehensweise kann der informationspolitische Nachrichtenkanal Polit.ru gelten, der im Jahr 1997 gegründet wurde und heute zu den Veteranen im Geschäft gehört. In ihrer Grundsatzerklärung beklagt die Redaktion die Verlogenheit der offiziellen Politik und will dieser eine neue, selbst bestimmte Agenda entgegenstellen. "Authentizität" ist das Ziel, in Abgrenzung von den "sekundären" Retorten-Produkten der offiziellen Medien. Zu diesem Zweck soll auch eine "neue" Sprache entwickelt werden, die in der Überwindung der offiziellen Rhetorik eine gesellschaftliche Diskussion erst möglich macht. |
||||
"Die Beziehungen der rußländischen Bürger zu ihrer Geschichte und zu ihrem Land sind heute nicht einfach. Die ideologische Sphäre ist im Ganzen mit sekundären Produkten überfüllt, unter anderem aufgrund der Unsinnigkeit und der beabsichtigen Lüge von Seiten der politischen Sphäre. Wir wollen mit echtem Inhalt arbeiten, und deshalb interessiert uns die Aufgabe der Entwicklung von Themen für die politische Tagesordnung sowie die Entwicklung einer Sprache für die gesellschaftlich-politischen Diskussionen. Dabei verstehen wir sehr wohl, daß man Ideologie nicht fälschen kann, dieses Produkt entsteht nur im Zuge einer gesellschaftlichen Diskussion." |
||||
Mit rund 30 000 LeserInnen pro Tag gehört Polit.ru zu den populärsten E-Journals des russischen Internet -- und gibt sich damit nicht zufrieden. Das Internet ist nur ein wichtiger Bestandteil eines alternativen Kulturraums mit Buchhandlungen, Klubs und eigenem Verlag, hinter dem der Philologe und Verleger Dmitri Itzkowitsch steht. Zur spezifischen Mission von Polit.ru & Co. äußerte er sich im Jahr 2001 im Interview mit der Journalistin Olga Kabanowa folgendermaßen: |
||||
"So einzigartig [Polit.ru] war, so einzigartig bleibt es auch. Welche Internet-Projekte kennen Sie denn noch, die sich ausschließlich intellektuell engagieren? [...] Für mich ist das Projekt Polit.ru eine prinzipielle Plattform, ein Vorposten meiner Weltanschauung. Wir sind doch Leute, die sich Räume aneignen. Obwohl ich selbst da keine speziellen Ambitionen hege. Verliefe das Leben anders -- in demokratischen Institutionen, in einer Bürgergesellschaft, -- ich bin nicht sicher, ob meine Business-Aktivitäten solche wären wie jetzt. Warum auch?" |
||||
Programmatisch ist in diesem Sinne die Veranstaltungsreihe der "Öffentlichen Lesungen", die Polit.ru regelmäßig im hauseigenen Kult-Klub Bilingua durchführt. Hier stehen Historiker, Ökonomen, Soziologen, Kulturwissenschaftler und Politiker Rede und Antwort zu ihren Vorstellungen über die Perspektiven des Landes. Ungeachtet des ambitionierten und explizit 'ideologischen' Anspruchs, der in der Berichterstattung und der Tätigkeit der von Polit.ru auch eingelöst wird, will man jedoch keine Opposition sein und schon gar keine Gegenkultur, wie der Chefredakteur der Ressource Witali Lejbin im Frühjahr 2005 im persönlichen Gespräch deutlich macht. Persönliches Understatement oder politische Pragmatik? |
||||
Das Internet als Naturreservat | ||||
Die Gründerzeit des russischen Internet, von seinen Protagonisten bisweilen fast zärtlich 'RuNet' genannt, fällt in die Mitte der 1990er Jahre, in denen sich auch Polit.ru formierte. Das Medium wurde zum Symbol der Aufbruchsstimmung der Perestroika, zum Inbegriff für freie und uneingeschränkte Selbstentfaltung und Kreativität im globalen Kontext. Das Netz ist das 'natürliche' Medium der Selbstentfaltung. Man(n) -- der überwiegende Teil der RuNet-Elite ist männlich -- war in seinem ureigenen Element angekommen. Die Exklusivität des Nutzer-Kreises -- zu diesem Zeitpunkt geschätzte drei bis vier Prozent der russischen Bevölkerung, der überwiegende Teil davon Akademiker und Journalisten in den Metropolen und der Emigration -- verlieh dem Ganzen Klub-Charakter, im Russischen auch tusowka genannt. In diese Zeit der Erfahrung des Internet als einem "anderen Raum" (Jewgeni Gorny), der tatsächlich kaum Berührungspunkte aufwies mit dem realen Leben, fällt die Entstehung fast aller wichtigen kulturellen und politischen Webressourcen. Die Internet-Zeitschriften Zhurnal.ru und Russki zhurnal, Polit.ru, Lenta.ru und Gazeta.ru entstanden in den Jahren von 1997-1999. Die Internationale Vereinigung der russischen Internet-Gemeinschaft Ezhe.ru gründete sich in dieser Zeit ebenso wie die beiden, heute allerdings weitgehend leblosen, Internet-Akademien. Auch die Gründerväter selbst sind heute Berühmtheiten aus quasi mythischer Vorzeit, viele dabei nach wie vor erfolgreich im Netz aktiv. Was als Hobby -- oder als rein ästhetisches Vergnügen -- begann, wurde für viele eine auskömmliche Profession. |
||||
|
Das RuNet stand also bis in die späten 1990er Jahre aufgrund der Schwierigkeiten der Transformationsperiode im gesellschaftlichen Schatten, von den Verantwortlichen in Staat und Wirtschaft weitgehend übersehen. Insofern entwickelte sich hier, fernab politischer oder ökonomischer Instrumentalisierung, wirklich eine 'andere Welt', die dem freien Spiel der kreativen Kräfte einen 'Ort' zur Verfügung stellt. Im Editorial zur ersten Ausgabe der Netzzeitschrift Russisches Journal schreibt deren Gründer und Chefredakteur Gleb Pawlowski im Jahr 1997: |
|||
"Die Frage eines Ortes für den Austausch von Ideen und Fragen ist für die Länder der russischen Sprache heute sogar wichtiger als das Recht der Gemeinschaften und der Individuen auf Selbstdarstellung; dieser Ort ist akut renovierungsbedürftig. |
||||
Die Metaphorik des Textes, geprägt von der Euphorie des Beginns, ist aussagekräftig. Das Internet als quasi natürlicher Raum, als Meer der Urzeiten, ist noch "rein" und "unbesiedelt". Wie sich diese Utopie des Internet als eines Reservoirs für widerständige und kreative Kräfte unter dem Druck der Kommerzialisierung verändert, läßt sich in den Nekrologen auf die frühe westliche Netzkultur nachlesen. In dieser Hinsicht verläuft die Entwicklung auch in Rußland nicht anders, mit dem gravierenden Unterschied, daß sich parallel zur (bisweilen noch zögerlichen) Kommerzialisierung mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts erneut eine politische Verschärfung der Lage manifestiert. Seit dem Machtantritt Wladimir Putins sind die russischen Medien in weiten Teilen unter die staatlichen Fittiche zurückgeholt worden. Insbesondere das Fernsehen steht im Mittelpunkt dieser Bemühungen, in einem weniger ausgeprägten Maße die Printmedien. Das Internet -- ungeachtet der oben erwähnten Diskussionen über eine mögliche Regulierung -- ist jedoch bis heute in der Tat unzensiert. Es bleibt ein freier Raum, doch ist es noch ein 'anderer' Raum? Der Eskapismus und Hedonismus der russischen Netzelite wird zunehmend bedroht -- und herausgefordert. Bleibt die Frage, ob man sich im Netz eine bequeme Nische sucht, oder aber diese verläßt. Der Herausforderung zur Verteidigung ihrer Freiräume stellen sich die Netz-Aktivisten nur ungern. Genauer gesagt, sie stellen sich ihr in der Praxis, lehnen aber eine publikumswirksame Etikettierung als Opposition oder Gegenöffentlichkeit ab. |
||||
Nicht-Opposition! | ||||
Exemplarisch verdeutlicht diese Ablehnung des Oppositionsgedankens das Projekt 'Rußland 2', initiiert und realisiert im Frühjahr 2005 von dem Galeristen, Kulturpolitiker und 'Polit-Technologen' Marat Gelman. Auf der Homepage der Initiative wird der Mangel einer politischen Kultur im Lande beklagt, ein Vakuum intellektueller Energie. Es fehle die Luft zum Atmen. Welche Optionen stehen den russischen Intellektuellen angesichts dieser Situation (nicht) zur Verfügung? Kooperation mit dem Staat -- unmöglich aufgrund von dessen Nicht-Reformierbarkeit und Abgeschlossenheit. Opposition -- unmöglich, weil unfruchtbar und unwirksam. Emigration oder Untergrund -- in persönlicher und politischer Hinsicht unbefriedigend und nicht zielführend. Wo liegt der Ausweg? In dem Aufbau einer unabhängigen kulturellen Infrastruktur, eines Parallel-Universums, das über eigene Medien, Künste, Institutionen verfügt. Territorial im Lande angesiedelt, stellt dieses 'Rußland 2' keine Insel dar, sondern eine Enklave -- die klassische Utopie vom 'anderen' Ort wird in den Staatskörper selbst verlagert. Erst wenn das hierarchische, vertikale und autoritative System des offiziellen Rußland zusammenbreche -- was unausweichlich früher oder später der Fall sein werde -- trete Rossija 2 an seine Stelle. Der Gedanke der Opposition jedoch wird von 'Rußland 2' strikt zurück gewiesen: |
||||
"'rußland 2' ist in gar keinem fall ein oppositionelles projekt, zumal der überwiegenden mehrheit der bevölkerung des landes das 'putin-rußland' ja gefällt. so soll es dann eben sein. das künstlerische projekt 'rußland 2' soll ganz einfach die existenz eines anderen landes in den gleichen grenzen fixieren: eines freieren, internationaleren, kritischeren landes, das die souveränität der person und die freiheit der schöpferischen tätigkeit verteidigt. |
||||
|
Das Internet, es liegt auf der Hand, ist ein nicht unwichtiger Punkt auf der Karte dieses 'Landes im Land'. Dabei ist 'Rußland 2' keineswegs ein reines Netzprojekt, nutzt jedoch die Möglichkeiten der Organisation, der Repräsentation und der Vernetzung im Web, beispielsweise über die Erstellung eines interaktiven Katalogs kooperierender Ressourcen. Das Internet ist Aktionsraum, aber in gewisser Hinsicht auch Kulturmodell. Deutlich wird dies in der Gegenüberstellung der Parameter von Horizontale und Vertikale: Das starr hierarchisch organisierte System von 'Rußland 1' unter Wladimir Putin läßt sich sinnbildlich in den präsidialen Euphemismus von der 'Machtvertikale' fassen, während das alternative 'Rußland 2' durch seine vernetzten Strukturen und seine Interaktivität gekennzeichnet ist. Dies sind positive Epitheta einer 'Netzkultur', die sich jedoch keinesfalls auf das Internet beschränkt. Der Gedanke des Internet als Kulturmodell mit seinen Eigenschaften der kooperativen Ästhetik und der flachen Hierarchien läßt sich on- wie offline gleichermaßen realisieren. Die Auftaktveranstaltung fand dementsprechend in Form einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst im Zentralen Künstlerhaus in Moskau statt. |
|||
Die Hypothek der Sowjetära -- Dissidenz und Ent-Ideologisierung | ||||
Warum jedoch diese komplizierte Konstruktion einer Nicht-Opposition, wo doch durchaus Opposition -- im westlichen Sinne -- ausgeübt wird? Woher rührt dieser Unwillen gegenüber "Präfixen" oder Etiketten? Woher stammt dann dieser Wunsch nach "Reinheit" und "Ursprünglichkeit"? Warum diese betonte Ablehnung der Dissidenz? Könnte das Internet angesichts der sich verschärfenden Machtansprüche des Staatsapparates nicht gerade ein zentrales Betätigungsfeld für eine Neuauflage der Bürgerrechtsbewegung darstellen? |
||||
Offensichtlich ist die sowjetische Dissidenz jedoch kein Modell für die heutige kritische Netz-Öffentlichkeit in Rußland. Zu sehr richtete sich diese in ihrem bürgerrechtlichen Engagement wie in ihren ästhetischen Abgrenzungsversuchen gegen die Staatsmacht. Und reproduzierte damit, so die herrschende Re-Interpretation der nachfolgenden Generation, die Werte des Systems lediglich mit einem negativen Vorzeichen. Beide Ansätze waren zutiefst ideologisch ausgerichtet und geprägt. Wirksame 'Aktion' hingegen war unmöglich. In der Zeit der Perestroika stand die russische intelligenzija dann zwar bereit zur Übernahme politischer Verantwortung, doch wurden ihre Hoffnungen enttäuscht -- nicht zuletzt aufgrund der geplatzten Utopie eines nunmehr konkret 'erfahrbaren' Westen. Die hehren Worte der 'Demokratie', 'Opposition', 'soziale Marktwirtschaft' verloren als Westimporte und ideologische Worthülsen rapide an Wert. |
||||
Polit-Technologie und schwarze Magie | ||||
Ent-Ideologisierung mag ein nachvollziehbarer Impuls und ein hehres Anliegen sein. An der postulierten Distanz zwischen 'Rußland 1' und 'Rußland 2' darf allerdings mit einem Blick auf die professionelle Biographie seines Initiators Marat Gelman mit Fug und Recht gezweifelt werden. Der Galerist gehört zu den wohl umstrittensten Figuren der russischen (Netz)Kultur, mehrte er doch seinen Ruhm in den vergangenen Jahren mehr als Polit-Technologe denn als Galerie-Besitzer. Gemeinsam mit dem einst als "grauer Kardinal" des Kreml berühmten Gleb Pawlowski, seines Zeichens Chefredakteur des Russischen Journals, gründete er im Jahr 1995 die Stiftung für effektive Politik. Die Stiftung konzipierte und realisierte staatlich anerkannte 'Content-Projekte' und Internet-Medien, organisierte erfolgreich Wahlkampagnen unter anderem für Boris Jelzin und Wladimir Putin und baute politische Parteien 'schlüsselfertig', in Rußland und der Ukraine. 2002 trennte sich der Galerist, der russischen Aktionskünstlern wie Awdej Ter-Oganjan oder Oleg Kulik zum internationalen Durchbruch verholfen hatte, von der Stiftung und wechselte als Medienanalyst und Berater zum staatlichen Fernsehen. Hier kündigte er im Frühjahr 2004 und widmete sich fortan wieder verstärkt der kulturellen Arbeit -- darunter dem Parallel-Universum 'Rußland 2'. "Als Rückkehr zu den Dissidenten" betitelten die Journalisten Arina Borodina und Viktor Chamraev diese erneute Kehrtwendung im Leben des Polit-Künstlers Marat Gelman. Im übrigen pflegt auch sein (Ex)Partner Pawlowski, der noch zu Sowjet-Zeiten wegen Tätigkeit im Samizdat im Lager einsaß, eine sorgfältig gestaltete dissidentische Biographie. Angesichts der oben zitierten dezidierten Abgrenzung des Gelmanschen Projekts von der Tradition der Dissidenz erfüllt dies mit Erstaunen. Polit-Technologe, Dissident, Galerist, alternativer 'Kulturträger'? Gelman selbst spricht von einer zunehmenden Lust am Spiel mit seinen verschiedenen Identifikationen. Der Netz-Aktivist Oleg Kirejew, einer der wenigen Vertreter einer im westlichen Sinne politisch aktiven Netz-Kunst, kritisiert diese jüngste Wandlung vom Polit-Technologen zum Regimegegner als oberflächlich bis gefährlich. Zu lange habe sich Marat Gelman auf Augenhöhe mit den Mächtigen bewegt, um nun angesichts ihrer radikalen politischen Pragmatik den Erstaunten zu spielen. |
||||
Aber was genau steckt eigentlich hinter dem in russischen (Netz)Kreisen so populären wie schillernden Begriff des Polit-Technologen, der im westlichen Sprachgebrauch so keine Analogie zu haben scheint? Ein Polit-Technologe stellt den Politikern beratend Werkzeuge für die Realisierung ihrer strategischen Ziele zur Verfügung. Er identifiziert sich nicht zwangsläufig mit den vermittelten Inhalten und politischen Botschaften, sondern konzentriert sich auf erfolgreiche politische PR. Marat Gelman vergleicht die Tätigkeit des Polit-Technologen nüchtern mit der eines Anwaltes, der gleichfalls nicht mit seinem Klienten sympathisieren müsse, um ihn zu verteidigen. In der Wahrnehmung der russischen Netz-Gemeinschaft ist der Polit-Technologe jedoch zum Mythos geworden. Mit demiurgischen Kräften ausgestattet wird er zu einem Magier des Informationszeitalters, sein wirksamstes Mittel ist die 'schwarze PR'. |
||||
Ungeachtet der bis heute vergleichsweise geringen Verbreitung des Internet in Rußland spielt das Medium für die politische PR tatsächlich eine nicht geringe Rolle. Gerne werden kompromittierende Materialien und Falschmeldungen im Internet lanciert, die dann in den traditionellen Medien aufgegriffen werden. Was sich im 'natürlichen' Raum des Internet zunächst als l'art pour l'art entwickelte, wurde zunehmend kommerziell und politisch nutzbar. Die Kreativität, das spielerische Denken, die Fähigkeit der Vernetzung -- alles genuine Eigenschaften der russischen Netz-Elite, die nun als Rohstoff der politischen Manipulationskunst dienten? |
||||
'Schwarze PR' rückt so in der mythischen Beschwörung durch die Netz-Gemeinschaft in die Nähe der Schwarzen Magie. Sie erhält einen Touch von Konspiration und Verschwörung, der mittlerweile in literarischen Verarbeitungen lustvoll in Szene gesetzt wird. So zum Beispiel in dem Roman Golem, die russische Version von Andrei Ljewkin, in dem ein Polit-Technologe -- angeblich dem Vorbild Gleb Pawlowskis nachempfunden -- eine zentrale Rolle spielt. Der Golem manipuliert im Dienste seiner politischen Herren die öffentliche Meinung, ist jedoch selbst auch Instrument. Der Autor weiß, wovon er schreibt, auch wenn sein Roman keinesfalls als autobiographisch interpretiert werden sollte. Er arbeitete zunächst als politischer Kommentator für Polit.ru und realisierte später im Auftrag der Stiftung für effektive Politik erfolgreich weitere Internetprojekte. Ljewkin siedelte erst in den 1990er Jahren nach Moskau über. Im Jahr 2001 erhielt er den renommierten Andrei-Bely-Literatur-Preis, eine alternative Literaturauszeichnung mit dem symbolischen Preisgeld von einem Rubel, für seine frühen Erzählbände. Zuvor hatte er in Riga (Lettland) maßgeblich Anteil an der alternativen Kulturszene. Heute ist er als politischer Kolumnist für zahlreiche Netz-Zeitungen tätig. |
||||
Der Golem, russische Version kann als schillernde Figur stellvertretend für die Ambivalenzen der russischen Netzkultur stehen. Der Literaturwissenschaftler Sergei Denisow sieht die Frage des Verhältnisses der Kultur zur Macht als das zentrale Thema des Romans. Bereits in den frühen 1990er Jahren hatte der auch im Westen vielfach übersetzte und bekannte Autor Viktor Pelewin diesen Motiv-Komplex der 'schwarzen' politischen PR und der elektronischen Medien zwischen demiurgischem Schöpfertum und menschlicher Hybris, technologischer Innovation und Manipulation so unterhaltsam wie treffend geschildert. |
||||
Im Internet -- oder breiter gefaßt in den Neuen Medienwelten -- verwischen die Grenzen zwischen Fiktionalität und Faktizität zusehends. Die Golems, so scheint es, verlassen den Bereich der Literatur und siedeln sich im 'realen' (Netz)Leben an. Die Biographie wird zum Gesamtkunstwerk, das sich Ansätze der Dissidenz ebenso einverleiben und anverwandeln kann wie die schwarze Magie der Polit-Technologie. Marat Gelman, immer gut für einen signifikanten Slogan, prägte in den 1990er Jahren das Schlagwort von der "Ästhetik des Engagements", in Anlehnung an die amerikanische Literaturkritikerin Suzi Gablik. Ursprünglich war damit eine politisch und sozial engagierte Kunst gemeint, wie sie in der Galerie des Meisters auch zu sehen war und heute noch in seiner virtuellen Galerie zu bewundern ist. Diese Ästhetik des Engagements äußerte sich jedoch auch bald in einer Teilhabe an einer ästhetisierenden Politik, die Inhalte der Regierung -- oder anderer politischer Kräfte -- so verpackte, daß sie schön konsumierbar wurden. Hier trifft der Polit-Technologe auf den Ästheten (und weniger auf den von Gelman genannten Anwalt): beiden geht es wesentlich um die Form und weniger um den Inhalt. Ihr Material sind in der Ökonomie der Aufmerksamkeit Kommunikationsstrategien, wie sie im Internet besonders gut nutzbar sind. |
||||
Aus Spiel wird Ernst? | ||||
Der russischen Netzkultur fällt es schwer, auf die geänderten gesellschaftlichen Bedingungen in Putins Rußland -- 'Rußland 1' -- zu reagieren. So verständlich und legitim der Anspruch auch sein mag, in einem 'natürlichen' Lebensumfeld seinen originären, kreativen Impulsen nachzugehen, so wenig läßt sich auf diese Weise der eigene Freiraum gegen die sich zunehmend verhärtenden Außenwelten verteidigen. Der Abschied vom Naturreservat Internet, das eine 'andere' Existenz in Aussicht stellte (die Utopie vom natürlichen Raum), hin zu einer Multiplizität von konkurrierenden Öffentlichkeiten, wie es die US-amerikanische Politologin Nancy Fraser formulierte, fällt schwer. Denn diese erforderte eine stärkere ideologische Positionierung, die vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Sowjetzeit instinktiv abgelehnt wird. |
||||
Eine innere Zerrissenheit bleibt spürbar, erklärbar aus eben jenem historischen Hintergrund: dem Wunsch nach Tat und Aktion, nach Einfluß und Macht (in einem durchaus positiv verstandenen Sinne) steht die tief verwurzelte Angst vor ideologischer Vereinnahmung gegenüber, vor den 'Großen Worten' und 'Großen Erzählungen' im Sinne Lyotards. Was jedoch sind die Konsequenzen einer solchen paradoxen Positionierung? Der Wunsch zur Teilhabe an der Macht verwandelt sich bisweilen in eine fragwürdige Form der Kollaboration. Und die Scheu vor politischer Ideologisierung erschwert die Entstehung einer wirksamen alternativen Öffentlichkeit, die auch die private Artikulation 'natürlicher Bedürfnisse' selbstredend beinhaltet. |
||||
Gegenanzeige: Angesichts der Vielzahl an russischen Netz-Ressourcen, Projekten und Protagonisten handelt es sich bei dem Begriff der russischen Netzkultur um eine Abstraktion. 'Die' russische Netzkultur ist in ihrer Gänze ebenso wenig zu fassen wie 'die' amerikanische oder 'die' deutsche Szene. Es handelt sich in den dargestellten Schilderungen vielmehr um die Beschreibung von Tendenzen, die uns als auffällig und typisch erscheinen und die uns angesichts ihrer Ambivalenzen -- zugegebenermaßen -- immer wieder in Verwirrung stürzen. Als Ausgangspunkt für eine eigenständige weitergehende Erkundung des RuNet und seiner Vielzahl von interessanten Projekten und Persönlichkeiten sei die Liste der "Physiognomien des Russischen Internet" empfohlen, veröffentlicht auf der Site der Internationalen Internet-Gemeinschaft Ezhe.ru (leider weitgehend in russischer Sprache). |
||||
|
autoreninfo

Henrike Schmidt Leiterin des Projektes Russian-Cyberspace.org am Lotman-Institut für russische und sowjetische Kultur der Ruhr-Universität Bochum, widmet sich schwerpunktmäßig zeitgenössischer russischer Kultur und Literatur, insbesondere moderner Lyrik und russischer Internetkultur.
Homepage: http://www.russian-cyberspace.org E-Mail: henrike.schmidt@ruhr-uni-bochum.de 
Katy Teubener Mitarbeiterin des Projektes Russian-Cyberspace.org am Institut für Soziologie der Universität Münster, beschäftigt sich neben Fragestellungen zum Strukturwandel der Öffentlichkeit durch Neue Medien mit innovativen Formen computergestützter Kommunikation und Kooperation in nationaler sowie internationaler Forschung und Lere.
Homepage: http://www.russian-cyberspace.org E-Mail: katy.teubener@uni-muenster.de |
||||
|
|