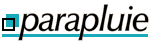
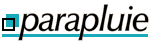 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 25: Übertragungen
|
Mordswut!Besichtigung eines Prozesses |
||
von Heiner Frost |
|
Da tötet einer. In blinder Wut. Ein Versehen, denn es stirbt der
Falsche. Der Täter entkommt. Die Polizei ermittelt ins Leere.
Ein Jahr später stellt sich der Täter. Für ihn gibt es
kein Leben mit dieser Tat - solange er nicht gestanden hat. |
||||
Wir müssen da durch | ||||
Es geht um das Leid, und das Leid hat mindestens zwei Seiten. Da sitzen Vater, Mutter und Schwester von einem, der getötet wurde und nicht gemeint war. Sieben Messerstiche haben ein Leben beendet. Das Opfer: Verblutet. Aber: Da sitzen auch Vater und Mutter dessen, der das Messer führte und der zur Tatzeit kein Kind mehr war aber auch nicht erwachsen. Die Tat selbst geschah im Dezember, dreizehn Tage vor Weihnachten. |
||||
Was tut das zur Sache? Nichts. Vielleicht zeigt es eine Dimension. |
||||
An der Tür zum Saal das Schild: Nicht öffentliche Sitzung. Verhandelt wird unter Ausschluß des Volkes. Der Täter ist nicht zur Besichtigung freigegeben. Jugendschutz. Trennlinien werden sichtbar: Volkes Stimme liebt die Rache. "Wer hat das Opfer geschützt?" fragt das Volk und antwortet: "Niemand." "Den Täter schützen sie", sagt das Volk. "Hilfe für ein Monster", sagt das Volk, denn: Wer mit sieben Messerstichen das Leben eines Unschuldigen nimmt, kann nur Monster sein. Auf dem Gang treffen die Beteiligten ein. Berichterstatter sind zugelassen: "Gestern noch Kultur, heute schon die niederen Triebe", würzt einer seinen Auftritt. Und der Kollege setzt eins drauf. "Was wird der schon kriegen?" fragt er und gibt die Antwort gleich selbst: "Drei Monate Fernsehverbot." Die Pfähle sind eingeschlagen, die Vorurteile gefällt, die Möglichkeiten vorgedacht. Es ist angerichtet. Das Personal rückt an: Drei Richter, zwei Schöffen, eine Staatsanwältin, zwei Verteidiger, zwei Gutachter, ein Nebenkläger. Schließlich: K., das Monster: Jeans. Heller Pullover. Kurze Haare. Sieht man das Schlechte in einem Gesicht? Nein. K. spricht mit leiser Stimme. Verschwindend. Verschwunden. |
||||
Der Zuschauerraum: leer. Nur Vater, Mutter und Schwester des Opfers. Zuschauer sind sie nicht. Sie verbergen Gefühle. Sitzen stumm. Fast regungslos. Der Vertreter der Nebenklage stellt fest: "Meine Mandanten werden keine Erklärungen abgeben." Es ist nur ein Beiwohnen. Sie wollen, kann gemutmaßt werden, etwas Unfaßbares nachvollziehen. Begreifen. Kann es weniger Trost geben als die Gewißheit, daß der Falsche starb? Später dann: Die Tätereltern, zunächst als Zeugen geladen. Der Vater wird nicht aussagen und gehen. Die Mutter wird aussagen und bleiben. Bis zum Ende. |
||||
K. hat sein Opfer nicht gekannt. Er hat es nie getroffen. Das Leid hat zwei Seiten. "Wir müssen da durch", sagt der Richter und meint Täter und Opfer. Es gibt auch lebende Opfer. Soll und Haben müssen abgewogen werden. Die Aktenberge sind aufgetürmt. Es tritt auf: die nachgeordnete Wirklichkeit. |
||||
Direkt an den Abgrund | ||||
Die einen haben den Saal mit Achtung betreten: Eine Kapelle für die Gerechtigkeit mag ihnen der Raum sein. Gerechtigkeit aber kann und wird es nicht geben. Der Saal: Eine Intensivstation gescheiterter Lebensentwürfe. "Hurensohn hat man sie genannt", wird später die Staatsanwältin sagen, "das ist doch keine Beleidigung. Das ist doch normal. Das lese ich mindestens zweimal am Tag." Macht das einen Unterschied? Was, wenn einer so über das Morden spräche? "Das ist doch nichts Besonderes. Ich töte zweimal täglich." Mengen machen keinen Unterschied. Aber vielleicht machen sie stumpf. |
||||
K. wird befragt. Ein Leben breitet sich aus wie ein Läufer vor dem Sofa der Gerechtigkeit. Es gibt Leben, die den Erwartungen entsprechen. Leben, die wie am Schnürchen laufen. Und es gibt Leben, die am Start schon das Scheitern ahnen lassen. Sie entbehren nicht einer gewissen Geradlinigkeit, aber: Manch gerade Linie führt direkt an den Abgrund. |
||||
Wirklichkeit kann nicht erfunden werden. Niemand würde das Ergebnis glauben. Glauben würden wir den Anfang der Geschichte: Da beendet einer am Nachmittag die Beziehung zu seiner Freundin. Was ihn treibt, ist die Angst, sie könnte ihm zuvorkommen. Dann betrinkt er sich. "Ich habe mir die Kante gegeben." Später am Abend spielt sich eben jener Teil der Geschichte ab, der alles Verstehenwollen in die Schranken weist. |
||||
K. geht nach Hause und stoppt auf dem Heimweg an einem Imbiss. Er bestellt einen Döner. Bezahlt. Will gehen. Da hört er das Wort: "Hurensohn." Er hört es und denkt noch: Du sagst jetzt nichts. Das könnte zu einer Prügelei führen. K. ist sich sicher, daß er den kennt, der ihn da beleidigt hat. An der Grenze von Vergangenheit und Gegenwart, im Dunst des Rausches, ist er sicher: Da hat der gesprochen, der ihn Jahre zuvor schon drangsaliert hat. Eine Perle auf der Kette, die Leid an Leid reiht. Der junge Mann läuft nach Hause. Seinen Döner legt er auf den Küchentisch, nimmt ein Messer aus dem Block und läuft zurück. Jetzt will er alles klären. Ein Ende machen mit den Schmähungen. Jetzt soll es passieren. Jetzt oder nie. Jetzt läuft der Film, dessen Hauptdarsteller er werden wird. |
||||
Dann reißt der Film | ||||
Als K., das Messer im Ärmel, den Imbiß erreicht, ist niemand mehr da, aber er sieht eine Gruppe von Jugendlichen -- ein paar Hundert Meter voraus. Unter denen, denkt K., muß sich der Schmäher befinden. Jetzt, dringt es durch den Rausch, muß alles geklärt werden. Minuten später hat sich die Gruppe aufgelöst. Einer bleibt übrig. K. weiß jetzt: Der ist es. Goran. Der Name. Der Haß. Das Ziel. Jetzt das Ende der Schmähungen, denkt K. und läuft los -- das Messer im Ärmel. Dann reißt der Film. |
||||
Ein Mann stirbt. Sieben Messerstiche beenden sein Leben. Das Schicksal, das sich niemandem verpflichtet fühlt, hat entschieden: Der da stirbt, war nicht der, den K. meinte. Der da stirbt, in einer Nacht, dreizehn Tage vor Weihnachten -- K. hat ihn nicht gekannt. Nie gesprochen. Nie gesehen. Auch dann nicht, als er ihn umbrachte. Hätte er denn sonst zugestochen? Siebenmal? Hätte er gemordet? "Nein!" wird die Verteidigung später sagen. Niemand mordet so grundlos. Und: Mord war das nicht. Kann das nicht gewesen sein. Es fehlte an Heimtücke. Heimtücke setzt doch voraus, daß ein Täter die Arglosigkeit des Opfers zur Kenntnis nimmt. Der da zustach, konnte von nichts mehr Kenntnis nehmen. War im Rausch. Im Haßnebel. |
||||
...was auf keine Skala passt | ||||
K. taucht erst nach der Tat aus diesem Nebel des Unbewußten auf. Seine Hand: Blutig, ein Messer haltend, das er -- ein Auto nähert sich -- in eine Hecke wirft. Er geht nach Hause. Die Mutter bringt nichts aus ihm heraus. Als draußen Krankenwagen und Polizei vorbeifahren, ahnen sie beide: Da ist etwas passiert, das auf keine Skala paßt. "Du gehst nicht mehr raus", entscheidet die Mutter für den Sohn. Für sie ist er der Junge. Er wird nie der Mörder sein. Er bleibt. Schläft. Steht am nächsten Tag früh um fünf auf, geht zu der Hecke, die das Messer birgt, findet es, nimmt es mit. Nach Hause. Die Mutter: Unterwegs in der Stadt. Als sie nach Hause kommt, weiß sie längst, was passiert ist und erzählt es. K. hört zu wie versteinert. "Ich konnte nicht glauben, daß ich das gewesen sein sollte." Das Opfer -- soviel weiß K. mittlerweile, denn die Stadt ist klein und der Tod ist schnell -- war ein Deutscher, sein Peiniger von einst nicht. Wenn einer tot geblieben ist am Vorabend, dann müßte es doch Goran sein. Da stimmt etwas nicht. Er und die Tat: Zwei Dinge, die nicht zusammen passen, obwohl K. schon ab dem nächsten Tag immer nur darauf wartet, daß es an der Türe schellt und man ihn holt. Sie werden kommen und dich holen. Diffuse Angst. Es paßt alles nicht zusammen. Diffuses Nichtverstehenkönnen. Das Leben mit der Tat. Diffuses Nichtaushaltenkönnen. Spuren werden beseitigt: Das Messer. Die Jacke. Die Schuhe. K. hat jetzt eine Komplizin: Die Mutter. Sie beginnen ihr Schweigen. Dreizehn Monate wird es dauern. Dann geht es nicht mehr. Bis dahin: Tun als wäre nichts gewesen. |
||||
Zwei Höllen | ||||
So lebt sich K. durch die Hölle. Es ist eine andere Hölle als die, die jetzt die Eltern des Opfers umgibt. In ihrer Hölle ergibt nichts mehr einen Sinn. Eine Hölle ohne Antworten. Eine Hölle ohne Täter. Eine Hölle ohne Schuld und Sühne. Eine Hölle, in der die Polizei ins Leere läuft. Man fahndet. Es kommt zu Ergebnissen. Aber es gibt keinen Erfolg. |
||||
Die Hölle des Täters: Die Ahnung einer Tat bricht stückweise ins Bewußtsein und vernichtet den Wunsch nach der eigenen Unschuld. Ohne Erbarmen. Das Nichtfassenkönnen des Bösen im eigenen Kopf. |
||||
Oder ist, was K. das Gericht da miterleben läßt, einstudiertes Verdrängungstheater auf der Suche nach dem bestmöglichen Abschneiden? K. hat sich gestellt -- getrieben von der Unmöglichkeit, das Gewesene allein auszuhalten und trotzdem gebremst von der Angst: Dann verstoßen sie dich. Eltern. Freunde. Dann gleitest du endgültig ins kalte Nichts der eigenen Schuld. Monster stellen sich nicht. |
||||
Die Fragen des Gerichts fahren immer wieder an der Trennlinie von Filmriß und Vorsatz entlang und versuchen, Unebenheiten zu finden. Immer wieder wird der Tattag abgefragt. Immer wieder geht es um ein anderes Detail. Steckte das Messer klingevoran im Ärmel? Details, die den trügerischen Filmriß widerlegen oder untermauern könnten. Gesucht wird alles. Gefunden nichts. Immer wieder das Gleiten vor die Wand der Tat, an deren Ende zwei Höllen entstehen. Zwei Leidenswege. Aber fest steht: Der Täter lebt. Das Opfer ist begraben. |
||||
Gerechtigkeit kann und wird es nicht geben, vielleicht eine aufrichtige Suche nach Wahrheit -- einer Wahrheit, die unterschiedlich schimmert, abhängig davon, welches der beiden Höllenfeuer sie ins flackernde Licht setzt. Wer in diesem Gerichtssaal an die eine Wahrheit glaubt, die alles aufklärt, kann, wird: Muß scheitern. |
||||
So geht Stimmung | ||||
Die Bestandsaufnahme am Beginn des zweiten Tages findet außerhalb des Gerichtssaales statt. Gestern war Konzert: Heute gibt es die Kritiken. Mancher Berichterstatter liefert frei Haus. Kuck ma. Die Artikel werden ausgetauscht wie Wimpel vor dem Spiel. Und einer für die Frau Staatsanwalt. So geht Stimmung. Gestern noch die Kultur, heute schon die niederen Triebe. Das Personal sucht dabei vergebens nach Namensnennung. Der Jugendschutz gilt doch nur dem Angeklagten. |
||||
Die Insider knien längst im nachgeordneten Kampfareal und diskutieren Vor-Urteile. Möglich ist alles. Von -- bis. Von, das ist das Fernsehverbot. Bis bedeutet zehn Jahre. |
||||
Die Berichterstatter haben ihre Farben angemischt und bemalen die Leinwände des öffentlichen Bewußtseins. Es wird nicht grell gemalt. Aber deutlich. Zweifel an der Aussage des Geständigen gibt es reichlich. "Der ist bestens präpariert", lautet der Tenor. |
||||
Auch das Volk spricht. "Alles Theater", spricht das Volk. "Showdown. Amerikanisches Gerichtstheater", spricht das Volk. "Wegschließen", spricht es und fordert Sicherheitsverwahrung. "Und dann schmeiß einfach den Schlüssel weg!" |
||||
So geht man mit Monstern um. Aber ein Monster stellt sich doch nicht. Auf der Anklagebank hockt auch am zweiten Tag ein Täter, dem keine Tat anzusehen ist. Zeugen marschieren auf. Und ab. Wieder zieht sich der Tag durch alles Durchzunehmende. In der Zentrifuge der Wiederholungen setzt sich ein Satz ab: "Wir hatten gut getrunken." Als ob man schlecht trinken könnte. |
||||
Der Tote: Ruhig, verläßlich. Ein guter Freund. Die Schwester des Opfers beginnt ihr Weinen. Der Täter schlägt eine weit vom Weinen entfernte Blickrichtung ein. Diese Blicke dürfen nicht aufeinandertreffen. Die Mutter des Täters verfolgt den Aufmarsch derer, die etwas gesehen haben, eigentlich nichts gesehen haben, vielleicht etwas gesehen haben, es sich so oder so vorstellen, die vorübergingen, vorüberfuhren, vorher ein letztes Mal mit dem Opfer sprachen, beim Kegeln, beim Bier, auf der Straße. Der Tag. Immer wieder der Tag. Immer wieder die Tat. Aber aus allen Aussagen entrollt sich keine neue Einsicht. Am Ende haben alle nichts gesehen. Nichts erkannt. |
||||
Der, dem alles galt -- der Haß, der Wunsch nach Klärung, der Wille zur Vernichtung -- sitzt lässig auf dem Zeugenstuhl. "Hurensohn." Ja, das Wort hat er gesagt. Aber nicht an diesem Tag. Er ist doch gar nicht da gewesen. K.: "Den habe ich nicht leiden können." Man kann leiden, mitleiden. Beileid gibt es auch. Der, dem alles galt, zeigt Oberfläche. Mehr nicht. Er leidet nicht. Er leidet auch nicht mit. Er versteht auch die Geschichte nicht, deren Teil er ist. Unwiderruflich. Er taucht auf wie eine Tätowierung. |
||||
Prozeßberichterstattung ist wie Buchbesprechung. Du liest die ersten und die letzten zehn Seiten. Beobachten heißt weglassen. Schaulaufen: "Für wen schreiben denn Sie?" Auftauchen am Day One und dann wieder zur Verkündung dessen, was es schließlich im Namen des Volkes zu sagen gibt. Was wird es geben? Drei Wochen Fernsehverbot. Für alle? |
||||
Besichtigungen | ||||
Jeder Prozeß ist Besichtigung. Täter werden besichtigt. Motive. Tattage. Vorleben. Nachleben. Beziehungen. Verstrickungen. Verbindungen. Auch am dritten Verhandlungstag -- es ist der letzte Zeugentag -- wird die Tat besichtigt. Immer wieder der Tag. Immer wieder die Trennung. Mit ihr beginnt alles Inaugenscheinnehmen. Schon am Nachmittag trinkt K. Alkohol. Danach: Ein Streit im Jugendzentrum. "Stichst du mich ab, stech' ich dich ab." Einer geht los: "Ich hol' ein Messer!" droht er. |
||||
Von denen, die hier ihre Erinnerung auf den Zeugenstuhl tragen, könnten viele doch selbst Täter sein. Aggressionen gibt es genug. Was vor dem endgültigen Sturz schützt -- vielleicht nur eine Scheibe dessen, was man Zufall nennt. Stichst du mich ab, stech' ich dich ab. Jetzt können sich viele an wenig erinnern. Das ist lange her. Auch bei ihnen trennt die Zeit Angenehmes von Unangenehmem. |
||||
Das erste Gutachten. Der Gerichtsmediziner spricht: "Wir hatten einen jungen Mann zu untersuchen, der 19 Jahre alt geworden war", beginnt er. Mord zum Nachteil des Opfers. Schon das Vokabular fühlt sich unbequem an. Von sieben Stichen ist die Rede. Einer war tödlich. Er durchtrennte die Schlüsselbeinaorta. Ein Gefäß vom Durchmesser eines Kugelschreibers. Mit diesem Stich begann das Sterben. Der Gutachter spricht von Stichkanälen und zeigt Fotos: Eine Pinzette in der Wunde deutet die Richtung der Stiche an. Am Richtertisch drängelt sich Justiz: "Können jetzt alle sehen?" Schürfwunden im Gesicht werden erwähnt. Aufgetreten sind sie beim agonalen Sturz. Was das ist, fragt die Anwaltschaft. "Der Sturz während des Sterbevorgangs." Der Sturz ins Sterben. Verblutungen nach innen und außen. Die Todesursache. |
||||
Das Sterben fand in einer Lücke statt. Der Täter erinnert sich nicht, und sonst ist ja niemand dabei gewesen. Je öfter der Tattag besichtigt wird, umso unerklärlicher klafft sie: Die Lücke. Zwei Minuten mögen es sein. Am Richtertisch führen die Beteiligten Stichbewegungen aus. Vielleicht war es ja so. "Könnte denn dieser Stich auch von hinten geführt worden sein?" Es spricht nichts dagegen. Alles um diesen Tod herum ist Lücke. Ein Niemandsland. Die Eltern des Opfers warten auf dem Gang. Die sterile Sachlichkeit, mit der hier der Tod besichtigt wird, mit der sie das Sterben erörtern, liegt jenseits jeder zumutbaren Schmerzgrenze. Nach dem Gutachter wieder Zeugen. Wieder der Satz: "Wir hatten gut getrunken." |
||||
K. auf der Anklagebank: Fast regungslos. Bis sie kommt. Ja, sie war seine Freundin. Sie war vierzehn. "Wir waren dreimal zusammen." Zuerst nur einen Monat. "Es funktionierte nicht. Wir haben oft gestritten." Die erste Beziehungspause. Dann: Ein neuer Versuch. Der endet für die Freundin -- hier trennen sich Erinnerungen -- einen Tag vor der Tat. Sie kann das nicht wirklich sicher sagen. Sie meint, daß es so gewesen sei. Jetzt spitzen alle die Ohren. Haben sie sich am Vortattag getrennt, strauchelt die Version vom Frusttrinken. Als ob der Frust nicht auch reicht, sich an zwei Tagen zu betrinken. |
||||
"Was ist denn der K. für ein Typ gewesen?" Der Gutachter ist auf der Suche nach einer geführten Tour ins Herz der Beteiligten. "Ich weiß nicht, wie Sie das meinen." "Ich meine: Was fanden Sie gut an K. und was fanden Sie doof?" "Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nie darüber nachgedacht. Ich habe ihn doch geliebt." |
||||
Jetzt schüttelt es sie. Und jetzt, im ersten Drittel des dritten Tages, jetzt taucht der Blick des Angeklagten erstmals auf. Ruht auf ihr. Mit Schmerz. Jetzt und hier: Tränen. Zwei Monate nach der Tat, sind sie wieder zusammen gekommen. Ein Mörder und ein Mädchen, die ihn immer noch liebt. Wieder liebt. Sie weiß nichts von der Tat. |
||||
Vier Monate nach dem Geständnis die letzte Trennung: Der Täter mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Trennung kommt als Brief. Er tobt. Zertrümmert Anstaltsmobiliar. Muß zur eigenen Sicherheit in die Beobachtungszelle. Ein gefliester Raum. Gummimatratze auf dem Boden und Schlaufen für die Fixierung. Alles von Kameras beschienen. Beaufsichtigtes Elend. Das Mädchen erstickt an Tränen. "Wir machen mal eine Pause", verkündet das Gericht. |
||||
Draußen auf dem Gang hallt ihr lautes Schluchzen nach. Es bewegt sich in Richtung eines Schreis. K. auf der Bank mit welkem Blick. Eine Tat frißt ihre Nachbarn. Als die Ermittlungen begannen, wird man später erfahren, gab es einen ersten Verdächtigen. Ein Junge auch. Er wird vernommen. Auch für ihn eine Trennung. Die Freundin verläßt ihn. Später bringt er sich um. Eine Tat vernichtet alle, die ihr zu Nahe kommen. |
||||
Nach der Pause eine neuerliche Besichtigung der Beziehungstrümmer. "Wie war er denn?" "Über Gefühle hat er nie viel gesprochen. Aber dominant war er." "Können Sie das erklären?" "Er hat mich nicht beleidigt. Er hat mich auch nicht körperlich angegriffen." Der Richter hilft aus: "Hat er zum Beispiel bestimmt, was gemacht wird und wann?" "Ja. So war's." Sie weint. Er weint. Sein Blick kreist sie ein. |
||||
Dann der Sozialarbeiter. Besichtigung des Vorfelds: Eigentlich war der K. ein lieber Kerl. Die Kinder im Jugendzentrum haben ihn sehr gemocht. "Nur, wenn er Alkohol getrunken hat, wurde er aggressiv. Überschritt Grenzen. Seine Taten: bekloppt und banal." |
||||
Vorher -- beim Gutachten -- ist es auch um Alkohol gegangen. Wir hatten alle gut getrunken. Auch das Opfer, das vom Kegeln kam. Und der Täter? Hypothesen werden durchgerechnet. Werte vorgegeben. Waren es zehn Bier oder fünfzehn? Alkoholisierung ist relativ. "Ich sage immer: Es gibt Leute, die mit Zweikommafünf Promille noch ein Schachturnier gewinnen. Andere liegen schon mit Einskommafünf im Koma", erklärt der Gutachter. Schwankungsbreiten. "Kann man Alkohol üben?" fragt der Verteidiger. Man kann. Es reicht schon das einfache Training am Wochenende. |
||||
Geständnis | ||||
Dann die Kommissare. Sie haben ermittelt. Nichts gefunden. Niemanden. Monatelange Fahndung brachte keinen Erfolg. Man ging ins Fernsehen. Nichts. Zeugen ließen sich hypnotisieren. Nichts. Dann schließlich der Anruf -- dreizehn Monate nach der Tat: Ein Anwalt meldet sich. Bei ihm sitzt einer, der ein Geständnis zu machen hat. Ein Monster stellt sich und erzählt seine Geschichte. Trennung, Alkohol, Streit, Döner, Hurensohn, Messer, Verfolgung, Filmriß, Flucht. "Jetzt oder nie", soll K. gesagt haben und: "Das muß jetzt sein." Wieder werden sie hellhörig. Ein "Jetzt oder nie" würde doch endlich diese Lücke mit Vorsatz füllen. Hat K. das wirklich so gesagt? "Er hat", sagen die Kommissare. Sie haben ihm nichts in den Mund gelegt. Juristen sprechen vom Vorhalt. Wenn einer K. gesagt hätte: "Und dann dachten Sie also: Jetzt oder nie", das wäre Vorhalt. Niemand hat das gemacht. Sie haben ihn erzählen lassen. Sie wissen, wie es geht. |
||||
Das Gericht legt eine Pause ein. Auf dem Rauchergang -- gegenüber der Toilettentür -- findet jetzt Familienleben unter Bewachung statt. Der Justizwachtmeister raucht. Der Täter raucht. Die Mutter raucht. Sie dürfen zusammen auf der Bank sitzen. Unterhalten sich. Jetzt endlich treffen sich ihre Blicke. Der da in Handschellen sitzt, ist der Sohn und nicht der Mörder. Der Vater ist schon am Nachmittag des ersten Tages nicht mehr erschienen. Die Mutter: Brücke zum Leben. Letzter Halt. Sie kann doch nur lieben. An jedem Verhandlungstag sitzt sie in Reihe zwei. Kommt früh. Vor allen anderen. Wenn die Eltern des Opfers kommen, steht sie auf, tritt zurück, läßt durch, setzt sich wieder. Zwischen Täter-- und Opfermutter: Ein unmeßbarer Abstand. Drei Meter im Raum werden zum Universum. Die Mutter: Seelenkomplizin. Sie hat das Messer abgekocht. Sie hat es in eine Tüte gesteckt, hat es in einen See geworfen. Sie hat die Jacke verbrannt und eine neue besorgt, eine Nummer zu groß zwar, aber identisch. Niemand sollte das Fehlen bemerken. Sie hat die Schuhe verschwinden lassen, und sie sitzt da, den Blick auf ihr Kind gerichtet. Sie kann jetzt nicht mehr helfen. Die Verhandlung: Immer wieder die Besichtigung eines Zustandes. Kann es die Lücke geben, von der der Täter erzählt? Die Vernunft der Gebildeten läßt keine Lücke zu. Die Vernunft der Besichtiger stärkt den Glauben an die letzte Bremse, die einen Menschen vor dem Schlimmsten rettet. Das Schlimmste: Das Leben eines anderen zu nehmen. Nur der Mensch, heißt es, ist in der Lage, grundlos zu töten. Vernunft macht also Mörder. Und Vernunft ist die letzte Rettung vor dem Mordsturz. Heimtücke ist menschlich. Das Volk spricht: "Eine Lücke kann es nicht geben." Lücke ist Lüge. Lücke ist Flucht. Lücke ist Tat. Am dritten Tag durchdringen sich im Saal längst Erlebtes, Geschriebenes und Gedachtes. Manche Aussage ist bereits zeitungsgestützt. Formulierungen haben Einzug in den sprachlichen Umgang gehalten und schon glauben die Dauergäste dieser Besichtigung, dabei gewesen zu sein. Längst ist jedes Detail des Tages Allgemeingut geworden. Und die Lücke? Sie wird schnell gefüllt. Mit Arglist. Vorsatz. Bestialität. |
||||
Justiz nach dem Wochenende | ||||
Der Saal: Lichtdurchtränkt, als müßte sich Lebensmut in die Räume kämpfen. Ein Raum weiß nicht von seinem Inneren. Wieder Gutachten. Jetzt geht es um die Seele. Die letzten Felder auf dem Prozeßschachbrett müssen besetzt werden. Vorher noch schnell die Vorhänge zugezogen. Zu viel Licht schadet dem gesunden Blick. Gerade noch war die Anklagebank der hellste Punkt im Saal. Jetzt ist sie ein Schattenplatz. Justiz kommt aus dem Wochenende. |
||||
Es startet: Die Jugendgerichtshilfe. Wieder wird der Angeklagte besichtigt. Die Wortzentrifuge: Abbrüche, Wiederholungen in der Biografie, Chancen, nicht genutzt, Siebzehnkommaeins Jahre zur Tatzeit, klar, ruhig, strukturiert, freundlich, offen gesprächsbereit, will Verantwortung für sein Handeln übernehmen, erkennt sich in der Tat nicht wieder. Angeregt: Jugendstrafe. Fünf Minuten Pause. Die Zeitrechnung eines Gerichtes folgt keiner üblichen Norm. Fünf Minuten sind eher zehn Minuten und zehn Minuten eher zwanzig. Spricht das Gericht von einer Fünfminutenpause, verläßt niemand den Saal. Es wird nur gelüftet. Im Saal haben alle längst Stammplätze. Auch der Schrecken braucht Gewohnheit. |
||||
Dann das Ritual: Ein Summer ertönt. Die Schriftführerin geht zur Tür des Richterzimmers. Klopft an. Kommt zurück. Nimmt Platz. Stille. Andacht fast. Dann das Gericht. "Behalten Sie doch Platz." Man erhebt sich für die Institution, nicht der Menschen wegen, die den Raum betreten. Wie fühlt sich ein Richter, wenn er einen normalen Raum betritt? Wird dann Unbedeutsamkeit spürbar? |
||||
Das zweite Gutachten ("Ich hole bewußt einmal etwas weiter aus.") beginnt mit der Kindheit. Früh trennen sich die Eltern. Ein Stiefvater hält Einzug. Die erste Zeit ("So beobachten wir es häufig") verläuft in liebevoller Normalität. Dann beginnt der Stiefvater zu trennen: Das Eigene. Das Fremde. Gute Kinder. Schlechte Kinder. Jetzt setzt Unterdrückung ein. Ein Kind glaubt an die eigene Schuld und flüchtet in Sprachlosigkeit. Was die Erwachsenen tun, wird seine Richtigkeit haben. Dann trennt sich die Mutter vom Stiefvater. |
||||
Für K. steht der Schulwechsel an. Man empfiehlt das Gymnasium. Es wird die Hauptschule. "Eine unglückliche Entscheidung", findet der Gutachter. Jetzt biegt für K. das Leben in die falsche Richtung ab. Die Schulentscheidung: Der Trennung geweiht. Geschuldet. Das Kind als Opfer. |
||||
Später, in der sechsten Klasse: Das Versagen nach einem guten Start. K. wird drangsaliert. Schon damals ist es der, der später zum Ziel des Hasses, der Verzweiflung werden wird. Hurensohn! K.s Existenz: Ein Leben aus Demütigung und Prügel. Zuhause der Vater. Draußen der Peiniger. Einmal geht K. wochenlang nicht zur Schule. Es ist die Angst vor dem, der keine Gnade zeigt. Eine Anzeige bei der Polizei führt zu nichts. K. beschließt den Strategiewechsel. |
||||
Ab jetzt wird er sich wehren. Ab jetzt wird er zurückschlagen. Jahre sind vergangen. Die erste Freundin. Zentraler Dreh-- und Angelpunkt. Lebensmitte. Zu ihr strebt alles. Die Freundin betrügt ihn mit einem anderen. Trennung. Nie mehr danach geht er eine Beziehung ein, die so viel Einblick zuläßt. Sich wehren schmälert die Leiden. Es schafft sie nicht ab. Da wächst was im Kopf des K., und der Gutachter hat Worte dafür: Affektstau. Affektsturm. |
||||
Der Gutachter und der Angeklagte: Unterhaltungen. Tests. Das Freiburger Persönlichkeitsinventar. Lametta am Christbaum des Seelenbankrotts. Auf der Spur ins Denken immer wieder die Besichtigung einer Persönlichkeit. Mittels Fragebogen. Er habe sich als Wurm gefühlt, hat ihm der Angeklagte gesagt. Sagt der Gutachter. K. zeigt bei den Tests ein gestörtes Leistungsverhalten. Er will zu schnell zur Lösung. Macht Fehler, wo er keine machen müßte. Zu schnell zur Lösung: Das erinnert an die Tat. K. ist in der Lage, sie tiefer gehend zu reflektieren. Er setzt sich auseinander mit dem Geschehenen. "Es geht nicht ohne Strafe", sagt er. "Die Strafe ist wichtig für die Angehörigen des Opfers", sagt er. |
||||
K.s Werdegang begann in der Opferrolle. Später hat auch die Wehrhaftigkeit nicht viel geholfen. Der wundeste Punkt bei den Beleidigungen: Die Mutter. Hurensohn! Immer wieder der Name des Peinigers. In roter Farbe auf einer weißen Wand. Die Innenseite von K.s Kopf: Mehr und mehr durchtränkt von der Haßfarbe. Der Alkohol wird das Ventil für die eigene Unzulänglichkeit. Für das Verletztsein. |
||||
Vom Stau zum Sturm | ||||
Der Gutachter sieht den Angeklagten vom Affektstau zum --sturm taumeln. Der Tag der Tat wird zum Tag des Sturms. Die Parade des Vokabulars. Eingeengte Wahrnehmung, Tunnelblick. Affektbedingte tiefgreifende Bewußtseinsstörung. Affekt. Das Leben hinter dem Staudamm. Endlich beansprucht es Klärung. Endlich soll hinter der Klärung alles Leiden zum Stillstand kommen. Der Imbiß. Die Beleidigung. Hurensohn! Der das sagt ist Goran. Kann nur Goran sein. Jetzt. Jetzt die Klärung. Jetzt. Jetzt das Messer. Der Döner. Jetzt konzentriert sich ein Hirn auf Bereinigung. Alles Denken wird Handeln. Nichts als das Handelnmüssen wird bleiben. Jetzt weiß K.: Der Peiniger ist die Quelle allen Übels. Aller Schwäche. Aller Demütigungen. In Rot steht es an der Innenseite des eigenen Hirns: Goran. Jetzt das Taumeln von Stau zu Sturm. Jetzt beginnt jener Spagat, den die einen im Saal nachvollziehen möchten und die anderen nicht nachvollziehen wollen. Wie kann einer nach Hause gehen, den Döner wegbringen, das Messer holen, verfolgen, dabei immer tiefer in den Tunnel geraten, zustechen, nichts wissen, nichts erkennen und dann plötzlich auftauchen und wieder Erinnerung haben? Da ist sie wieder: Die Lücke. Jetzt der Angriff der Nebenklage. Es kann nicht zusammenpassen, was nicht zusammenpassen darf. Krieg der Thesen. "Ich gebe jetzt mal folgende Hypothese vor ..." -- und dann noch eine. Noch eine. Wie kann einer den Döner wegbringen, bevor er mordet? Wie kann er das eine bewußt entscheiden und sich bei dem anderen auf Amnesie oder Affektsturm berufen? In diesem Tunnel muß es Orientierung geben. Wer Orientierung hat, handelt bewußt. |
||||
Der Nebenkläger mutiert zum lebenden Beweis des Gegenteils seiner These und bemerkt es nicht. Sein Verstehen: Professionell auf die Arbeitshypothese verengt. Dabei denkt er klar. Jedes Denken braucht, das zeigt sich hier und jetzt, einen Ausgangspunkt. Alles Denken braucht Hypothese. Muß eine Richtung einschlagen. Und sein Denken zielt auf diese eine Richtigkeit. Der Gutachter an Täterstatt. Er muß es wissen. Wissen schaffen. Was wäre, wenn..? "Und wenn wir jetzt den Hurensohn wegließen? Was, wenn es kein Bier gegeben hätte? Keinen Streit?" Kein Leben? Der Gutachter sieht den Tunnel. Da ist dieser übermächtige Wunsch, endlich alles aus der Welt zu schaffen. Als ob nicht jeder im Saal die Übermacht der Wünsche kennen würde, die alles Hindenken durch die langsam spitz zulaufende Gasse des Wollens treibt. Jetzt das Geld. Jetzt die Beförderung. Jetzt der Sieg. Jetzt die Frau. Jetzt die Zigarette. Jetzt den Mann. Alles Denken staut sich am Wünschen. Am Wollen. Am Müssen. Alles Wünschen bündelt sich um das Jetzt. |
||||
Gibt es denn einen Ausstieg? Ein letztes Entkommen? Vielleicht. Ja. Aber je tiefer man hinabtaucht in diese Gasse, umso weniger Ausstiege bieten sich. Kann denn der Täter bei allem Klärenwollen noch einen anderen Gedanken fassen? Kann er denken: "Du wartest jetzt, bis der, mit dem die Klärung sich ergeben muß, alleine ist?" Kann er denn denken: "Den schnapp' ich mir genau dann, wenn er nicht damit rechnet?" Kann er so von Heimtücke gesteuert sein? Es ist nicht auszuschließen. Aber der Gutachter sieht es anders. Wieder ein Schaugefecht der Nebenklage. Das Gericht kommentiert die erneute Attacke mit Gesten der Langeweile. Laut nicht. Aber deutlich. |
||||
Jetzt, wo alle sich anschicken, die letzten Quadratzentimeter des Täterbewußtseins zu besetzen, wird Dünnhäutigkeit spürbar. Sie möchten noch diese Arbeitshypothese durchspielen. Oder jene. Durchdenken. Alle sind sie auf der Suche nach einer Hilfestellung durch Autorität. Wenn es eine Autorität gibt, die alle Fragen beantwortet, dann wird das Urteil zur Gegebenheit. Obwohl die Sehnsucht nach dem (Gott) Gegebenen spürbar wird, wollen sie alle eine Entscheidung, die dem eigenen Kopf entspringt. "Wir werden das nicht durch Fragen klären können", klingt es aus dem Vorsitzenden. "Wir werden am Ende selbst darüber befinden müssen." |
||||
Ich hatte so'n Pappmaul | ||||
Was ist denn mit den Erinnerungsinseln? Da gibt es, mitten im Tatgeschehen, die Erinnerung an ein Messer, das fiel und wieder aufgehoben werden mußte. "Ja geht das denn?" Sich des einen bewußt zu sein und das Andere nicht zu erleben? Die Tat, so der Gutachter, muß mit großer Wucht, Intensität und Schnelligkeit ausgeführt worden sein. "Ich hatte so'n Pappmaul", hat der Angeklagte in einem Gespräch gesagt. Der Mund: Ausgetrocknet. All das findet sich in der Literatur. Aber alle Literatur ist Vermutung. Beschreibung. Die da Wissenschaft betreiben, haben die Taten nicht selbst verübt. Trotzdem gibt es Wege in das Bewußtsein der Täter. Man muß sie gehen wollen. Man darf sich nicht vor den Abgründen fürchten. Schwarz und Weiß reichen nicht aus als Farben zur Abbildung. Da fehlen das Rot für den Haß, das Grün der Hoffnung und das Grau der Ödnis. Es fehlen die Demütigungsfarben, die Angstfarben, die Farben der Enttäuschung. |
||||
Es geht um den Affekt. Es geht um das Mißverhältnis von Auslöser und Ergebnis. Die Änderung des Erlebens. Nachher steht einer neben sich und sagt: "Das habe ich so nie gewollt. Das paßt doch gar nicht zu mir." Eigentlich stand er ja vorher neben sich und ist erst danach wieder eins mit seinem Empfinden. Die Tat hat nicht in der Lücke erst begonnen. Die Tat hat sich im Leben angebahnt. Lange vorher. Die Tat ist nur Handeln. Kein Denken. |
||||
Erst danach: Postdeliktische Überlegungen. Wenn's auf die Fresse gibt, wird wenig nachgedacht. Das Denken findet erst im Nachhinein wieder statt. Aber, denken sie alle im Saal: Auf die Fresse und Morden -- das sind doch zwei Dinge. Du sollst nicht töten. Internalisierte Moral nennen sie das. Es geht um Paragrafen. Es geht um das Prozeßschachbrett. Wer besetzt welches Feld? Die Lava des Gutachtens beginnt in den Köpfen zu versteinern. Wenn sie die Unverformbarkeitsstarre erreicht hat, ist das Denken abgeschlossen. Bis dahin versuchen alle, die Form zu beeinflussen. Ein neuer Angriff: Jetzt soll die Amnesie Verdrängung sein. Nichtaushaltenkönnen des Verschwiegenen. Da hat es gar keine Lücke gegeben. Er weiß alles. Was ändert das? Es ändert nichts, läßt der Gutachter erkennen. Daß einer erst den Döner nach Hause bringt und ein Messer holt -- was sagt das über den Vorsatz im Tunnel? Stau und Sturm. Der Tag der Tat ist der Tag des Sturms. Plötzlich will alles Erlebte nur noch gehandelt werden. Die fixe Idee: Klärung. Jetzt oder nie. Das muß jetzt sein. Es paßt alles zusammen. Da ist kein unüberbrückbarer Gegensatz. Der Walkürenritt der Nebenklage findet auf Zahnstochern statt. Man erwartet beileibe kein Verständnis. Verstehen darf eingefordert werden. |
||||
Noch einmal der Alkohol. "Wir liegen über zwei Promille." Schuldunfähigkeit, so der Gutachter, ist aufgrund der Alkoholisierung nicht vorhanden. Welche Gedanken haben noch stattgefunden im Täterhirn? Wie soll der Gutachter das wissen? Sie möchten, daß er es weiß. Sie möchten, daß er eine Grenze ziehen kann. Sie möchten klares Operieren beiderseits der Grenzlinien. Nicht jedes Wünschen endet in Erfüllung. Sie alle wollen nur, was K. schon wollte, als aus dem Stau der Sturm wurde: Klärung wollen sie. Jetzt oder nie. Es muß sein. Noch Fragen an den Gutachter? Das ist nicht der Fall. "Die Plädoyers dann also morgen. Um zehn." |
||||
Finale | ||||
Sie treten an. Staatsanwaltschaft, Nebenklage, Verteidigung. Jetzt werden sie letzte Rundflüge durch den Tag anbieten, um den es immer ging. Sie werden Täterbesichtigungen vorstellen. Einmal noch. Es wird zu Ende gehen, wie es begann: Sichtweisen werden vorgetragen, und es wird sich wenig geändert haben. Alles Denken braucht einen Ausgangspunkt. Man fragt sich, ob im Kopf der Kammer (die Kammer hat fünf Köpfe) noch Spielraum ist für Bewegung, oder ob da ein Spruch längst geronnen ist. Ausgedacht. Drei Täter werden auftauchen. Ein Staatsanwaltschaftstäter, ein Nebenklagetäter, ein Verteidigungstäter. Einem von ihnen wird man glauben. Den anderen beiden wird man ein Leben in Traurigkeit zugestehen, eine Geschichte, die niemandem zu wünschen wäre. Rechtfertigung für das Getane gibt es nicht. Jetzt geht es nicht mehr um den Angeklagten -- jetzt ist die Zeit von Siegen und Niederlagen angebrochen. Die Zielgerade ist in Sicht. Die Staatsanwältin hat einen Referendar dabei: "So was hat man nicht alle Tage im Angebot", sagt sie zum Justizwachtmeister. Der Referendar artig im Anzug. Beschlipst. So was -- das ist der Prozeß. Das sind die Schicksale. Mit "so was im Angebot" braucht es ein fachkundiges Publikum. Eines, das zu würdigen in der Lage ist, obwohl in den Schranken des Gerichtes Würdigung nicht positiv ist. Würdigung bedeutet hier Kenntnisnahme. Auswertung. |
||||
Wieder wird Dunkelheit in den Saal gelassen. Der, um den alles geht, erscheint heute in Schwarz. Dabei kann er nicht gewußt haben, daß sein Hauptverteidiger nicht erscheinen wird: Todesfall in der Familie. Gut, daß sie zu zweit waren. Der Kollege kann übernehmen. |
||||
Ein Opfer ohne Gegenwehr | ||||
Die Staatsanwältin. In ruhiger Sachlichkeit wird sie viermal durch den Tag fliegen. Verschiedene Sichtweisen sind vorzustellen. Verschieden werden sie gekennzeichnet. In direkter Rede: Die Sichtweise der Anklägerin. Indirekt die Einlassungen des Angeklagten, des Gutachters, der Zeugen. Das Opfer, beginnt sie, war zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Eltern dessen, der da zu Tode kam, müssen wieder und wieder durch die Tat. Auch Plädoyers können grausam sein. Das kann niemandem vorgeworfen werden. Sie müssen durch den Tag. Durch die Geschichte. Durch das Leben. Wieder wird das Mosaik zusammengesetzt. Und wieder werden identische Steine verschiedene Bilder ergeben. Ein Opfer ohne Gegenwehr -- im Sterben die Dönerreste noch im Mund. Wieder wird es um die Merkmale der Tat gehen. Mordmerkmale oder nicht? Ging es um niedere Motive? Ging es um Heimtücke? Nein, keine niederen Motive, aber: Heimtücke? Ja! Ausnutzung der Arg--, Wehr-- und Ahnungslosigkeit. Ja. Ja. Ja. Affekt und Arglist müssen sich nicht im Wege stehen. Höher gelegene Instanzen werden angeführt. Immer wieder der BGH. Der Bundesgerichtshof. Auch die Verteidigung wird ihn zitieren und zu gegenteiligen Schlußfolgerungen kommen. Die Staatsanwältin besichtigt die Tat: Zeugengestützt. Der hat das gesagt und der das. |
||||
Natürlich: Nichts vor Gericht ist unverläßlicher als die Aussage eines Zeugen. Darüber sind Bücher geschrieben worden. Was aber tun, wenn es keine objektiven Spuren gibt? Was tun, wenn da nur diese Mosaiksteine bleiben und ein Gutachten von einem, der versucht hat, hinterher zu fliegen in diese Schlucht der Tat? Alles wird gewürdigt. (Zur Kenntnis genommen. In die Überlegungen einbezogen.) |
||||
Ein Opfer ohne Abwehrverletzungen. Dönerreste im Mund. Aus der Mutter des Opfers bricht Verzweiflung, deren Unermeßlichkeit mit der Unterdrückung ansteigt. Sie weint leise. Die Staatsanwältin spricht zum Täter. Sieht ihn an. Sie füllt ihm die Lücke. Mit Heimtücke. Sie gewährt ihm Einlaß in die Minuten der Abwesenheit aus dem eigenen Denken. Sie hat keine Zweifel an der Absicht. K. hat zugestochen, um zu töten. Sie zitiert den Gutachter: Da war die Idee Goran. Mit den Fingern malt sie Gänsefüßchen in die Luft. Goran sollte es sein. Der übermächtige Feind im Hintergrund. Im Hinterkopf. K. selbst -- ein Verlierer im eigenen Leben, der einmal nicht verlieren will. Er gibt der Wut, dem Haß einen Ausweg, ein Ventil. |
||||
Amnesie? Vielleicht. Vielleicht gibt es da eine Erinnerungsstörung, die der Kopf zum Eigenschutz aufgebaut hat. Eine tiefgreifende Bewußtseinsstörung? Möglich. Dann das Aber. Die Steuerungsfähigkeit mag beeinträchtigt gewesen sein. Nicht die Einsichtsfähigkeit. Ein wehrloses Opfer ohne Chance. Das hat der Täter gewußt. Er hat es genutzt. Und wieder der BGH: Es ist möglich, spricht die Instanz. Einsicht ohne Steuerung. Das Geständnis? Es muß einfließen in das Strafmaß. Sie will erwähnt haben -- Auswirkungen soll das nicht haben: Ein spätes Geständnis. Geschuldet der Mutter. Das darf dem Angeklagten nicht zum Nachteil gereichen. Jugendstrafe. Neun Jahre, zwanzig Minuten Pause. |
||||
Du sollst nicht töten! | ||||
Dann die Nebenklage. "Damit das klar ist: Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie sind ein Mörder." Gefangene werde nicht gemacht. Der Nebenkläger läßt nichts gelten: Keine Beleidigung. Keine Amnesie. Keine Verwechslung. |
||||
Dann durch das Opferleben. Ein ruhiger, sympathischer junger Mann. Zeugen werden zitiert: "Mit dem konntest du keinen Streit haben." Beliebt im Betrieb. Die Prüfung wäre glänzend gelaufen. Dann der Einstieg ins väterliche Geschäft. Familiengründung. Die Mutter jetzt am Rand. Tief die Schlucht. Schwer der Schmerz. "Und dann der Verbrecher, der sich aufschwang, über Leben und Tod zu entscheiden. Kalt. Berechnend." |
||||
Die Nebenklägerzentrifuge: Bedürfnis nach wahlloser Aggression, niedere Beweggründe, zurechtgelegte Geschichte, Zeit war genug. Aber: Im Zuge einer fairen Prozeßführung ["In dubio pro reo und nolens volens"] "müssen wir zu einer anderen Würdigung des Tatgeschehens kommen." |
||||
Der Nebenkläger nennt die Beweisaufnahme eine "geschmälerte prozessuale Wirklichkeit". Er weiß, wie es wirklich war. Trotzdem: Es muß wohl von einer affektbedingten tiefgreifenden Bewußtseinsstörung ausgegangen werden. Das späte Geständnis: Ein anwaltsgesteuerter Kunstgriff, als längst schon zu viele von der Tat wußten. Einem solchen Geständnis ist nicht der Stellenwert zuzubilligen, den sich die Verteidigung erhofft. Affekt und Heimtücke schließen sich nicht aus. Literaturstellen werden angeführt. Der Täter hatte das Messer im Ärmel. Heimtücke. Er hat sein Opfer verfolgt und erst angegriffen, als es alleine war. Heimtücke. "Sie sind ein Mörder. Wären Sie älter, dann würde Ihnen Lebenslänglich drohen." Der Gutachter hat es gesagt: Auch beim Kerngeschehen der Tat war es im Täterkopf internalisiert: DU SOLLST NICHT TÖTEN! Der Angeklagte aber hatte entschieden: Ich will die Überraschung nutzen. Ich will ihn heimtückisch töten. Den Rest hat die Staatsanwältin ausgeführt. Neun Jahre, die Kosten der Nebenklage. "Wollen Sie 'ne Pause?" fragt das Gericht die Verteidigung. "Nee, nee." |
||||
Dann: Die letzten Besichtigungen. So viel vorweg: Das Geständnis des Angeklagten: Keine vorbereitete Sache. "Das können Sie mir ankreiden. Der Angeklagte hat es mir erzählt. Ich habe gesagt: So kannst du das bei der Polizei erzählen." Offenheit ist erkennbar. Der Verteidiger mit einer leisen Unbeholfenheit. Er war nicht vorgesehen. Er muß da durch. Heimtücke? Nein. Wenn einer, Auge in Auge mit dem Opfer, den Falschen tötet, wie soll er dessen Ahnungslosigkeit betreten? Wieder der BGH. Es reicht nicht, die Ahnungslosigkeit zu bemerken. Eine bewußte Ausnutzung ist erforderlich. Die lag nicht vor. Es stirbt der Falsche. [Siehe oben.] Das Geständnis: Nicht zu spät und aus Not. Das Strafmaß soll in Absprache mit dem Angeklagten in das Ermessen des Gerichtes gestellt werden. Das Gericht wird eine angemessene Strafe auferlegen. |
||||
Dann, ein letztes Mal, der, um den es geht. Die letzten Worte. "Mir tut es leid, daß ich nicht mehr Klarheit in die Sache bringen konnte." Gestanden hat K., weil er mit dieser Tat nicht mehr leben konnte. Er wird die Strafe des Gerichtes akzeptieren. Er wird sie auf sich nehmen. Die Strafe wird zu Ende gehen. Der Schatten dieses Todes im eigenen Kopf wird bleiben. Bis ans Ende. Was er der Familie angetan hat, tut ihm unendlich leid. |
||||
"Wir unterbrechen mal kurz." Die fünf Minuten sind jetzt vier. Drei vielleicht. "Das Urteil, auch wenn wir wissen, daß das für die Angehörigen und den Angeklagten eine große Belastung darstellt: Morgen früh um zehn." |
||||
Im Namen des Volkes | ||||
Noch einmal treffen sie ein. Staatsanwältin, Nebenklage, Verteidigung, das Gericht, die Mutter, die Eltern, die Berichterstatter. Jetzt hilft niemand mehr. Im Namen des Volkes wird gesprochen werden. Das Urteil: Es kann Vergeltung sein oder Brücke. Das Gericht hat die Zielgerade überschritten. Was noch fehlt, ist eine Berichterstattung. Verkündung. Was jetzt fehlt ist die Besichtigung eines Urteils durch das Volk, in dessen Namen es gesprochen wird. |
||||
Das Wetter am letzten Tag: Noch schöner. Der Saal des letzten Tages: Alle Vorhänge befehlen Dunkelheit. Kronleuchter müssen arbeiten. Jeder Lichtstrahl wird zum Irrläufer. Stehen die Zeichen auf Vergeltung? Der Nebenkläger und die Opferfamilie im Gespräch -- hingeflüstert in den Saal. Information. "Wenn der Richter hereinkommt, stehen wir auf." Das wissen sie längst. "Dann wird das Urteil verkündet. Wir bleiben stehen. Danach die Begründung." Draußen der Sommer. Drinnen die Nacht. Nun also das Ende, obwohl es doch gar kein Ende geben kann, solange noch einer weiterlebt mit den Erinnerungen. Zwei Familien in Scherben. |
||||
Die Berichterstatter schließen Wetten ab. Vom Fernsehverbot spricht heute keiner mehr. Heute kommen die Gipfelstürmer. Sie waren bis jetzt nicht da. Aber ein Urteil kann Sensation sein. Der Rundfunk: "Kollegen, seid ihr alle Schreiberlinge?" Na bitte. Soll er doch der Erste sein, während der Begründung hinauslaufen und durchgeben: "Sechs Jahre. Sechs Monate. Und die Kosten der Nebenklage. Es war Mord." |
||||
Der Radiomann fragt schon jetzt nach der Stellungnahme im Anschluß. "Das machen wir dann draußen im Hof." Dann der Summer. Dann der Angeklagte. Dann das Klopfen. Dann das Gericht. Im Namen des Volkes. Sechs Jahre. Sechs Monate. Kosten der Nebenklage. Es war Mord. Jetzt spricht das Gericht. Ein Volk besichtigt das Urteil. Ein letztes Mal die Zentrifuge: Sinnlos, tragisch ausgelöscht, ein fröhliches und unbeschwertes Leben, wir wissen jetzt, was passiert ist, aber es mindert nicht die Tragik. Das Gericht sieht letzte Details, deren Klärung nicht möglich war. Nie möglich sein wird. "Es ist wenig hilfreich, offene Fragen mit Spekulationen zu beantworten." Das Gericht sieht kein unglückliches Zusammentreffen unglücklicher Umstände. Das Gericht sieht Mord. "Es ist nicht die Wut, die mit dem Messer losmarschierte", spricht der Vorsitzende den Angeklagten an, "das waren Sie. Und Ihre Verantwortung geht über all das hier weit hinaus." |
||||
Das Gericht stellt klar: Es ist nicht einverstanden mit der Tatbesichtigung des Nebenklägers. "Nichts spricht für das Ausleben einer wahllosen Aggression." Was da passierte, war keine amokartige Tat. Aber: Es war Mord. Das Gericht, wieder Bezug nehmend auf die Einlassungen des Nebenklägers in seinem Plädoyer, hält das Geständnis des Angeklagten keineswegs für "abgesprochen und ausgedacht". Aber: Es war Mord, was da geschehen ist, am Abend jenes 9. Dezember. Was während des Kerngeschehens -- diese Vokabel hat sich für die eigentliche Tat längst eingefressen -- im Kopf des Täters vor sich ging, läßt sich nicht feststellen. Jetzt nicht. Nie mehr. Wie sollte denn der Angeklagte, lange vor der Hauptverhandlung, am Tag seines ersten Geständnisses, denn auch wissen, was es zu sagen galt im Hinblick auf ein späteres Gutachten? Die Nebenklage geht unter. Und sie bekommt es gesagt. Deutlich. |
||||
Das Gericht sieht die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten am Tattag eingeschränkt. Ja. Nicht aber die Einsichtsfähigkeiten. Der da tötete, tat dies heimtückisch, denn er war in der Lage, die Arg-- und Wehrlosigkeit seines Opfers zu registrieren und Nutzen daraus zu ziehen. "Als Sie das Messer gehoben haben, taten Sie das in deutlicher Tötungsabsicht." Wieder wird es gesagt: Das Opfer ohne Abwehrverletzungen, den Döner noch im Mund. Ohne Chance. Ja, das Gericht glaubt, daß es um die Idee der Klärung ging. Das Gericht glaubt an die Idee Goran. Es war viel betrunkenes Volk in der Stadt an jenem Abend. Und die Beleidigung im Döner--Imbiss: Sie hat stattgefunden. Später dann der Handlungssturm. Und auf dem Grund des Sturms: Die Absicht zu töten. Die Tat: Impulsiv. Schnell. Abrupt. Mord. Heimtücke. Amnesie? Das Reich der Spekulation. Vielleicht. Unerheblich im Übrigen. Es macht keinen strafrechtlich relevanten Unterschied. Vielleicht Amnesie. Vielleicht Verdrängung. Das kühle Nachtatverhalten, der Gutachter hat es erklärt, spricht nicht gegen den Affektsturm. Das Auftauchen aus der Gasse der Tat: Plötzlich. Unerwartet. Zurücktauchen in das eigene Leben, nachdem das andere erloschen ist. "Vollkommen schuldunfähig waren Sie nicht." Wieder die Heimtücke: "Wir meinen, erkennen zu können, daß Sie die Arg-- und Wehrlosigkeit des Opfers erkannt und ausgenutzt haben." Das wirkt der verminderten Schuldfähigkeit nicht entgegen. Das ist eine Parallelität von Affekt und restbewußtem Handlungssturm. |
||||
Dann der Satz, der Brücken baut, der Vertrauen gibt und Hoffnung, der zeigt, daß die Kammer sich auf ernsthafte Suche nach dem richtigen Maß gemacht hat. "Das Urteil, das wir hier sprechen, sprechen wir im Namen des Volkes, aber es kann nicht ein Urteil im Namen der Mütter sein." Wer es jetzt nicht versteht, was soll man ihm sagen? Es gibt kein Maß für einen Mord. |
||||
Die Kammer sieht das Geständnis des Täters nicht als Notnagel (wieder geht die Nebenklage unter), sie wertet es elementar. "Es gab ü--ber--haupt keine Hinweise auf den Täter." Ein deutlicheres ü--ber--haupt läßt sich nicht sprechen. In ihm steckt der Ruf nach fairer Bewertung dessen, was der Täter angeboten hat: Das Geständnis. Umfassend. In alles Einblick gewährend. Ein Signal: Man kann mit so etwas nicht leben. Die Tat wäre niemals aufgeklärt worden. |
||||
Nein: Die Kammer macht den Täter nicht zum Helden. Es ist der Tag der Brücken. Es war Mord. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt kein Maß. Es gibt einen Weg. |
||||
Die Verteidigung sieht ein maßvolles, durchdachtes Urteil. Die Staatsanwältin ist zufrieden, daß die Kammer auf Mord erkannt hat. Über das Maß ließe sich diskutieren. Der Nebenkläger spricht mit der Familie des Opfers. Die Berichterstatter machen sich auf den Weg ins Leben. Fünfzig Zeilen. Sechzig. Siebzig. Der Angeklagte bleibt in Haft. In Handschellen tritt er den Rückweg in ein anderes Leben an. Im Knast warten sie auf ihn. Morgen ist Sommerfest. Mit dem Motto dieses Jahres haben sie drin schon T--Shirts bedrucken lassen -- eins davon wird er bekommen und darauf steht Weiß auf Schwarz: "Macht Knast frei?" |
||||
Nachwort: Strafe ist Teil unserer Kommunikation | ||||
Berichterstattung ist ohne Standpunkte nicht möglich, denn es gibt kein positionsloses Denken. Nicht einmal Kenntnisnahme kann neutral stattfinden, es sei denn, sie ist gleichzeitig Vergessen. |
||||
Das wurde mir in dem Augenblick klar, als ich nach Abschluß des Prozesses mit einem Bekannten telefonierte. "Wo hast du in den letzten Tagen gesteckt?" "Beim K.--Prozess." Damit konnte er nichts anfangen, obwohl doch viele über eben diesen Prozeß sprachen. Kürzlich, so mein Bekannter, sei doch dieser M.--Prozeß zu Ende gegangen. Ob ich denn davon gehört hätte? Es stellte sich heraus, daß wir über denselben Prozeß gesprochen hatten. Für mich trug er den Namen des Täters, für meinen Bekannten den Namen des Opfers. |
||||
Im Lauf des Prozesses wurde immer wieder nach dem Grund einer Tat gesucht, aber auf dem Grund dieser Tat ließ sich nichts finden, außer vielleicht einer nächsten Grundlosigkeit, die man eher als Bodenlosigkeit bezeichnen müßte. "Strafe", schreibt der Künstler Jürgen Vogdt, "ist ein Teil unserer Kommunikation." Dieser Satz ist in seiner monströsen Einfachheit so klar, daß niemand ihn ausspricht. |
||||
Wenn aber Strafe ein Teil unserer Kommunikation ist, dann scheint eines sicher: Täter und Gericht können über weite Strecken kaum jemals auf Augenhöhe kommunizieren, weil sich beide Seiten fremd sind und über weite Strecken auch fremd bleiben. |
||||
Wir erwarten von der Justiz "professionellen" Umgang mit einer Tat, mit einem Täter, mit einer Strafe. Was aber kann professioneller Umgang sein? Wie kann professionelle Kommunikation ablaufen? |
||||
Man wird sich spätestens an diesem Punkt von dem Begriff Gerechtigkeit zu verabschieden haben und auf eine Nebenstraße ausweichen müssen. Wenn schon nicht Gerechtigkeit, dann vielleicht aber doch ein Gerechtwerden im besten wie auch im emotionalsten, also naivsten Sinn. |
||||
Für Gefühle aber, so die mehrheitliche Einschätzung, ist Justiz ungeeignet. Gefühle können irregehen, fehlleiten und den Blick verstellen. Wie aber ist es mit der Objektivität? Sie ist, genau besehen, doch nichts als ein Gespenst, ein unerfüllbarer Wunsch oder dreiste Anmaßung von Besserwissern. |
||||
"Das Urteil, das wir hier sprechen, ist ein Urteil im Namen des Volkes, aber es kann kein Urteil im Namen der Mütter sein." Dieser Satz aus der Urteilsbegründung des Kammervorsitzenden spiegelt genau dieses Chaos auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Er spiegelt einen Ausschnitt aus eben jener Portion an Unmöglichkeit, mit der es alle aufzunehmen haben, die sich einem solchen Prozeß stellen und somit in den Weg stellen. Mit Juristerei allein ist einem solchen Fall nicht beizukommen und mit Schlagzeilenjournalismus wohl auch nicht. "Dönermörder bekam sein Urteil geschenkt", "Wer weint denn mit den Eltern des Opfers?" Was tun, wenn für den Prozeß am Ende fünfzig Zeilen bleiben? |
||||
"Ich hätte mir acht Jahre gegeben. Und ich hätte auch zehn Jahre akzeptiert", sagte mir K., als ich ihn nach dem Prozeß bei eben jenem Sommerfest traf, das in der JVA (Justizvollzugsanstalt) stattfand, in der ich die Redaktion der Knastzeitung betreue. Vorher hatte ich ihn auf dem Hof beim Bullenreiten gesehen. 35 Sekunden hatte er sich auf der Attrappe gehalten, bevor er lachend abstürzte. Als ich ihn lachen sah, fühlte ich mich eine Sekunde lang fremd in mir. Wie kann der denn noch lachen, dachte ich. Aber was sollen wir verlangen? Lebenslanges Lachverbot ohne Bewährung? Das geht in seinem skurilen Zynismus schnell in die Richtung vom dreiwöchigen Fernsehverbot. Einer wie K. muß doch lachen dürfen. |
||||
Es wird noch genügend Momente geben, in dem ihm eben jenes Lachen wegfriert. K. will im Knast eine Ausbildung machen. |
||||
"Für mich ist das hier ein Neuanfang", sagt er. "Ich hätte ohne das Geständnis mit dieser Tat nicht weiter leben können", sagt er. Vielleicht hat das Geständnis einen Teil des Drucks von ihm genommen. Vielleicht, so hoffen wir, hat im Sich--Stellen--und--Gestehen genau jene Notbremse nachgewirkt, von der wir glauben, daß sie eine Tat wie die von K. unmöglich macht. Als ich ihm von meinem Text erzählte, bat er um eine Kopie. Er wird sie bekommen. |
||||
Eine Printversion dieses Textes, mit einem Vorwort von Jürgen Vogdt, einem Nachwort des Autors, sowie sämtlichen Pressemitteilungen, die von der Polizei zwischen Nachtattag und dem Sich-Stellen des Täters erschienen sind, ist bei edition anderswo erhältlich. |
||||
|
autoreninfo

Heiner Frost geboren 1957 in Rees am Niederrhein, lebt heute mit Frau und Tochter Lena in Kranenburg (Niederrhein). Kompositionsstudium an der Robert Schumann Musikhochschule in Düsseldorf. Berufe: Journalist, Autor, Komponist, Dirigent.
Veröffentlichungen:
Lenzenhorst oder: Die Zeit ausschütten (2002, edition anderswo)
Homepage: http://www.heinerfrost.de |
||||
|
|