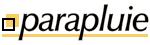
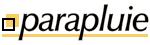 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 26: visuelle kultur
|
"Them Lips Foretold These Apocalypse"Wovon Rapper reden, wenn sie vom Weltuntergang reden |
||
von Florian Werner |
|
"This is a world destruction, your life ain't nothing, / The human race is becoming a disgrace ..." Die Texte vieler US-amerikanischer Rap-Platten vermitteln den Eindruck, daß das Ende der Welt nahe ist. Die fraglichen Rap-Texte beschwören allerdings nicht einfach nur 'blinde Gewalt' und globale Zerstörung -- sie verknüpfen den apokalyptischen Diskurs vielmehr immer wieder mit aktuellen politischen Fragestellungen. |
||||
|
||||
Hört man sich die Texte US-amerikanischer Rap-Platten an, so könnte man gelegentlich den Eindruck gewinnen, daß das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht: Die Apokalypse ist, vor allem im politisch orientierten message rap, ein häufig wiederkehrendes Thema. Ihr Faible für diesen biblischen Topos weist die heutigen Rapper als legitime Erben jener afro-amerikanischen Sänger sowie fire and brimstone-Prediger aus, die bereits Anfang des 20. Jahrhunderts das Eintreffen globaler Katastrophen prophezeiten. Die fraglichen Texte beschwören allerdings nicht einfach nur 'blinde Gewalt' und globale Zerstörung -- sie verknüpfen den apokalyptischen Diskurs vielmehr immer wieder mit aktuellen politischen Fragestellungen. Im folgenden möchte ich drei emblematische endzeitlich gefärbte Rap-Texte vorstellen -- einen aus den 1980er Jahren, einen aus den 1990ern sowie einen, der kurz vor der Jahrtausendwende entstand -- und sie in ihrem jeweiligen historischen Kontext interpretieren. Den Anfang vom Ende macht eines der ersten apokalyptischen HipHop-Stücke überhaupt: World Destruction des legendären DJs und Rappers Afrika Bambaataa. |
||||
Time Zone featuring Afrika Bambaataa und John Lydon: | ||||
Der 1960 geborene Afrika Bambaataa gilt aufgrund seines eklektischen musikalischen Geschmacks innerhalb des Old School Rap, in den Worten von Nelson George, als der "master of records" -- als Archivar obskurer Platten, über die kein anderer DJ in der Bronx verfügte. Auch das apokalyptische electro funk-Stück World Destruction, das Bambaataa 1984 zusammen mit John Lydon unter dem Namen Time Zone veröffentlichte, reflektiert sein unorthodoxes und breitgefächertes musikalisches Interesse. |
||||
Die Wahl von Lydon als Co-Vokalist ist ebenso überraschend wie passend. John Lydon war unter dem nom de guerre 'Johnny Rotten' Sänger der Sex Pistols und eine der charismatischsten Persönlichkeiten der britischen Punk-Bewegung gewesen. Er hatte sich auf der 1977 erschienenen Platte Never Mind the Bollocks nicht nur selbst zum Antichristen ausgerufen, sondern auch der Punk-Bewegung ihren bekanntesten Slogan gegeben, welcher das apokalyptische Denken 'in eine Nußschale' packte: "No future". |
||||
Auch John Lydons und Afrika Bambaataas World Destruction ist weitgehend illusionslos-nihilistisch. Das Stück beginnt damit, daß Bambaataa und Lydon unisono den Satz "Speak about destruction!" skandieren -- eine Forderung nach endzeitlicher Rede, die sie umgehend einlösen. Es geht, das legt schon der Titel nahe, um die Zerstörung der Welt; allerdings nicht durch göttliche Intervention, sondern durch Krieg. |
||||
This is a world destruction, your life ain't nothing, |
||||
In der Tradition der endzeitlichen Indizien aus dem Markus-Evangelium waren Kriege und Kriegspropaganda immer wieder als Anzeichen der bevorstehenden Apokalypse gedeutet worden. In der ersten Strophe von World Destruction geht es nun um eine besonders grausame Art der Kriegsführung: jene mit chemischen Waffen, wie sie zum ersten Mal während des Ersten Weltkriegs gebraucht worden waren, von den USA im Vietnamkrieg verwendet und zur Zeit der Veröffentlichung von World Destruction vom irakischen Präsidenten Saddam Hussein gegen den Iran eingesetzt wurden. Der Grund für die bevorstehende Zerstörung der Welt ist also kein individuelles Vergehen (einer einzelnen Regierung, Nation oder Volksgruppe), sondern, in der Terminologie Jürgen Moltmanns, eine "Struktursünde": Die "human race" ist in ihrer Gesamtheit mitschuldig am desaströsen Zustand der Welt. |
||||
Hatten Bambaataa und Lydon die expositorische Strophe noch zusammen gerappt, so übernimmt in der zweiten Strophe Bambaataa alleine das Amt des Untergangspropheten: Zunächst wird von ihm der unter dem Namen 'Nostradamus' bekannt gewordene französische Seher Michel de Notre-Dame als Gewährsmann für das Kommen des Antichristen bemüht -- tatsächlich hatte Notre-Dame in seinen weitgehend deutungsoffenen Vierzeilern das Kommen von insgesamt drei Antichristen prophezeit und für das Jahr 1999 den Anbruch einer apokalyptischen Schreckensherrschaft vorausgesagt. In World Destruction wird diese Vorhersage nun im Sinne einer Erhebung der 'Dritte-Welt-Länder' interpretiert, und zwar gegen die "Democratic-Communist relationship", eine vermutete Kollaboration des West- und des Ostblocks und ihrer Auslandsgeheimdienste. Bei dem Antichristen handelt es sich also, wenn man die zweite Zeile der zweiten Strophe als Auslegung und Konkretisierung der ersten Zeile liest, mutmaßlich um die "third world nations", die hier mit dem Islam assoziiert werden. Zugleich wird der aus christlicher Sicht 'Altböse Feind' positiv umgewertet, nämlich als Kraft, welche die verkommene, von dem 'System', den Medien und nicht zuletzt den Kirchen gehirngewaschene 'Erste' und 'Zweite Welt' vernichten wird. |
||||
Nostradamus predicts the coming of the Antichrist, |
||||
Sind die Antagonisten in den ersten drei Strophen noch relativ klar umrissen, so verschwimmen die Fronten des angekündigten Endkampfes im weiteren Verlauf des Textes zusehends. Ein Couplet, das den von einem dröhnenden Synthesizer-Riff dominierten instrumentalen Refrain einläutet, bringt zunächst das Motiv des Atomkriegs mit ins Spiel: "Yes, the world is headed for destruction / Is it nuclear war? What are you asking for." Dann, am Ende des Refrains, zählt John Lydon nach Art eines Bandleaders, der das Tempo vorgibt, die nächste Strophe ein -- allerdings auf Deutsch und mit einer Stentorstimme, die eher einen Marschrhythmus denn einen HipHop-Beat erwarten läßt, Assoziationen an den Zweiten Weltkrieg weckt und die Supermächte USA und UdSSR assoziativ in eine Reihe mit dem deutschen Faschismus stellt. Die folgenden Strophen schließlich ergehen sich teils in nihilistischen Allgemeinplätzen, teils hinterfragen sie das menschliche Streben nach Erkenntnis, das angesichts des Weltendes doch immer ganz eitel erscheinen muß -- und zwar interessanterweise nicht nur für Christen, sondern auch für die Anhänger des Islam und des Hinduismus. |
||||
Im zweiten Refrain stilisieren sich Bambaataa und Lydon alias Time Zone schließlich selbst als kriegsführende Mächte, die angeblich über Massenvernichtungswaffen (oder, im HipHop-Jargon: über besonders desaströse beats) verfügen ("We are Time Zone, we've come to drop the bomb on you!"), versichern sich aber daraufhin umgehend in einem über den instrumentalen Refrain gesprochenen Dialog, daß sie beide bereits am Rande des Wahnsinns stünden. Diese Selbstanalyse manifestiert sich unter anderem in Lydons rotzig-megalomaner Forderung, er wolle Herrscher werden, egal ob Präsident oder König, und sie wird am Ende des Stücks noch einmal von beiden Sängern/Rappern hör- und spürbar gemacht. Über eine minutenlange Refrain-Endlosschleife ruft Bambaataa immer wieder dröhnend: "Destruction!", während Lydon wie ein quengelndes Kind immer wieder seine eigene Verlorenheit hinausbrüllt: "I'm in a time zone, I'm in a time zone!" Wie die von ihnen verteufelte Welt befinden sich auch die beiden personae Lydon und Bambaataa scheinbar in einer (End-)Zeitzone, auf dem Weg in den Untergang -- daß ihre im finalen Couplet beschworene Suche nach einem 'besseren Leben' erfolgreich sein wird, ja daß sie sich überhaupt auf eine solche Suche begeben werden, erscheint angesichts der lustvoll-kindlichen Zerstörungsbeschwörung ("kaboom, kaboom, kaboom!") mehr als fraglich. |
||||
Der Nihilismus, aber auch die latente Hysterie, die sich in World Destruction Bahn brechen, können allerdings durchaus als Symptome der Zeit, in der das Stück entstand, gedeutet werden -- einen Hinweis auf die zugrundeliegende 'Krankheit' liefert ein Remix auf der Rückseite der Platte (World Destruction war eine Veröffentlichung im sogenannten Maxi-Single-Format). Mit Ausnahme des einleitenden Satzes "Speak about destruction" sind die gerappten Texte auf dieser 'dub-Version' vollständig weggemischt und durch kurze gesamplete Fragmente aus Fernseh- oder Radioansprachen ersetzt worden: Hier, in den US-amerikanischen Medien, scheint diese Gegenüberstellung zu sagen, wird ebenfalls von der Zerstörung gesprochen. Das wichtigste der immer wieder in ihre Einzelteile zerschnittenen, gescratchten und mit dem Geräusch detonierender Bomben sowie dem Geheul von Luftschutzsirenen unterlegten Zitate lautet: "Mr. Reagan has a thing about arms control" -- und dieser kurze Kommentar evoziert weitaus apokalyptischere Szenarien als der 'Haupttext' auf der anderen Seite der Platte. |
||||
Der historische Hintergrund, der sich hier entrollt, ist die 'Zeitzone' des Kalten Kriegs an einem seiner Nullpunkte. Der 1981 zum 40. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählte Ronald Reagan hatte sich schon während des Wahlkampfs offen gegen das unratifizierte SALT II-Abkommen ausgesprochen. Erst zehn Monate nach seinem Amtsantritt hatte er das Gespräch mit der sowjetischen Führung über eine mögliche Beschränkung nuklearer Waffen gesucht, und diese Verhandlungen waren wiederholt gescheitert: zunächst an den Forderungen der USA, später, 1983, aufgrund der Stationierung amerikanischer Pershing II-Mittelstreckenraketen in Westeuropa. In diesem Jahr drohte zudem die von Reagan favorisierte Strategic Defense Initiative (SDI) die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vorherrschende Doktrin des nuklearen Patts zu unterminieren. Und diese Politik scheint zumindest teilweise apokalyptisch inspiriert gewesen zu sein. |
||||
Reagan unterhielt enge Beziehungen zu evangelikalen Predigern wie Billy Graham und Jimmy Swaggart, ließ sich von diesen theologisch beraten und teilte offenbar viele ihrer Auffassungen über die baldige Wiederkehr Christi auf Erden. Bereits Anfang der 1970er Jahre -- damals noch als Gouverneur von Kalifornien -- identifizierte Reagan die Sowjetunion mit den bösen Mächten von Gog und Magog aus der Johannes-Apokalypse und mutmaßte, daß sie laut göttlichem Ratschluß mit Nuklearwaffen vernichtet werden müsse: "Ezekial [sic] says that fire and brimstone will be rained upon the enemies of God's people", wie Lawrence Jones ihn zitiert: "That must mean that they'll be destroyed by nuclear weapons." World Destruction reflektiert und überformt also, wie hysterisch es aus heutiger Sicht zunächst auch anmuten mag, eine zu Beginn der 1980er Jahre durchaus verbreitete Furcht vor (und simultane Sehnsucht nach) einer nuklear implementierten Apokalypse, die auch vor dem amerikanischen Präsidenten nicht halt machte. |
||||
Doch auch apokalyptische Ängste unterliegen Konjunkturschwankungen. War es bis in die 1980er Jahre vor allem die Gefahr eines Atomkriegs gewesen, welche die endzeitliche Imagination vieler US-Amerikaner angestachelt hatte, so nahmen nun -- analog zum Zusammenbruch des Ostblocks -- zunehmend ökologische Katastrophenszenarien ihren Platz ein. Einem solchen Szenario widmet sich Public Enemys Fear of a Black Planet von ihrem gleichnamigen Album aus dem Jahr 1990. |
||||
Public Enemy: Fear of a Black Planet | ||||
Die Anfang der 1980er Jahre auf Long Island gegründete Gruppe Public Enemy gilt als eine der bedeutendsten Formationen im HipHop überhaupt. Das Cover von Fear of a Black Planet, der dritten und wohl wichtigsten Platte der Gruppe, gestaltet das Ende der Welt als eine Art Science Fiction-Szenario aus. Eingekeilt zwischen dem Namen der Gruppe und dem Albumtitel, der sich ähnlich den credits in den Star Wars-Filmen von unten ins Bild zu schieben scheint, blicken wir vom Weltraum aus auf die Erde. Daneben sehen wir einen schwarzen Planeten, welcher sich der Erde nähert und diese zu rammen droht. Auf ihm prangt leuchtend -- wie kochende Magma, die gleich unter der Erdkruste hervorbricht -- das Logo der Gruppe. Eine Fußzeile am unteren Rand des Covers schließlich verkündet, wie von einem Nachrichtenticker ausgespuckt, den Alarm, den die dargestellte Szene vorgeblich auslöst: "THE COUNTER ATTACK ON WORLD SUPREMACY". |
||||
Legt das Covermotiv nahe, daß es sich bei der angedrohten apokalyptischen Attacke tatsächlich um den Angriff eines alternativen schwarzen Sterns auf den 'Blauen Planeten' handeln könnte, so geht es im Titelstück um die Angst vor einer sehr viel subtileren Form der 'Übernahme' -- nämlich um die Furcht vor 'Miszegenation' und einer daraus resultierenden 'Verdunkelung' des weltweiten Genpools. Hintergrund für die Argumentation ist ein ökologisches Katastrophenszenario: die in den 1980er Jahren zunehmende Angst vor der Zerstörung der die Erde vor UV-Strahlen schützenden Ozonschicht durch Fluorkohlenwasserstoff, und die mit dieser Angst einhergehende Furcht vor Hautkrebs. |
||||
Auch wenn das Stück Fear of a Black Planet beim ersten Hören wegen seiner polyrhythmischen Textur, aufgrund der Übereinanderschichtung von Samples und gescratchten Textframenten und wegen der Vielzahl seiner musikalischen Teile wie kaum gezähmtes Chaos anmutet, so ist es doch extrem schematisch aufgebaut und folgt einer klaren Dramaturgie. Es besteht aus vier Strophen sowie zwei verschiedenen Refrains, welche alternierend im Anschluß an die Strophen folgen. In der ersten Strophe adressiert der Rapper Chuck D -- unterstützt durch gelegentliche Einwürfe von seinem Respondenten Flavor Flav -- den Vater einer möglichen weißen Geliebten: |
||||
Man, don't you worry 'bout a thing |
||||
Sie sei ja gar nicht sein Typ, beruhigt Chuck D den Vater. Wenn dessen Tochter allerdings in ihn verliebt wäre und mit ihm Kinder bekommen wollte, dann, so mutmaßt der Rapper, würde der Vater wohl Angst vor genetischer 'Verunreinigung' seiner Enkelgeneration bekommen -- und wüßte sich damit in Übereinstimmung mit der im Land vorherrschenden Meinung. Denn auch wenn ein de jure-Verbot inter-ethnischer Eheschließungen in den USA seit einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1967 nicht mehr existiert, so lebt doch sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung wie auch in der Rechtsprechung die während der Sklaverei durchgesetzte sogenannte 'one-drop rule' fort: Dieser Regel zufolge gilt ein/e US-Amerikaner/in dann als African-American, wenn er oder sie auch nur einen 'Tropfen schwarzen Bluts' in sich trägt. Auf diese das 'Schwarze' essentialisierende Rassendefinition spielt der erste Refrain an, der von einer an einen überdrehten Wissenschaftler gemahnenden Stimme vorgetragen wird: |
||||
Black man, black woman: black baby. |
||||
War das ursprüngliche Ziel der one-drop rule die allmähliche Vermehrung der Sklavenpopulation gewesen, so zeigt sich hier die Ironie dieser diskriminierenden Regel: Wenn tatsächlich jeder Nachkomme eines gemischten Paares als black bezeichnet wird, so wird die Erde vermutlich tatsächlich eines Tages ein 'schwarzer Planet' sein. Doch bevor es so weit ist, sind immer noch viele rassistische Vorbehalte, etwa von Seiten eifersüchtig über ihre Schwestern wachender Brüder, aus dem Weg zu räumen. |
||||
Man, you need to calm down, don't get mad, |
||||
Durch die nonchalante Art, mit welcher er dem Bruder klarmacht, daß er dessen Schwester gar nicht 'brauche', daß es ihm nur um einen rein theoretischen Punkt, um eine Gedankenspielerei geht, etabliert sich der Sprecher als selbstbewußter afro-amerikanischer Mann. Er distanziert sich damit vom rassistischen Klischee eines unterwürfigen 'Uncle Tom', der -- in den polemischen Worten von Malcolm X -- "is always begging you [weiße Amerikaner, F.W.] for what you have or begging you for a chance to [...] marry one of your women". |
||||
Hatte der Sprecher in der zweiten Strophe von Fear of a Black Planet bereits Zweifel angemeldet, daß die 'europide Rasse' die Norm darstelle, so wird nun im zweiten Refrain die u.a. von der afro-amerikanischen Nation of Islam vertretene Lehre, der zufolge eine dunkle Hautpigmentierung die anthropologische Grundfarbe darstelle, aufgegriffen; und zwar von einem Ensemble blechern-verzerrter Stimmen, einem geisterhaften Chor, der klingt, als bestünde er aus ungeborenen Kindern, die aus einer multi-ethnischen Zukunft allen Skeptikern die unbequeme Wahrheit verkünden: |
||||
Excuse us for the news, |
||||
Das zugrundeliegende Szenario, das hier angedeutet wird, ist einerseits das eines newscasts, einer Nachrichtensendung -- nicht von ungefähr hat Chuck D seine Gruppe immer wieder als "CNN of black culture" bezeichnet. Andererseits gemahnt der Refrain auch an einen Gerichtstermin, bei dem rassistische Weiße auf der Anklagebank sitzen: "I question those accused". Und in der folgenden Strophe geht der Sprecher sogar noch einen Schritt weiter: Wenn er einem weißen Mann die Frau ausspannen würde, so der Sprecher, dann könne dieser noch froh sein: Denn eine braune Hautfarbe werde die Generation seiner Kinder möglicherweise vor dem Hautkrebs retten. Hier hält der apokalyptische Ton Einzug in die Argumentation: Die dominante Hierarchisierung zwischen Weiß und Schwarz wird angesichts der Zerstörung der Ozonschicht umgedreht, und "to be black" wird für die Euro-Amerikaner zum unerreichbaren Ideal -- "brown" ist demgegenüber eine minderwertige Qualität, aber dennoch das beste, was den Nachkommen einer weißen Frau passieren kann. Das Wort "brown" steht jedoch sowohl syntaktisch als auch phonetisch gefährlich nah an dem Wort "Countdown", welches die für das Jahr 2001 prophezeite Apokalypse einläutet. |
||||
Es mag merkwürdig erscheinen, daß einer sich graduell vollziehenden Katastrophe wie der Zerstörung der Ozonschicht ein Countdown vorangehen sollte, und daß für dessen Vollendung ein genaues Datum genannt wird. Doch wie Perry Miller formuliert: "Catastrophe, by and for itself, is not enough". Um nicht nur als kontingentes Naturphänomen, sondern als Teil eines göttlichen Plans gelten zu dürfen, muß die apokalyptische Katastrophe einem vorherbestimmten Schema folgen, einem Ablauf, an dessen Ende Gottes erwähltes Volk triumphiert. Was Public Enemys endzeitliche Mahnrede jedoch von vielen anderen unterscheidet, ist der vergleichsweise konziliante Ton, mit dem die in den drei ersten Strophen vorgetragenen 'Predigt-Histörchen' in der vierten Strophe subsumiert werden: |
||||
Nicht kataklysmische Zerstörung, sondern "peace and love on this planet" seien das eigentliche Ziel des göttlichen Plans, verkündet der Sprecher -- Voraussetzung für ein solches friedliches Miteinander ist allerdings, daß rassistische Weiße ihre Vorstellungen von Segregation und Überlegenheit aufgeben und Afro-Amerikaner nicht länger aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Frisuren als Gangster verdächtigen. |
||||
An die Seite des Eros, um den es in den ersten drei Strophen geht, gesellt sich hier nun also dessen Schwester-Emotion: die christliche Kardinaltugend der Agape, der altruistischen Liebe. Mit seinem Angebot, den dem Verderben geweihten 'weißen' Teil der Menschheit zu erlösen, stellt sich die Rapper-persona in Fear of a Black Planet in die Tradition der sogenannten "Black Messiahs" (Wilson Jeremiah Moses), wie es sie in der anglo-amerikanischen Literatur immer wieder gegeben hat. Wie Moses gezeigt hat, versöhnt der Mythos des 'schwarzen Messias' das Gefühl der radikalen Andersheit und Abgesondertheit, das Afro-Amerikaner in Nordamerika seit ihrer Ankunft als Sklaven empfunden haben müssen, mit ihrem grundlegenden Glauben, daß auch sie Amerikaner seien, und daß sie darüber hinaus eine entscheidende Stellung innerhalb der amerikanischen Gesellschaft innehaben. Es ist gerade ihr Status als 'anderes Volk', der es ihnen ermöglicht, ihren Beitrag zur Erfüllung des gesamt-amerikanischen Heilsplans zu leisten. So ist der Sprecher in Fear of a Black Planet willens, seine "genes and chromosomes" zu geben, um das amerikanische Volk vor der Apokalypse durch ultraviolette Strahlen zu retten. In diesem Sinne könnte man ihn durchaus als modernen Messias verstehen, und seine Aufforderung zur inter-ethnischen Partnerschaft als angewandte Form der Eucharistie: Das ist mein Blut, das ist mein Leib. Nehmt, denn es ist alles, was ich habe. |
||||
Doch bei weitem nicht alle Rapper verstehen sich als mögliche Retter des amerikanischen Volkes. Besonders im Gefolge des Waffengewalt, Drogenkonsum und Frauenverschleiß verherrlichenden sogenannten gangsta rap, der seit Beginn der 1990er Jahre den message rap von Gruppen wie Public Enemy zunehmend an den äußeren Rand der popkulturellen Wahrnehmung gedrängt hat, avancierten Anti-Helden wie der Zuhälter, der Killer oder der Mafia-Pate zu dominanten Heroen der HipHop-Kultur. Im Bereich des eschatologisch inspirierten HipHops führte dies analog zu einer Aufwertung von Helden, welche eher Abgesandte des Antichristen denn neue Messias-Figuren zu sein schienen. Ein besonders eindrückliches Beispiel hierfür bietet der Rapper Busta Rhymes. |
||||
Busta Rhymes: Everybody Rise | ||||
Bereits das erste Solo-Album des Rappers Busta Rhymes aus dem Jahr 1996 wies auf die intensive Beschäftigung des Rappers mit der Apokalypse hin: Es trug den ominösen Titel The Coming (eine Anspielung auf die Wiederkehr Christi), verkündete gleich zu Anfang, daß bis zu diesem Ereignis nur noch wenig Zeit verbleibe und endete mit dem programmatisch betitelten Stück The End of the World. Das Thema sollte den Rapper immer wieder beschäftigen; ihren stärksten Ausdruck fand diese latente pre-millennial tension jedoch auf Busta Rhymes' letztem Album vor der Jahrtausendwende: auf der Platte Extinction Level Event: The Final World Front von 1998, welche das Aussterben der Menschheit bereits im Titel führt. |
||||
Schon das Album-Cover bereitet den/die Hörer/in auf den dominanten Topos der Platte vor. Aus der Vogelperspektive blicken wir auf die Downtown von Manhattan beziehungsweise auf das, was von ihr übrig geblieben ist. Die gesamte Szene ist in feurigen Rottönen gehalten, denn die Metropole wird gerade von einem riesigen Feuerball verschlungen. Das erste gerappte Stück auf Extinction Level Event, Everybody Rise, weitet die hier angedeutete Katastrophe auf den gesamten nordamerikanischen Kontinent aus: Der Text beginnt mit einer Auflistung all jener Orte, wo die Apokalypse Busta Rhymes zufolge stattfinden wird: New York, Jersey, Philadelphia, Baltimore, Washington D.C., Virginia, Atlanta. Nachdem er durch die Benennung urbaner Zentren und einzelner Bundesstaaten den nordamerikanischen Kontinent als Schauplatz der apokalyptischen Ereignisse abgesteckt hat, stellt sich der Sprecher zunächst als Angehöriger seiner 'posse', der sogenannten "Flipmode Squad", vor und versammelt seine 'Jünger' um sich -- "my niggers", wie er sie paternalistisch-besitzergreifend bezeichnet. |
||||
Der Sprecher bedient sich hier wie im gesamten Text nicht nur zahlreicher 'Kraftwörter', sondern auch vieler Begriffe, die ihn als Angehörigen der sogenannten Nation of Gods and Earths ausweisen, einer Splittergruppe der Nation of Islam, die sich u.a. durch eine extrem endzeitliche Mythologie auszeichnet. Der Ausdruck "live motherfucker" beziehungsweise "live nigger" steht für ein Mitglied der Nation, "god" dient als Anrede für einen Glaubensbruder, das Wort "seed" für den Nachwuchs und "physical" für den Körper als Sitz und Inbegriff des göttlichen Potentials, das gemäß der Zahlenmystik der Gruppe jedem Manne innewohnt: Arm, Leg, Leg, Arm, Head = ALLAH. Als mit göttlichen Fähigkeiten begabtes Wesen hat der Rapper natürlich einen "plan", ein Rezept, wie der drohenden Apokalypse zu entkommen sei. Nur die umgehende Anhäufung von Kapital, so seine zentrale Botschaft, könne am Jüngsten Tag die Erlösung bringen: |
||||
Just get money an' capitalize an' hold on to your stack, |
||||
Busta Rhymes rappt seine Botschaft mit jener atemberaubenden Geschwindigkeit, die sein Markenzeichen ist, und betont so auf der Ebene des discours, was er auf der Ebene der histoire verkündet: "do your thing and get yours quick" -- gilt es doch, die rettenden Dollar-"papers" noch vor dem Jahr 2000 anzuhäufen: "gotta get it before the year 2G". Daß die Zahl dieses Schwellenjahres hier nicht mit dem sonst üblichen Kürzel '2K' (wie 2 kilo), sondern mit "2G" abgekürzt ist, ist symptomatisch: Der Buchstabe G steht im HipHop-Slang unter anderem für das Wort grand und bezeichnet eine 1000-Dollarnote. Das (wohl um des Reimes willen) grammatikalisch modifizierte Darwinsche survival of the fittest wird daher auch konsequenterweise zu einem Überleben der Reichsten und Skrupellosesten umgedeutet: Nur die Liquiden -- jene "fluid niggers", die stets nach vorne schauen und sich nicht darum sorgen, was sie sind, sondern darum, was sie haben -- werden in der Lage sein, die Millenniums-Barriere zu durchbrechen und so in das irdische Paradies zu gelangen. |
||||
Dabei schreckt Busta Rhymes nach eigenem Bekunden auch vor Gewaltanwendung nicht zurück; selbst Regierungsvertreter müssen auf der Hut sein, wenn sie bei ihm Geld einstreichen wollen: Im Angesicht der Apokalypse, unter dem Auge der auf den letzten Stundenschlag zurasenden Uhr tritt eine Art moralischer und juridischer Ausnahmezustand ein, eine karnevaleske Zwischenzeit, in der die auf langfristiges Miteinander hin ausgerichteten Regeln nicht mehr gelten und jeder sich selbst der nächste ist -- und mit einemmal scheint alles erlaubt zu sein: "Get what's yours from out this fucker 'fore your time ran out". |
||||
Die Liaison, die Apokalyptizismus und Materialismus hier eingehen, mag auf den ersten Blick befremdlich erscheinen -- doch läßt sich eine solche Verbindung bis zur Johannes-Apokalypse zurückverfolgen. Auch dem letzten Buch der Bibel ist die Verherrlichung von Reichtum und Luxusgütern nicht fremd -- höchstens deren ungerechte Verteilung. Zudem befindet sich Busta Rhymes mit seiner raubtierkapitalistischen Gangsta-Jeremiade aber auch in der Gesellschaft fast der gesamten zeitgenössischen US-Gesellschaft. Wie Michael Eric Dyson schreibt: "Rap's voracious materialism [...] feeds on an undisciplined acquisition, accumulation, and consumption of material goods that has pervaded most segments of American society." Everybody Rise ist somit auch ein Zerrspiegel US-amerikanischer Realitäten, ein Brennglas, das ins Fäkalsprachlich-Unverhohlene vergrößert, was sonst nur im Stillen betrieben oder ersehnt wird. Was Busta Rhymes vom Mainstream unterscheidet, ist lediglich die Lautstärke und Chuzpe, mit der er seine lasterhaften Lehren verkündet und, sozusagen in effigie, für den Rest der Gesellschaft auf der Bühne und auf Vinyl auslebt. |
||||
Auf das Ausbleiben der von ihm so beharrlich prophezeiten Parousie im Jahr 2000 sollte Busta Rhymes recht souverän reagieren. Auf die Platte Anarchy aus dem Umbruchsjahr 2000 folgte 2001 ein Album, das mit seinem Titel nicht Zerstörung oder Chaos, sondern Schöpfung, Neubeginn signalisierte: Genesis. Genesis, das bedeutet zum einen ganz neutral 'Anfang, Ursprung' -- es ist natürlich aber auch der Name des ersten Buches der Bibel. Dies mag nach Busta Rhymes' jahrelanger Obsession mit dem letzten Buch der Bibel überraschend sein, ist jedoch, nach dem Ausbleiben der Apokalypse, von fast zwingender Konsequenz. Denn wenn das Buch der Offenbarung zu Ende gelesen und zugeschlagen ist, dann kann man nur wieder von vorn beginnen. |
||||
Hier zeigt sich einer der vielleicht überraschendsten Aspekte des apokalyptischen Diskurses besonders deutlich: nämlich, daß es beim Sprechen vom Weltende immer auch um einen neuen Anfang geht -- um die Skizzierung einer alternativen Welt. In gewisser Weise herrschen in den im Rap entworfenen Paralleluniversen -- sei es nun der 'Schwarze Planet' von Public Enemy oder das Himmelreich des Materialismus von Busta Rhymes -- nämlich die Gesetze des Karnevals, jenes (in den Worten von Michail Bachtin) 'komische[n] Drama[s] vom Absterben der alten und der Geburt der neuen Welt'. Indem Rapper wie Chuck D und Flavor Flav die Ankunft eines Millenniums der Hybridität verkünden, in welchem sich weiße Amerikaner noch danach sehnen werden, ihre Gattinnen von Afro-Amerikanern ausgespannt zu bekommen, feiern sie die fröhliche Relativität der Werte: die Möglichkeit, daß alles auch ganz anders sein könnte -- umgekehrt, aber nicht falsch. Wenn sie diese karnevaleske Umkehrung der Welt zudem in der zeitgenössischen "Sprache des Marktplatzes", also mit den im Rap üblichen Fäkal- und Genitalwörtern beschwören, so beerdigen sie nur lachend alte Konzepte. Denn "[w]enn die alte sterbende Welt mit Kot beworfen, mit Urin übergossen und mit einem Hagel von skatologischen Flüchen überschüttet wird", dann ist dies laut Bachtin nicht etwa ein Zeichen ihres Niedergangs, ihres Verfalls, gewissermaßen der Anfang vom Ende; nein es ist vielmehr "ihre fröhliche Beerdigung, die auf der Lachebene dem Aufschütten des Grabs mit Erde entspricht oder der Aussaat in die Ackerfurche (in den Schoß der Erde)". Wer weiß: Wenn die alte Erde also immer wieder verflucht, totgeredet und mit frischen millennialistischen HipHop-Texten gedüngt wird, dann mag aus ihren brachliegenden Furchen tatsächlich eines Tages eine neue sprießen. |
||||
|
autoreninfo
Florian Werner studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik und promovierte mit einer Arbeit über Rap und Apokalypse; Rapocalypse ist im Frühjahr 2007 bei transcript erschienen. 2005 veröffentlichte er den Erzählband Wir sprechen uns noch (dtv), 2009 das Sachbuch Die Kuh: Leben, Werk und Wirkung (Nagel & Kimche). Florian Werner ist Texter und Musiker in der Gruppe Fön, deren erster gemeinsamer Roman K.L. McCoy: Mein Leben als Fön, gleichzeitig mit der CD Wir haben Zeit, 2004 bei Piper erschienen ist; im Herbst 2007 folgte die zweite Fön-CD Ein bisschen plötzlich. Florian Werner lebt als Autor, Journalist und Übersetzer in Berlin.
E-Mail: werner_florian@gmx.de |
||||
|
|