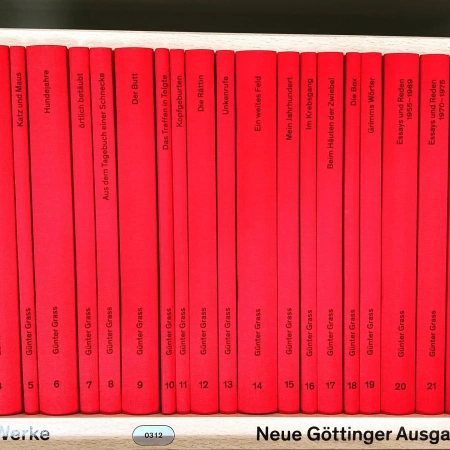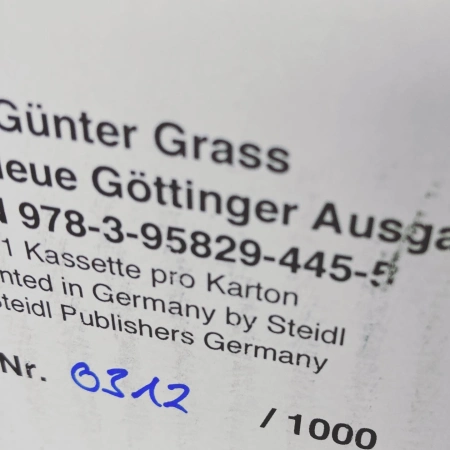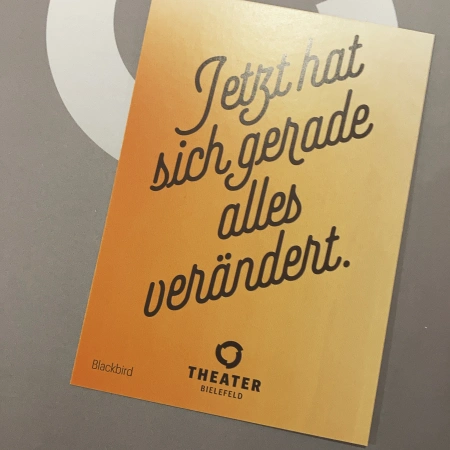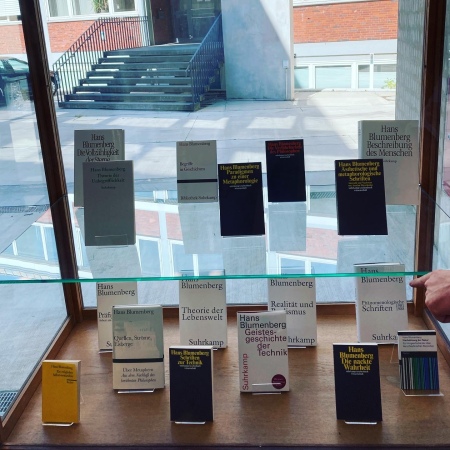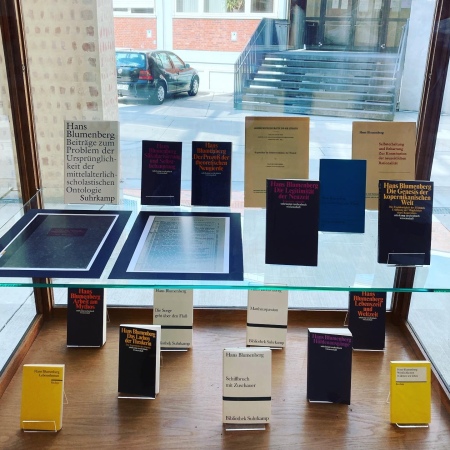Anfang Juli letzten Jahres hatte ich das Glück, die Tagung der Lichtenberg-Gesellschaft in Osnabrück eröffnen zu dürfen. Als ich zur Vorbereitung meine Lichtenberg-Ausgabe wieder in die Hand nahm – die Zweitausendeins-Ausgabe von Wolfgang Promies –, erinnerte ich mich an mein Studium in Göttingen.
Im Sommer 1994 war das. Damals habe ich am Deutschen Seminar in Göttingen meine Zwischenprüfung absolviert und mir anschließend die Lichtenberg-Ausgabe angeschafft. Unter dem Dach einer kleinen Wohnung weit draußen in Weende begann ich zu lesen. Dabei hat mir Promies‘ Ausgabe die Augen für die Bedeutung von wissenschaftlichen Ausgaben geöffnet. Ich hatte mich in den Wochen davor mit ganz unterschiedlichen Interpretationen von Döblins Berlin Alexanderplatz für die Zwischenprüfung beschäftigt. Aber erst ohne jeden konkreten Sinn und Zweck angeschaffte Lichtenberg-Ausgabe sensibilisierte mich für das Kerngeschäft der Philologie. In dieser Zeit, Mitte der 1990er Jahre, hatten Poststrukturalismus und Kulturwissenschaft Konjunktur. In Göttingen aber stand weiterhin das philologische Kerngeschäft in Blüte. 1994 publizierte Albrecht Schöne die erste Auflage seiner Faust-Ausgabe. Kurz nachdem ich mir die Lichtenberg-Ausgabe gekauft hatte, stellte mich Wilfried Barner als Hilfskraft für seine Lessing-Ausgabe im Deutschen Klassiker-Verlag ein. An all diese Momente erinnerte ich mich, als ich ein Vierteljahrhundert später meine Lichtenberg-Ausgabe zur Vorbereitung der Begrüßung wieder einmal in die Hand nahm.
Doch selbstverständlich nahm ich die Ausgabe nicht nur aus dem Regal, um in Erinnerungen zu schweifen. Vor allem sollte sie mir einen historischen Blick zurück auf Lichtenbergs Aufenthalt in Osnabrück vom Spätsommer 1772 bis zum Februar 1773 ermöglichen. Zwei Punkt interessierten mich besonders.
1. Die Lichtenberg-Tagung in Osnabrück hatte als Motto eine Notiz aus Heft B:
„Er war so witzig, daß jedes Ding ihm gut genug war zu einem Mittelbegriff jedes paar andere Dinge mit einander zu vergleichen.“
Promies bezieht im Kommentar diese Sentenz auf Lichtenberg selbst, auf den ‚Ähnlichkeitssucher‘. Mich veranlasste das gerade nicht über Ähnlichkeiten, sondern über Differenzen nachzudenken – und zwar denen zwischen Lichtenberg und Justus Möser. Der war 22 Jahre älter, was vielleicht erklärt, warum sich Lichtenberg über ihn meinem Eindruck nach zwar ausgesprochen höflich und anerkennend, gleichwohl aber meist distanziert äußert. So schreibt Lichtenberg an Hollenberg im Juli 1781:
„Mösers Aufsatz habe ich mit vielem Vergnügen gelesen, manches, was mir nicht darin gefällt, würde mir gewiß gefallen, wenn ich Mösers Einsichten hätte.“
Lichtenberg betont den Unterschied zwischen den beiden. Die heute in der Forschung immer mehr betonte Komplexität und Differenziertheit der deutschen Aufklärung war also auch den Aufklärern selbst bereits bewusst.
2. Lichtenberg beschreibt seine Aufgabe in Osnabrück in einem Brief vom Januar 1773 folgendermaßen:
„Ich habe mich vergangenes Jahr teils in Hannover und teils hier auf des Königs Befehl aufgehalten, um die Lage der beiden Städte zu bestimmen.“
Lichtenbergs Aufenthalt in Osnabrück ist also ein konkreter Vorläufer von dem, was Daniel Kehlmann mit Blick auf einen anderen großen Göttinger – Carl Friedrich Gauß – und den 2019 besonders geehrten, noch größeren Preußen, Alexander von Humboldt, die „Vermessung der Welt“ genannt hat. Interessant scheint mir, dass diese Vorgeschichte der Globalisierung, die bei Lichtenbergs Aufenthalt in Osnabrück in nuce beobachtet werden kann, zu einem Zeitpunkt erfolgte, da das Fürstbistum Osnabrück reichsrechtlich noch gar nicht Teil vom Kurfürstentum Hannovers war. Lichtenberg und Osnabrück – das führte mir die für die Aufklärung so typische Ungleichzeitigkeit vor: Erkenntnisse und vor allem Erkenntnisinteressen, die mit der politischen Realität nur begrenzt in Einklang gebracht werden können.
Es gehört freilich auch zur wissenschaftlichen Redlichkeit, sich einzugestehen, dass Lichtenbergs Verhältnis zu Osnabrück selbst deutlich weniger akademisch war. Noch im September erklärte er Kaltenhofer:
„Nun bin ich schon 13 Tage in Osnabrück, wollte Gott, daß ich so viele Wochen dagewesen wäre.“
Und an Johann Christian Dietrich schrieb er im Februar von Hannover aus:
„Ich habe mich endlich aus Osnabrück weggeschlichen, wie Jener sich aus der Schenke morgens um 3 Uhr. Ich habe allerlei westfälische Pretiosa für Dich bei mir, als Pumpernickel, Schinken etc.“
Im Heft C notierte sich Lichtenberg ein sprachliches Detail, das er in Osnabrück aufgeschnappt hatte und das vielleicht deutlich macht, warum es bis heute eine Freude ist, ihn zu lesen:
„Herr Westenhof in Osnabrück erzählte mir, daß ihn einmal ein Bauer gefragt hätte: Ich hebbe hört Ihr sollt elendigen schön sprecken. Elendig schön ist eine sehr gemeine Redensart und sagt so viel als sehr schön.“
Lichtenberg ist einfach ein elendig schöner Autor.
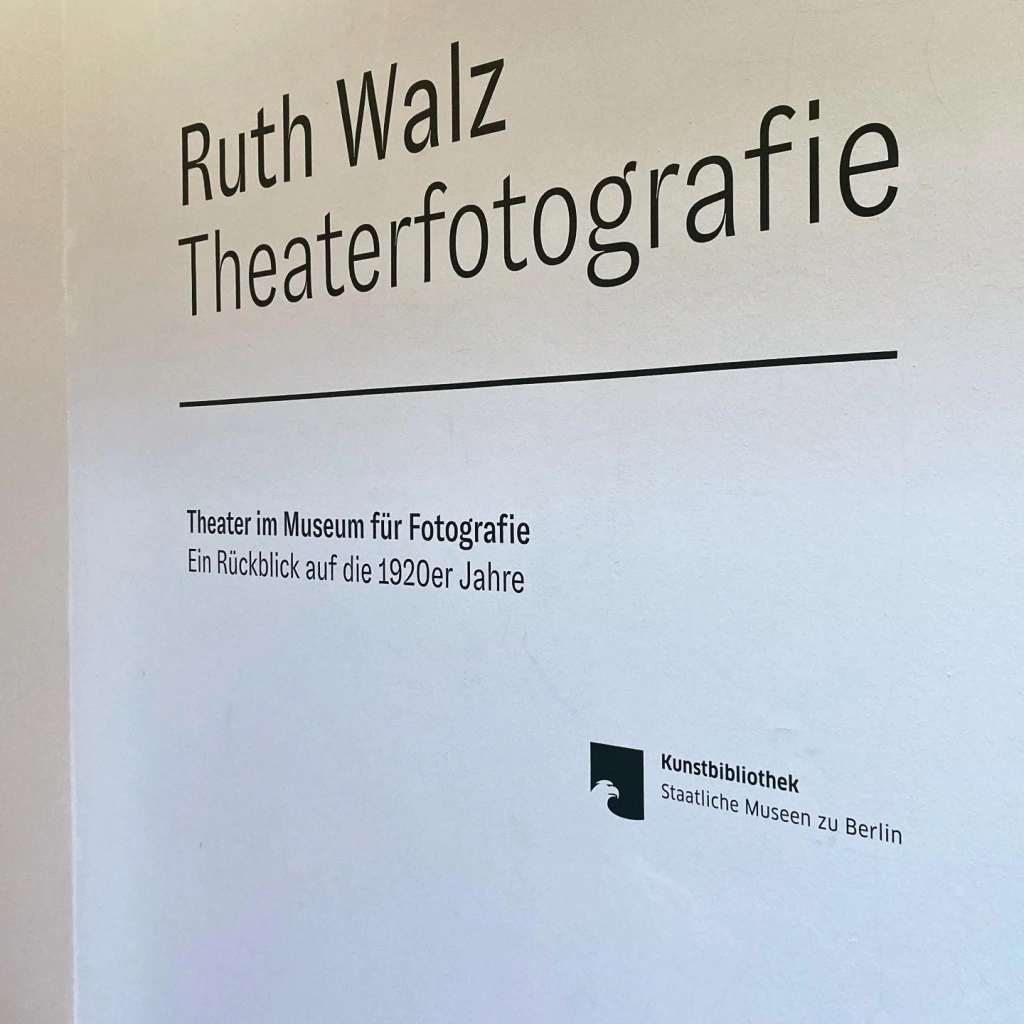











 Veröffentlicht von kai bremer
Veröffentlicht von kai bremer