Futter für die Bestie.
528 Wege… zum nächsten guten Buch.
von Stefan Mesch
erschienen in BELLA triste 31, November 2011, Hildesheim
.
.
„Was, wenn ich jede Geschichte, die mich je bewegte… jeden Song, zu dem ich jemals tanzte… all meine wichtigsten Stunden… greifen könnte – und mit euch teilen?“, fragte Oprah Winfrey, bevor sie Anfang 2011, nach 25 Jahren, ihre Talkshow einstellte und ein riskantes, eigenes Vollprogramm entwarf, den Kabelsender OWN: „Oprah’s Next Chapter“, „Ask Oprah’s All-Stars“, „Your OWN Show: Oprah’s Search for the Next TV Star“… ein Kessel Lebenshilfe, Reality- und Service-TV, Talkshows, Reportagen, Einrichtung, Kochen und Politik, montags bis sonntags, rund um die Uhr.
Von fern, in sporadischen Interview- und Youtube-Schnipseln, schien mir die Journalistin / Moderatorin oft vage sympathisch: eine laute, pummelige, selbstsichere Frau, die beständig auf Herz und Bauch, nicht auf den Kopf zielte und jede Frage so persönlich, nah, konkret und emotionalisiert wie möglich in Angriff nahm. Empfehlungen! Lob! Emphase! Gefühl! Entdeckungen! Geschenke!
In einer Alltags- und Boulevardkultur, die uns (als Europäer) oft kaum taxiert, kreist Winfrey seit 1986 als neugieriger, lebenshungriger Mähdrescher durch alle Themenfelder: Sie sucht nach Hoffnung, im finstersten Tal. Feiert Opfer, die ihre Stimme erheben und kämpfen. Und sie will Täter, die umkehren und bereuen. Die Lebensgeschichte ihrer Gäste wird als Bildungsroman, Survival Story, Erbauungs- oder Bekehrungs-Lehrstück aufgerollt. Im Wertekatalog der Sendung zählen Fleiß und Lernen, Freundschaft, Mut, Solidarität und Stolz.
Das ist – als Programmatik, Haltung, Tonfall – fürs erste nicht verdächtig oder verkehrt. “Tränen, Drama, fertig ist das Rührstück”, lacht Spiegel Online. “Oprah Winfrey ist die Großmeisterin des Geschluchzes, Herzschmerz ist ihr Geschäft.” Doch Winfrey selbst erklärte in ihrer Abschiedssendung Ende Mai: “Ich wollte immer eine Lehrerin sein, und das hier ist das größte Klassenzimmer der Welt.”
Ich kenne schlechtere Lehrerinnen. Und dümmere Lektionen.
.
.
“Ich dachte, diese Bücher seien für Frauen. Ich hätte sie nie angefasst.”
“Ich werde versuchen, ein neues Format für Bücher und Autoren zu entwickeln“, versprach Winfrey zum Sendestart von OWN – auch, wenn Literatur die Einschaltquoten sinken lässt. “Das ist nicht wichtig: Manche Themen sind einfach nötig. Und je besser ich es schaffe, eine Brücke zu schlagen zwischen Autor, Buch und Publikum, desto schneller erholen sich auch die Quoten.“
Literatur auf Körpertemperatur also, Geschichten “zum Mitgehen”, Erzähler “wie du und ich”: In der Rubrik „Oprah’s Book Club“ empfahl Winfrey seit Herbst 1996 siebzig meist aktuelle Romane, Sachbücher und Biografien, sprach mit dem Autor oder ließ Studiogäste (Experten, Bibliothekare, Hobbyleser) diskutieren. Jeder Titel wurde zum Bestseller, und alle erhielten ein Oprah-”O” als Sticker oder Aufdruck.
“Der Bärenanteil aller in unserem Land gelesenen Bücher wird von Frauen bewältigt. Sie lesen, so lange Männer auf den Golfplatz fahren oder Football kucken oder mit ihren Flugsimulatoren spielen – oder was weiß ich. Ich habe Angst … nein, besser: Ich hatte Hoffnung, mit meinem Roman auch ein männliches Publikum zu erreichen”, klagte Jonathan Franzen 2001, nach Erscheinen seiner Familiengeschichte “Die Korrekturen”.
“Doch mehr als ein Leser steht heute im Buchladen in der Schlange für meine Signierstunde und sagt: ‚Wenn ich nicht gerade Ihre Lesung gehört hätte, hätte mich die Empfehlung von Oprah abgeschreckt. Ich dachte, diese Bücher seien für Frauen. Ich hätte sie nie angefasst.’”
Die “Oprah”-Redaktion lud Franzen aus der Sendung aus, und US-Kulturjournalisten eröffneten eine wichtige Debatte: War Franzen elitär und frauenfeindlich? Lockt Winfreys Empfehlung nur Leser „zweiter Klasse“? “Sie hat ein paar gute Bücher ausgewählt”, schimpfte Franzen noch 2006. “Aber auch so viel Schmalz und flache Geschichten, dass es mich persönlich schaudert.”
Tatsächlich empfahl Winfrey bis 2001 sehr viele Bürgerrechts-, Holocaust- und Krankheitsgeschichten, persönliche Schicksale, oft von Frauen und / oder Schwarzen. Keines dieser Bücher wurde in Deutschland zum Bestseller, und nur “Weißer Oleander”, “Fortunas Tochter”, verschiedene Titel von Toni Morrison und Wally Lambs “Früh am Morgen beginnt die Nacht” sind mir – dem Namen nach – bekannt.
Ganz anders sieht die Liste der (nur) 23 Titel aus, die Winfrey seit Franzens Protest empfahl [Weg 1]: John Steinbecks „Jenseits von Eden“ (1952), Tolstois „Anna Karenina“ (1877), Weihnachten 2010 eine wuchtige Doppelausgabe von Charles Dickens. Auch die tagesaktuellen Romane – Cormac McCarthys „Die Straße“, Jeffrey Eugenides‘ „Middlesex“ und, als große Versöhnung im letzten Herbst, Jonathan Franzens „Freiheit“ – wurden literarischer, dunkler, männlicher.
Bis heute ist Winfreys Urteil „the biggest force in publishing“, und wer gehobenen literarischen Mainstream sucht, findet hervorragende Empfehlungen im monatlichem O Magazine [Weg 2] und auf Oprah.com [Weg 3]: Winfrey (und ihre Redakteure) mögen Bildungsromane, Survival Stories, Erbauungs- und Bekehrungs-Literatur. Vieles ist „gut gemeint“ oder latent didaktisch. Es geht um Hoffnung, im finstersten Tal. Um Hauptfiguren, die ihre Stimme erheben und kämpfen.
Doch ich kenne schlechtere Kriterien. Und Kritiker, die öfter daneben greifen.
.
.
.
“Der Mob zerstört die Ordnung des Systems.“
Bevor ich an die Uni kam, 2003, war ich ein harmloser, entspannter Gelegenheits- und Freizeit-Leser: Ich schaffte ein, zwei Bücher im Monat, meist Impulskäufe in der Karlsruher Fußgängerzone oder, seit 1999, immer öfter bei Amazon. Mit 13 kaufte ich „Shadowrun“– und „Star Trek“-Romane. Mit 14 „Dracula“ und Stephen King. In der Oberstufe – wie alle anderen im Freundeskreis – Paul Auster, Jean-Paul Sartre, Hermann Hesse und Ethan Hawke.
Unser Lieblingsbuch, „Vielleicht lieber morgen“ von Stephen Chbosky, war eine Amazon-Empfehlung [Weg 4], die ich nur bestellt hatte, weil die US-Ausgabe beim Imprint „MTV Books“ erschienen war: Im Vorjahr hatte „MTV Films“ „Save the last Dance“ produziert – das reichte mir als gutes Vorzeichen und Qualitätsversprechen.
Ich kaufte ohne Argwohn und Recherche, nach kurzem Blick aufs Cover, den Klappentext oder den Titel („Ich finde mich toll – warum bin ich noch Single?“), und noch 2001 tippte ich mir eine Liste der 74 Autoren ab, die The Divine Comedy in ihrem Song „The Booklovers“ aufzählten [Weg 5] und bestellte mir naiv erste Bücher von Martin Amis, Kazuo Ishiguro, Anaïs Nin. Ohne den Song hätte ich von diesen Leuten nicht gehört. Und Fachpresse? Qualifizierte Empfehlungen? Netzwerke, Kuratoren?
Zu jedem Videospiel, das ich mir zwischen 10 und 13 kaufte, gab es schon Monate zuvor vier, fünf, sechs Testberichte in Zeitschriften wie MegaFun und Gamers. „Grafik: 90 Prozent. Musik / Soundeffekte: 74 Prozent. Steuerung: 82 Prozent. Spielspaß: 87 Prozent.“ Alle Titel fanden saubere Plätze in Tabellen, Referenzen, Rankings. Es gab Schulnoten und Umfragen, so technisch, „objektiv“ und detailliert wie möglich.
Mit 12 ersetzte ich Hörzu durch TV Movie, weil dort dasselbe (neurotische) Prinzip auf Spielfilme angewandt wurde: Jeweils ein bis drei Punkte für Humor, Action, Spannung, Anspruch und / oder Erotik, dazu Tagestipps, Nachttipps, Geheimtipps, Kino- und Videotipps. Seit 1995 half TeleVision (später: TV Highlights) auch bei der Auswahl aller Science-Fiction- und Fantasy-Filme und -Serien des Monats. Seit 1998 las ich Cinema, bevor ich ins Kino ging. Und 1999 fand ich IMDb.com, die Internet Movie Database.
Wenn über IMDb geschrieben wird (es passiert selten genug…!) und über den kollektiven User-Score, bei dem Hunderte Amateure jeden Film auf einer Skala von 1 bis 10 Sternen bewerten, geht es meist um die Widersprüche und Absurditäten auf der Liste der „250 top-rated movies“: Ist die Stephen-King-Verfilmung „Die Verurteilten“ (9.2 von 10) tatsächlich der „beste Film aller Zeiten“? Gehört „Der Pate“ auf Platz 2? Und was lief schief im Sommer 2008, als der Batman-Film „The Dark Knight“ (heute: 8.8 von 10) plötzlich Platz 1 belegte?
„Der Mob zerstört die Ordnung eines Systems, das für gewöhnlich durchaus präzise, nützlich und vertrauenswürdig ist“, erklärte damals ein Stochastiker. Doch besonders die zweite Hälfte dieses Satzes hat Substanz: Die Wertungen sind, meiner Erfahrung nach, tatsächlich bestürzend „präzise, nützlich und vertrauenswürdig“.
Ein Film ab 8.0 ist (beinahe immer) sehenswert und spannend, ein Film unter 7.0 hat (mindestens) große Schwächen und Probleme. Von meinen 28 Lieblingsfilmen liegen nur fünf unter der 7.0-Marge. Doch andererseits liegt das natürlich (auch) an meiner einseitigen Auswahl:
Beschränke ich mich selbst, wenn ich seit 15 Jahren nur Favoriten und „Tagestipps“ ansehe?
.
.
.
„Keinem deiner Freunde gefällt das.“
Die Frage „Wie finde ich einen guten Film?“ hat eine Unzahl schneller, simpler Antworten: Kritiken auf Metacritic und RottenTomatoes lesen. Trailer auf Youtube sehen. Best-of-Listen von Bloggern und anderen Kuratoren durchsieben [das gilt auch für Bücher: Weg 6]. Zu Preisträgern auf Festivals recherchieren [Weg 7]. Notizen machen, sobald Stars und Regisseure von ihren Lieblingen / Vorbildern sprechen [Weg 8]. Journalisten wie Roger Ebert, Alan Sepinwall oder Else Buschheuer auf Twitter und Facebook folgen [Weg 9].
Oder einfach: Freunde fragen [Weg 10].
Vor acht Wochen erst erklärte Kathrin Passig in ihrem Essay „Keinem deiner Freunde gefällt das“ (pro Helvetia, Passagen 56), altmodische Mund-zu-Mund-Propaganda im Freundeskreis sei überholt: „Man entdeckt [als Schüler] gemeinsam mit Freunden bestimmte Bands, Filme, Autoren, sodass sich die Vorlieben für eine Weile parallel entwickeln. Die Täuschung, dass dieser Zustand das ganze Leben lang anhält, entsteht durch Wunschdenken und dadurch, dass wir uns lieber über die Überschneidungspunkte unserer Interessen unterhalten als über deren Diskrepanzen.“
„Ich schwimme“, schreibt Passig zerknirscht und müde, „in vielen Bereichen mitten im Mainstream. Aber selbst diejenigen Freunde, bei denen die Übereinstimmungen relativ groß sind, hegen ansonsten Interessen, die für mich so wenig nachvollziehbar sind, dass ich mich von der Vorstellung verabschiedet habe, vorhersagen zu können, was ihnen gefallen wird und was nicht.“
Schade: Das sagt die Frau, die vor fünf Jahren perfekt kalkulierte, was den Juroren des Bachmannpreis‘ gefallen wird. In Zukunft aber, glaubt sie, seien unsere „Geschmacksgenossen“ vor allem in sozialen Netzwerken zu finden, Empfehlungen via Computer und Algorithmen. Und damit liegt sie richtig. Falsch. Und weit daneben.
Richtig, weil Online-Radios wie Last.fm – da machte ich seit 2006 dieselben tollen, euphorisierenden Hör-Erfahrungen wie Passig – tatsächlich passgenaue Songs für meinen „privaten Radiosender“ auswählen, mit jedem Klick auf „Love“ oder „Don’t play this song again“ dazulernen und mir, als „virtuelle Nachbarn“, Hörer auf der ganzen Welt vorschlagen, deren Musikstil sich frappant mit meiner eigenen Sammlung deckt.
Wie „nah“ oder „ähnlich“ sich einzelne Musikstücke sind, berechnet Last.fm dabei vor allem aus einer Unmenge globaler User-Daten: Ich selbst habe etwa 55.000 Songs gehört und an die Last.fm-Datenbank gesendet. Entsprechend streng und gleichförmig läuft heute mein Radio. Bei Filmen oder Büchern aber erzeuge ich viel weniger Verknüpfungen und Datensätze. Und während Songs derselben Bands oft sehr, sehr ähnlich klingen, ist das bereits bei Paul-Auster-Romanen oder Luc-Besson-Filmen deutlich verzwickter.
Und hier beginnen die Probleme: Passig und ich sind Mitglieder eines weiteren „Social Cataloging“-Dienstes – der deutsche Service Criticker.com speichert, fast wie in Oprahs Wunschtraum eines perfekten OWN-Senders, „jeden Film, den wir jemals sahen“ und gibt uns automatisierte Empfehlungen. Ich habe 869 Filme eingetragen und bewertet. Doch die Empfehlungen, die Criticker mir schickt, sind oberflächlich und geistlos: Zeug, das bei Media Markt im selben DVD-Regal stünde. Keine Perlen. Keine Kracher. Als Fahrtenschreiber meiner Film-Biografie ist Criticker großartig. Doch als Wegweiser und Kurator taugt ihr Algorithmus (noch) nichts.
Stattdessen arbeitet die Seite ähnlich plump wie Amazons Empfehlungen: „Sie mochten ‚Spider-Man‘? Wir empfehlen: ‚Spider-Man 2‘.“ Na, danke! Mein Online-Radio darf gerne stundenlang gleichförmige, straffe Klangteppiche weben. Aber frische, kongeniale, subtile, erratische, überraschende Verknüpfungen? Verstörungen? Stolperfallen? Daran scheitert Last.fm. Und Criticker erst recht.
Und Amazon? Hält mich für schizophren: Sobald ich dort Geschenke kaufe, herrscht (Empfehlungs-)Chaos.
.
.
„Bücher sind Bildung. Bildung tut weh.“
Die schlechte Qualität solcher Empfehlungen sticht uns ins Auge, weil wir – im Netz, beim Fernsehen, unterwegs – fast pausenlos für uns privat einordnen, selektieren und verwerfen müssen, Rollen als Kritiker, Scout und Redakteur einnehmen, ohne Mühe, routiniert: 30 Sekunden sind genug, um zu entscheiden, ob uns ein Filmtrailer gefällt. In 10 Sekunden überfliegen wir Websites und Artikel, wägen ab, ob eine gründliche Lektüre lohnt. Uns fehlt die Zeit, durch lange Videos und Fotostrecken zu klicken. Und vor dem Fernseher „sampeln“ wir in zwei Minuten 50 laufende Programme.
Dreimal die Woche, scheint mir, zeigen Hirnforscher oder Soziologen neue Studien über „die Macht das ersten Eindrucks“: Gestalter feilen so fies und diffizil an Bildsprache und visuellen Codes von Shampoos, Spielzeug, Hollywood-Plakaten, bis jede Passantin auf den ersten Blick erkennt, ob sie zur Zielgruppe gehört oder nicht. Und sähe ich morgen eine Meldung, dass Graugänse / Rhesusäffchen / MIT-Studenten nicht länger als 0,028 Millisekunden brauchen, um zu entscheiden, ob ein Gegenüber als Partner / Paarungsziel in Frage kommt – ich wäre nicht überrascht.
Nur Buchempfehlungen bleiben eine Königsdisziplin. Für Programmierer, für Freunde. Für Kritiker, für Buchhändler und Pädagogen.
Zum einen, weil Literatur oft träge 40, 80 Seiten braucht für einen fundierten ersten Eindruck – statt wie ein Song oder ein Film sofort im Lauf der ersten Takte / Bilder wesentliche Eigenheiten (und Schwächen!) zu offenbaren. Zum anderen, weil wir viel mehr Horrorfilme, Sängerinnen, Sitcoms oder Eiscremesorten in unseren mentalen Registern geordnet haben als z.B. New-York-Romane, Bücher über Mütter oder Texte aus dem vorletzten Jahrhundert.
Romane sind schwer zu „erkennen“, schwer zu „durchschauen“, schwer zu sortieren und schwer zu vergleichen; Empfehlungen sind Feinarbeit, Geschmacksprognosen fast Psychologie: Wie viele Spannungs-, Erotik-, und Anspruchs-Punkte verdient Hemingway? Reicht es zum „Tagestipp“? Wie lässt sich „Sommerhaus, später“ fassen? „Bildsprache: 83 Prozent. Satzrhythmus: 90 Prozent. Erzählfluss: 62 Prozent. Lesespaß: 78 Prozent“?
Ist der groteske, alptraumhafte KZ-Roman „Die Wohlgesinnten“ lustig? Schrecklich? Satirisch? Plump? Das kommt vor allem darauf an, wie jeder Leser sich das Buch in seinem jeweiligen Kopfkino inszeniert. Tonfall, Lesart und Stimmung der „American Psycho“-Verfilmung stehen auch dem faulsten Zapper nach zwei Minuten klar vor Augen. Doch welche Teile der – ambivalenteren – Romanvorlage „ernst gemeint“ sind, darüber streiten Exegeten bis heute.
Literatur, mit ihren Subtexten, Grau- und Zwischentönen, braucht Zeit. Wohlwollen. Mitarbeit. Geduld. All ihre Stärken (und Verfehlungen!) werden allein in Sprache transportiert. Als Rezensent zählt es zu meinen allergrößten Pflichten, Zitate auszuwählen, Signale zu setzen, das richtige Buch den richtigen Leserkreisen anzutragen; denn Cover und Klappentext – die einzigen Stellen am Produkt, wo solche Zielgruppen-Kennzeichnung und visuellen Codes Platz hätten – bleiben zu oft nichtssagend, offen und vage.
Bücher sind Black Boxes. Umschläge sind Mogelpackungen. Klappentexte locken ein Publikum mit allen süßen, bösen Versprechungen der Hexe vor dem Knusperkuchenhaus. Und immer, wenn wir kritisch über Texte sprechen wollen, fehlen uns gemeinsame Grundlagen / Bezugspunkte – denn auch die besten Freunde kennen nur 50, höchstens 80 unserer Romane:
„‚Avatar‘ erzählt ‚Der mit Wolf tanzt‘ und ‚Pocahontas‘ als Computer-Schmonzette?“ Verstanden, alles klar. „Jörg Albrecht schreibt im Stil Andreas Neumeisters über Houellebecq– und Hubert-Fichte-Milieus?“ Hä, was?
„Ohne Empfehlung kaufe ich keine Romane mehr“, erklärt Freundin Simone: „Filme sind Unterhaltung. Wenn sie mich enttäuschen, schalte ich weg. Aber Bücher sind Bildung. Und Bildung, haben wir gelernt, tut auch mal weh: Sobald ich einen Roman abbreche, fühle ich mich ignorant und schuldig. Egal, wie quälend die Lektüre war.“
Romane sind Lose, mit obszön vielen Nieten. Ist jedes abgelegte Buch ein Zeichen geistiger Niederlage?
.
.
„90 Prozent von allem ist Kacke.“
Ich bin nicht sicher, warum Leute lesen. In ihrer Freizeit, müde und freiwillig. Und in der festen Hoffnung, ein Stück Prosa könne sie stärker packen und brutaler schütteln als ein Kinofilm (mit charismatischen Gesichtern; Bild, Schnitt und Soundtrack), eine Serie (mit der Vertrautheit und Intimität, die zwischen Publikum und Hauptfiguren wächst) oder eine Dokumentation (Politik! Wissen! Voyeurismus!).
Mein Vater – Halbwaise, Mechaniker, dann Meisterschule, heute selbständig – sagt sehr oft stolz, er hätte sich in seinem ganzen Leben niemals zwingen lassen, einen Roman zu lesen. Meine Mutter – Dorfjugend, Haushaltungsschule, zehn Jahre Arzthelferin bei einem Kinderarzt, danach vier eigene Kinder – war Gold-plus-Mitglied im Bertelsmann-Club und verliebt sich heute alle zwei Wochen in ein paar neue Hardcover aus kleinen Buchläden: „Den Mann habe ich beim Jauch gesehen. Da hat er von seinem Familienschicksal erzählt. Und bei dem anderen mochte ich dieses intensive Rot. Und diese Schrift…! Die Autorin kommt aus Italien.“
Ich hatte immer jemanden, der mir vorlas und zuhörte. Ich hatte immer Hoffnung und Vertrauen in Bücher. Vor allem aber hatte ich immer die Erlaubnis, mir eigene Entdeckungen zu suchen: Christen verschenkten „Fünf Geschwister“ oder C.S. Lewis. Eltern verschenkten (meist schreckliche) „Schneider“-Bücher, weil sie selbst mit älteren Schneider-Reihen aufgewachsen waren. Bei meinen Grundschullehrern gab es Volltreffer (A.S. Neills „Die grüne Wolke“, Jules Verne, „Der Hexenmeister vom flammenden Berg“), und eine Menge Empfehlungen, die mich nur langweilten und irritierten (Roald Dahl, „Der Hobbit“, Fabeln und Märchen).
Spätestens als Teenager krebste jeder von uns ohne Ratgeber, Mentoren, Hilfestellung durch Büchereien und Bahnhofsbuchhandlungen: Ich las „Der Fänger im Roggen“, weil a) ein Artikel zu „Millennium“, der Schwesterserie von „Akte X“, erwähnte, das Buch habe den Attentäter John Hinckley dazu inspiriert, Ronald Reagan zu erschießen… und b) zur selben Zeit Ace of Base in ihrem Gute-Laune-Song „Life is a Flower“ von „Catcher in the Rye“ sangen.
Ich las Victor Hugos „Die Elenden“, weil Onkel Dagobert im „Lustigen Taschenbuch“ Nr. 143 als Flüchtling „Jean Valduck“ durch Paris schlich. Ich las „What I loved“, allein wegen des hübschen Covers. Ich las „The Lost Language of Cranes“, weil mir der Titel, „Die verlorene Sprache der Kraniche“, bekannt vorkam. (Tatsächlich waren es dann Baukräne, keine Kraniche.)
Blindflüge, Glücksgriffe, wirre Beliebigkeit: „Glastonbury Romance“ von John Cowper Powys wurde in TV Highlights empfohlen, zwischen Artikeln zu „Xena“ und „Buffy“. „You can’t go home again“ von Thomas Wolfe stahl ich aus der Schulbibliothek [Weg 11], weil ich Wolfes Lebenslauf sympathisch fand. Und Nabokov – mein dritter großer Lieblingsschriftsteller – lag auf dem Flohmarkt [Weg 12]: Für jeden Fetzen Popkultur hatte ich eigene Experten, Filter, Testberichte. Bei Literatur aber vertrauten wir auf unser Anfänger- / Idiotenglück.
Und merkten doch: Die „Klappentext + Cover + ‚Ich habe den Namen mal gehört: Läuft das nicht bald im Kino?’“-Strategie ist keine Lösung.
„Man könnte sagen, 90 Prozent aller Science Fiction sei Müll, Kacke und Dreck“, schrieb der Science-Fiction-Autor Theodore Sturgeon 1958, „doch unter diesem Blickwinkel stünde genauso zu behaupten, auch 90 Prozent aller Filme, Literatur, Konsumprodukte seien Kacke.“
Bekannt als „Sturgeons Gesetz“, halte ich diese These für tröstend und plausibel. Doch während andere Kunstformen eben nebenbei, ohne große Mühe entdeckt, verstanden, durchstöbert und sortiert werden können… und hundert engagierte, vertrauenswürdige Fürsprecher, Fan- und Fachorgane haben…
…bleibt Literatur für beinahe jeden, den ich kenne, ein Rätsel – voller Enttäuschungen.
.
.
„50 wirklich große Romane des 20. Jahrhunderts“
Acht Dinge, die ich vor acht Jahren, in meinem ersten Semester Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim, nicht wusste: Wie man „Feuilleton“ schreibt. Wofür „KiWi“ steht. Was Adorno, Walter Benjamin und die Frankfurter Schule wollten. Dass man „Pruust“ sagt, nicht „Praust“. Was Edit, uschtrin.de, Klagenfurt, der open mike und Literaturen sind. Wie „Fräuleinwunder-“ oder „Popliteratur“-Autoren schreiben. Dass „Poesie“ und „Poetik“ zwei verschiedene Dinge benennen.
Vor allem aber: Was man „gelesen haben muss“. So viel wie möglich? Jeden? Alles?
Im Jahr 2003 las ich 20 Bücher. Im Jahr 2004 las ich 132 Bücher. Im Jahr 2005 las ich 203 Bücher. Aber nach welcher Auswahl? Welcher Logik? Ich fragte alle neuen Freunde, Professoren, Schreiber nach ihren Favoriten [Weg 13]. Ich legte Listen und Wunschzettel an [Weg 14]. Ich kaufte preisreduzierte Mängelexemplare [Weg 15] von jedem Autor, der mir dem Namen nach vertraut war – und suchte besonders billige Bestseller und Klassiker im Amazon Marketplace [Weg 16]. Ich verabschiedete mich vom Zwang, jedes Buch zu Ende lesen zu müssen [Weg 17], aber las gerne möglichst viele verschiedene Stimmen über denselben Ort oder dasselbe Thema [Weg 18].
Ich verstand, dass Debütromane oft mehr Schwung und Dringlichkeit bieten als die zweiten oder dritten Bücher eines Autors [Weg 19]. Dass es – Kulturförderung ahoi! – überproportional viele Österreicher und Schweizer gibt, die auch von schlechten Büchern leben können [Weg 20]. Dass jeden Herbst und jeden Frühling vier bis fünf junge Frauen mit „Aufsehen erregenden“ Kurzgeschichten durch die Presse getrieben werden, doch bald vergessen sind, den Beruf wechseln und sich von einer Welle (noch jüngerer) Geschichtenfrauen ersetzen lassen [Weg 21]. Und, dass es oberflächlich, aber extrem hilfreich ist, bei älteren Autoren nachzusehen, ob sie auf ihrem Autorenfoto verklemmt wirken… oder offen [Weg 22].
In knapp drei Jahren schrieb ich etwa 150 Buchkritiken: Ich hatte Neugier, Ehrgeiz, Spaß und fand schnell einen guten Ton (nicht schwer – nach einer Kindheit voller Film-, Spiel-, Serien-Kritiken…). Doch hätte ich Sterne vergeben müssen für meine Lektüren, ich hätte nur 28 (von 355) Büchern 5 von 5 zugestanden: 82 Bücher waren 4-Sterne-Kandidaten, 145 Bücher ödes Mittelfeld, 95 waren dumm und / oder schlecht (2 Sterne), und fünf Totalausfälle. Ich las – und lernte – sehr, sehr viel. Aber ich las nicht gut.
Ab Frühsommer 2004 veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung „50 große Romane des 20. Jahrhunderts“. Der biedere 2002er-Kanon von Marcel Reich-Ranicki – 20 Romane aus dem deutschen Sprachraum, geschrieben von 16 Männern und einer (!) Frau, 149 Euro – schien mir arg garstig. Aber jede Woche Weltliteratur, via SZ? Eine Art „Grundkurs Roman“, zum zweiten Semester? Ich kaufte 50 Bücher. Las 33. Und mochte… 8.
Zwei meiner besten Freundinnen – Pädagoginnen, Gelegenheits- und Hobbyleser – schafften die vollen 50. Aber auch sie hatten kaum Freude. Als 2007 Band 51 bis 100 nachgelegt wurden, seufzte Freundin Schumi: „Zu welchem Motto, dieses Mal? ’50 wirklich große Romane des 20. Jahrhunderts‘? Ich glaube, hier höre ich auf.“
Heute, Ende 20, liest sie noch fünf bis sechs Romane im Jahr. „Weißt du? Ich bin abends immer so müde.“
.
.
„Ich muss doch MIT ERWARTUNGEN SPIELEN!“
Dieselbe Müdigkeit / Ernüchterung zieht sich durch all meine Bekanntenkreise: Gestresste Frauen verlieren die Geduld für Literatur und schauen lieber „Big Bang Theory“. Männer lesen – wenn überhaupt – schnelle Sachbücher, Comics, Thriller. Selbst Freunde, die ihr Geld mit Schreiben verdienen, zucken bei meiner wöchentlichen „Was Tolles gelesen? Entdeckt? Verschlungen?“-Frage resigniert die Schultern: Ein Buch kostet vier bis zehn Stunden Lebenszeit / Konzentration. Nach meiner Erfahrung aber „lohnt“ kaum jedes dritte oder vierte.
Und jedes Mal, wenn mir ein Freizeitleser seine enttäuschenden Lektüren klagt, spüre ich den Drang, ihn in den Arm zu nehmen und, im Namen aller Schriftsteller der Weltgeschichte, zu sagen: „Dir wurde ein schöner Tag gestohlen. Das schmerzt mich sehr. Doch bitte glaub weiterhin an unsere guten Absichten!“
„Nein – Chance verspielt“, sagt Freundin Antje: Nach einem Jahrzehnt voll hässlicher Erfahrungen mit Karen Duve, Uwe Timm und ein paar Jüngeren misstraut sie deutschsprachiger Literatur. „Sobald sich eine Liebesgeschichte anbahnt oder eine Figur als Sympathieträger heraussticht, kommt es mir vor, als sage sich der Autor: ‚HALT! Ich muss doch MIT ERWARTUNGEN SPIELEN!‘ Ein paar Kapitel später liegt wieder alles in Trümmern und die Figuren verhalten sich wie Wahnsinnige.“
Ich sehe, was Antje meint. Ich teile ihr Unbehagen: Geschichten, die als Romanzen, Krimis oder Reiseberichte starten, mit sattelfesten Helden und klaren Konflikten, enden oft irgendwo am Abgrund, in Sackgassen und schiefen Abzweigungen. Autoren überrumpeln ihre Hauptfiguren, lassen die Leser im Regen stehen. „Ist dir die Handlung unterwegs entgleist?“, würde ich Juli Zeh oder Ingo Schulze oft gerne fragen. „Stehst du auf Kriegsfuß mit deinen Figuren? Deinen Themen? Oder mit uns – dem Publikum?“
Wer deutsche Romane liest, kennt kalte Duschen. Und kalte Schultern.
.
.
„Wir lesen, um mit unseren Gefühlen klarzukommen.“
Noch vor zwei Wochen hätte ich dieses Essay mit einem pragmatischen und etwas traurigen Ratschlag abgeschlossen: „Lasst euch gelungene deutschsprachige Bücher von euren Freunden und Vertrauten empfehlen [Weg 23], doch stöbert im Zweifelsfall, wenn ihr ganz neue Entdeckungen machen wollt, lieber bei den US-Autoren.“
Amerikanische Romane sind oft etwas eingleisiger und straffer, überraschungsloser – aber um Welten sauberer erzählt: Wer einen Internats-, Familien- oder Autohausroman auf dem US-Buchmarkt platzieren kann, der weiß in aller Regel eine Menge über Familien, Internate, Autohäuser, kennt (und schätzt) seine literarischen Vorläufer und würgt nicht mittendrin plötzlich umher, als hielte er Autohändler, Internatsschüler, Familien (oder Romane an sich!) für die peinlichsten, lächerlichsten und sowieso langweiligsten Auswüchse der Welt.
Literary Fiction hat klarere Plots. Ein stärkeres Formbewusstsein. Autoren mit festerem Profil (wenngleich manchmal etwas weniger Wagemut). Meist ist sogar die Bildsprache der Umschläge so simpel und normiert, dass man die schlimmsten Fehlkäufe vermeiden kann [Weg 24]: In Deutschland haben Romane von Martin Suter und Anton Tschechow dieselbe Optik. Auf vielen US-Covern dagegen sagt allein die Farbe Lila: Hier geht’s um junge, schwarze Frauen. Danke!
Ist das also die letzte, die wesentliche Unterscheidung? Runde, saubere, etwas blasse US-Romane… gegen die schiefen, kantigeren deutschsprachigen (Nicht-)Erzähler?
Nein. Wer gute Bücher finden will, braucht eine andere, feinere Trennlinie:
„Wir lesen, um mit unseren Gefühlen klarzukommen“, sagte Elke Heidenreich 2003 über die Buchauswahl zu ihrer ZDF-Sendung „lesen!“. „’Literatur‘ im eigentlichen Sinne interessiert sie nicht die Bohne“, lachte der Spiegel über die „Lesemutter der Nation“ und ihre „herzenswärmsten“ Buchtipps: „Ihr genügen ‚Geschichten, die nicht dusselig sind‘ und ‚mit uns allen zu tun haben’“, und ihre Zuschauer „sollen glauben, kaufen und fühlen – weniger denken.“
Diese Haltung – mehr Herz, mehr Bauch, weniger Kopf – passt auch zu Stephen King, der 2010 im Nachwort zu „Zwischen Nacht und Dunkel“ schrieb, er „möchte bei meinen Lesern eine emotionale, sogar instinktive Reaktion hervorrufen. Sie zum Nachdenken zu bringen, während sie lesen, ist nicht mein Ding.“
Persönlich könnte ich unmöglich (sauber) trennen zwischen „Gefühls-“ und „Kopf“-Literatur. Doch King setzt einen smarten, ungewöhnlichen Schnitt: „Ich habe nichts gegen literarische Prosa, die sich meist mit außergewöhnlichen Menschen in normalen Situationen befasst, aber als Leser und Autor interessieren mich gewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Situationen weit mehr.“
Zwei Sorten Literatur. Zwei Sorten Hauptfiguren. Zwei Sorten, zu erzählen und zu lesen.
…und die zwei besten Strategien zum Finden guter Bücher:
.
.
„Gestatten? Dein nächstes Lieblingsbuch.“
Für Publikums- und Heidenreich-Romane, für jene Mehrheit aller Texte, in denen „gewöhnliche Menschen“ in „außergewöhnliche Situationen“ schlittern, entwickeln sich präzise Massenwertungen im Internet – das IMDb-Prinzip, auf Literatur angewandt – zum besten Auswahl- und Empfehlungsmechanismus: Seit fast fünf Jahren sortieren bislang 5 Millionen Leser ihre Bücher auf die „virtuellen Regale“ von Goodreads.com [Weg 25]. Für Freizeitleser, Scouts, Kritiker und Redakteure gibt es im Netz keinen prächtigeren Ort zum Sammeln, Jagen, Archivieren, Beraten und Beratenwerden.
Das (weitgehend) englischsprachige Social Network ist ein Katalog wie Last.fm, ein Seismograf wie IMDb und eine Fundgrube für Bestenlisten, Publikumslieblinge und Geheimtipps: Ein Buch ab 4.0 ist (beinahe immer) lesenswert und klug, ein Buch unter 3.5 hat (mindestens) große Schwächen und Probleme. Zu jedem US-Bestseller und jedem Klassiker gibt es Hunderte Rezensionen. Und bei noch unveröffentlichten Titeln posten Verlagsinsider oder Journalisten oft schon im Vorfeld ihre persönlichen Urteile.
Auf Perlentaucher.de, dem deutschen Pressespiegel für professionelle Literaturkritik [Weg 26], herrscht oft ein müder, falscher Respekt vor großen Namen: Don DeLillos vermurksten Roman „Falling Man“ etwa nennt die taz „nicht hundertprozentig gelungen“, die FAZ ist „tief beeindruckt“, die NZZ „ein wenig enttäuscht, aber auf hohem Niveau“, und die Frankfurter Rundschau „überwältigt“. Goodreads sagt schlicht: 3.12 von 5, und schon mit Klick auf Don DeLillos Namen empfehlen sich seine früheren Romane „Unterwelt“ (3.90 / 5) und „Libra“ (3.89 / 5) als gefälligere, sicherere Empfehlungen.
Statt einem populären Autor also blindlings auch durch seine schwächeren Bücher zu folgen, vermisst Goodreads die Höhen und Tiefen einer Autorenkarriere mit bemerkenswerter Akkuratesse: Die besten Romane von Nabokov sind „Fahles Feuer“ (4.24) und „Ada“ (4.18), der schlechteste Roman von Bret Easton Ellis ist „Imperial Bedrooms“ (2.99), John Updikes bestes „Rabbit“-Buch ist „Rabbit in Ruhe“ (3.96), und Sven Regeners „Neue Vahr Süd“ (4.00) ist tatsächlich ein Tick besser als „Herr Lehmann“ (3.90). Kluge Nutzer, klare Urteile: Schwarmintelligenz at its best.
Empfehlenswert also – laut Goodreads-Konsens – im Herbst 2011: António Lobo Antunes‘ „An den Flüssen, die fließen“ (4.00), Markus Nummis „Bonbontag“ (4.08), William Trevors „Turgenjews Schatten“ (3.97). Viele bekanntere Titel dagegen, die in der Presse stärker umworben und beachtet wurden, fallen bei Goodreads durch: Umberto Ecos „Der Friedhof in Prag“ (3.25), Lee Rourkes „Der Kanal“ (3.43), Nicholson Bakers „Haus der Löcher“ (3.04), Chuck Palahniuks „Diva“ (2.70).
Natürlich hat dieser „Beliebt! Berührend! Bekömmlich!“-Populismus seine Schwächen: Kinder-, Fantasy-, Vampirbücher und Mangas (Sparten also, die enthusiastische Fans locken) erhalten meist sehr hohe Wertungen. Kurzgeschichten, Autobiografien, Journalismus und Veröffentlichungen aus dem Nachlass schneiden ebenfalls im Schnitt 0.5 Sterne besser ab als Romane. Deutsche Titel werden bis jetzt noch kaum bewertet… und Lovelybooks.de, ein kuschelweiches deutschsprachiges Angebot voll Kerstin-Gier- und Tommy-Jaud-Lesern, ist leider keine Alternative.
„Was, wenn ich jede Geschichte, die mich je bewegte… jeden Song, zu dem ich jemals tanzte… all meine wichtigsten Stunden… greifen könnte – und mit euch teilen?“, fragte Oprah Winfrey. Goodreads gibt darauf eine erste Antwort: Dann wüssten wir – durch Winfreys Auswahl – ein bisschen besser und genauer, welche Geschichten bewegend, welche Songs tanzbar, und welche Stunden wichtig sind.
Nicht jeder muss all seine Bücher katalogisieren. Doch jede Bewertung (und Warnung!) hilft, das richtige Buch den richtigen Leserkreisen anzutragen. Uns gegenseitig vor Enttäuschungen wie „Falling Man“ zu retten. Und ältere oder unbekannte Lieblingsbücher im Gespräch zu halten.
Das Feuilleton – tagesaktuell, aber zu oft fixiert auf etablierte, alte, weiße Männer – kann solche Überblicke nicht leisten.
.
.
„Ein Verzeichnis wundervoller Dinge“
Ich arbeite an Seite 280 meines Romans „Zimmer voller Freunde“: ein Buch über drei Elftklässler in der Provinz und ihre Familien, Cliquen und Romanzen. „Ach so – ein Jugendbuch?“, fragt man mich oft. Doch erst, seit ich bei Goodreads gut zwei Dutzend populäre Young-Adult-Titel ausgesucht, bestellt, gelesen hatte, habe ich darauf eine klare Antwort: Nein. Kein Jugendbuch.
Zwar haben mich viele dieser High-School- und Coming-of-Age-Romane gefesselt, überrascht, beeindruckt. Aber fast immer gab es einen Ich-Erzähler, ohne Biss. Und viel zu oft war diese Hauptfigur das schwächste Glied, die möglichst offene, bekömmliche, banal-sympathische Identifikationsfläche zum Mitfühlen / Mitleiden. Fast alle Autoren aber, in deren Traditionslinien „Zimmer voller Freunde“ steht, erzählen… anders.
Richard Yates‘ „Zeiten des Aufruhrs“, Richard Fords „Unabhängigkeitstag“, Rick Moodys „Der Eissturm“, Alison Bechdels „Fun Home“ oder Thomas von Steinaeckers „Wallner beginnt zu fliegen“ handeln – danke, Stephen King! – von „außergewöhnlichen Menschen in normalen Situationen“: Wenn Peggy Olson in „Mad Men“ eine Bar betritt, ist nie ganz klar, wonach sie sucht, und wie der Abend enden wird. Wenn meine Dorfjugend in „Zimmer voller Freunde“ auf den Schulbus wartet, herrscht eine nervöse Spannung. Brüchiges Eis.
Elke Heidenreich und Goodreads helfen uns, Konsens- und Publikumsromane zu finden, die „nicht dusslig sind“ und „mit uns allen zu tun haben“. Schwerer – aber lohnenswerter – sind jene literarischen Empfehlungen, die ihren Lesern ein Stück näher kommen. Sie kitzeln. Irritieren. Treffen. Weil sie mit uns – und nur mit uns – zu tun haben:
Freund Fred mag ruhige, schüchterne Männer als Hauptfiguren – Rollen für Schauspieler wie Tobey Maguire und Elijah Wood. Freundin Maria mag sachliche Mütter und Väter – Figuren, die sich um Kinder kümmern, doch in der schlimmsten Krise besonnen bleiben. Freund K. mag – im Privatleben – kühle, kluge, arrogante Frauen. Doch andererseits fühlt er sich schnell bedrängt und drangsaliert. Ich lieh ihm ein paar Superheldencomics. Doch alle „Wonder Woman“-Hefte legte er sofort zur Seite. Mit einem Schaudern.
„Empfehlen und Verleihen“, schreibt Kathrin Passig, „sind überwiegend Gefallen, die der Empfehlende und Verleihende sich selbst tut. Für den Empfänger sind sie selten so nützlich, wie wir uns wünschen.“
Ich glaube, nichts wird gerade wichtiger als solche Empfehlungen: Felix von Leitner filtert in seinem Blog politische Skandale, Lügen und Peinlichkeiten aus der Tagespresse. Ronnie Grob sammelt in „6 vor 9“ auf Bildblog.de jeden Morgen sechs Wortmeldungen über Netzkultur und Journalismus. Auf Goodreads folge (und vertraue) ich den Empfehlungen von Kuratoren wie Richard Nash, Oriana Leckert und Jason Pettus [Weg 27].
Egal, ob via Facebook, Blogs oder persönlich: Statt durch Leitmedien erreichen mich die meisten Nachrichten heute durch Leitfiguren – zum Beispiel auf BoingBoing.net, „A Directory of Wonderful Things“, wo Cory Doctorow (Romancier und Datenschützer), Mark Frauenfelder (Illustrator und Heimwerker), Xeni Jardin (Feministin und Cyberpunk) und Maggie Koerth-Baker (Wissenschaftlerin und Katzenblogger) täglich vier Dutzend Essays, Fotos, Produkte, Absurditäten auswählen und vorstellen.
Ich kaufe, jedes Jahr, etwa 150 Bücher. Ich lese zwischen 90 und 120. Ich rezensiere, für Zeitungen, etwa ein Dutzend. Ich gebe 5 Sterne – an etwa 8 bis 10. Ich gebe 4 Sterne – an etwa 30. Ich kaufe gut 40 persönliche Empfehlungen / Geschenke für Freunde und Verwandte. Und ich empfehle (und warne!), wo ich kann: in meinem Blog [Weg 28], auf Facebook oder Twitter. Öffentlich und auf Goodreads. Oder persönlich und privat.
„Was, wenn ich jede Geschichte, die mich je bewegte… jeden Song, zu dem ich jemals tanzte… all meine wichtigsten Stunden… greifen könnte – und mit euch teilen?“, fragte Oprah Winfrey. Dann hätte ich, als Mosaik aus Songs, Geschichten, Stunden, die freie Sicht auf Oprah Winfreys Sensibility. Auf ihren idiosynkratischen Filter. Darauf, wie ihre Augen die Welt sehen. Was sie kitzelt. Irritiert. Und trifft.
Und das macht gute literarische Empfehlungen aus: Ich muss verstehen, woher eine Empfehlung kommt (Winfrey mag Bildungsromane, Survival Stories, Erbauungs- und Bekehrungs-Literatur). Ich muss verstehen, an wen sie geht (Fred mag ruhige, schüchterne Männer als Hauptfiguren).
Wir werden – auf der Suche nach guten Büchern – zu Kuratoren. Zu Psychologen. Zu Schnittstellen.
Zu Kupplern.
Hier meine Auswahl. Gutes Lesen!
- 250 Bücher, die ich kenne… und empfehle! (Link)
- 250 Bücher, in die ich große Hoffnungen setze. (Link)
Stefan Mesch, geboren 1983 in Sinsheim (Baden), schreibt für die ZEIT, den Berliner Tagesspiegel und literaturkritik.de.
.
Er studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim und war Mitherausgeber der Literaturzeitschrift „BELLA triste“, Editor des „Kulturtagebuch“-Projekts, und Mitveranstalter von „PROSANOVA“, dem Festival für junge Literatur.
.
Seit 2009 schreibt er „Zimmer voller Freunde“, seinen ersten Roman.
.
aktuellste Artikel unter: http://www.zeit.de/autoren/M/Stefan_Mesch/index.xml
.
Kontakt: smesch@gmx.net
.
.
.











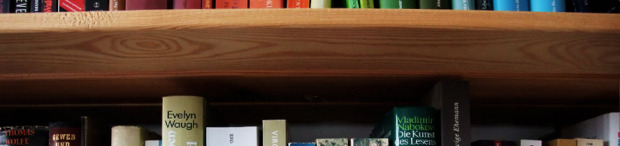
ich benutze zwar schon länger goodreads, habe aber gerade zum ersten mal bewusst auf die allgemeinen bewertungen geachtet. und siehe da: bei meinem lieblinsautor (matt ruff) ist die beliebtheitsrangfolge der einzelnen bücher die selbe wie meine persönliche, und auch sonst schnitten bücher, die ich gut fand, einigermaßen regelmäßig gut ab, bücher, die ich schrecklich fand, einigermaßen schlecht.
ob ich das super oder doch auch ein wenig gruselig finde, weiß ich noch nicht