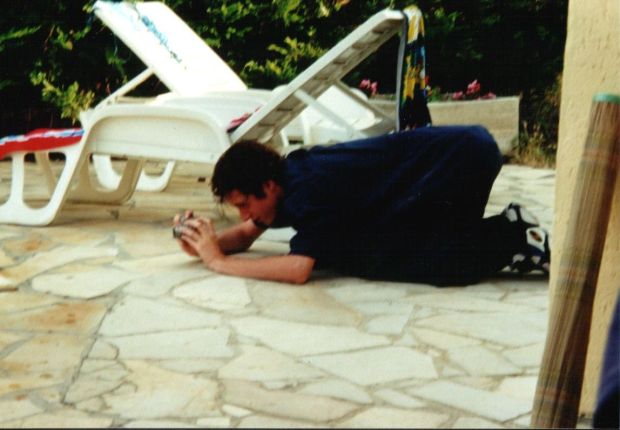Der dümmste, schlimmste, widerlichste Satz, den ich 2012 las, stand auf der Facebook-Pinnwand einer Bekannten (und jungen Mutter):
„Das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben.“
Schlimm scheint mir dabei weniger die Aussage („Wenn Vatis Muttis ganz doll lieben, tut das der ganzen family gut!“), als das Männer-, Frauen-, Familien- und Rollenverständnis dahinter: Abgründe tun sich auf – allein, wenn ich mich frage, was geschehen wäre, hätten meine Eltern versucht, nach dieser Maxime zu leben. Ein kleiner, verkrachter, überspannter Satz, der – zu Ende gedacht, und an konkreten Menschen durchgespielt – einen monströsen Konflikt spannt.
„Mad Men“ (AMC, seit 2007, bislang fünf Staffeln) ist das aktuellste Ensemble Drama, das mir auf ähnliche Weise – meist mit nur einer kurzen, brillant verkrachten Aussage – den Boden unter den Füßen entreißt. Eine ruhig erzählte, gediegen inszenierte Werber- und 60er-Jahre-Serie, in der oft 30, 35 Minuten am Stück nichts zu passieren scheint. Alle Figuren sind lauernd, zurückhaltend, gepflegt, voller Selbstbeherrschung und (vermeintlich: sicher) eingeschnürt ins Korsett ihrer Klasse, ihres Berufs und der historischen Ära.
“Ich weiß, wie viele Leute ‘Mad Men’ mögen…”, seufzte ein Toronto-Freund im Frühling. “Aber jedes Mal, wenn es im Fernsehen läuft, schalte ich [gefühlt] in dieselbe Szene: eine Frau sitzt am Schreibtisch. Eine andere Frau tritt hinzu. Sie sagt: ‘Hier ist der… Tacker.’ Dann starren sich beide an – schweigend und ernst.”
Man spürt, als Zuschauer: Hier läuft noch etwas anderes. Noch im banalsten Dialog vollführen „Mad Men“-Figuren einen schmerzhaften, nie völlig überzeugenden Balanceakt: Sie täuschen einander – und sich selbst. Und jederzeit können diese Täuschungen scheitern. Dünnes Eis. Großes Risiko.
Die Elftklässler in „Zimmer voller Freunde“ sind zorniger, offener, leichtsinniger: Sie haben weniger zu verlieren, viel zu verbergen (aber amüsant wenig Übung / Routine, sich erfolgreich zu verstellen), und viele von ihnen genießen es, hässliche Wahrheiten auszusprechen, einander zu reizen: Das Milieu des Romans ist ähnlich nervös, die Figuren ähnlich empfindlich – doch die „Betriebstemperatur“ von „ZvF“ ist höher als beim unterkühlten, trockenen, oft scheinbar „ruhigen“ „Mad Men“:
„Mad Men can be difficult to watch if you aren’t into/accustomed to understated drama. Almost all of the show is dialogue and minute physical interactions with larger dramatic implications.“ [Zitat aus einer Diskussion im Webforum Reddit, Link]
Die (kleine) „Mad Men“-Taktik, dir mir in vielen „Zimmer voller Freunde“-Szenen hilft, Figuren in Position zu bringen, Konflikte zu schärfen, Spannungen zu schüren, sind „schlimme“, suggestive Sätze:
-
„This never happened. You’ll be amazed how much this never happened“, der väterliche, gut gemeinte Rat, persönliche Schwächen unter den Teppich zu kehren, indem man lebt, als wäre nie etwas entgleist („Mad Men“, fünfte Episode der zweiten Staffel), hängt seit drei Staffeln beiden Figuren – dem Ratgeber und der Empfängerin – in jeder Szene als hässliches Echo nach: „Ja? Wirklich? Ist all das für dich nie passiert?“, will man als Zuschauer ständig fragen: „Ist es bewältigt – nur, weil du sagst: ‚Das ist vorbei’…?“
-
„We’re dealing with the emotions of a child“, urteilte ein Psychologe (sehr früh: in Episode 7 von Staffel 1) über Betty Draper, Hausfrau und Mutter. Seitdem wirkt jede Handlung Bettys – als Ehefrau und Mutter, als Tochter und „Erwachsene“ – wie Teil eines heimlichen Experiments: Sind Bettys Handlungen erklär-, entschuld-, entschlüsselbar? Hilft uns die (überhebliche, boshafte) Betty-ist-ein-Kind-Behauptung, um ihre Taten und Urteile zu verstehen?
Diese Sätze – Zuschreibung oder Selbstaussage – müssen nicht korrekt sein oder eindeutig: Sie sind kein „Schlüssel“, um Figuren zu enträtseln. Im besten Fall schwingen sie – als offene Fragen und Verweise auf größere Themen – im Lauf der Serie immer weiter mit, und werden, in späteren Entscheidungen / Konflikten, aus immer neuen Perspektiven, zur Diskussion gestellt:
„Mach du nur immer alles richtig, Maus. Mach bitte nie irgendwas falsch! In Ordnung? Gut? Habe ich dein Wort?“ …verlangt ein Vater in „Zimmer voller Freunde“.
„Jedes Mal, wenn ich ein Mädchen sehe, wünsche ich mir, ich wäre mit ihr zusammen. Das ist das einzige, was ich wirklich will.“ …schreibt Frank.
„Ich hasse sie. Ich hasse sie alle. Was für arme Menschen!“ …erklärt B, als eine mehrerer Figuren, die überall „Statisten“, „Figuren“, „Marionetten“ sehen.
Mein letztes Beispiel – über Bande gespielt: „Für ihre Tochter würden die beiden alles tun“, belächelt X die Eltern von Y. „Doch Y belügt sie, wo sie kann.“
Das spannt – für X und Y, und alle folgenden Kapitel – Fragen:
-
Was heißt „alles tun“: Bleibt Ys Familie bei allen Problemen und Zumutungen loyal? Was wird ihnen, im Lauf der Handlung, von Y abverlangt?
-
Wünscht sich X insgeheim solche Eltern? Haben Y und X „passende“ Eltern? Was wäre, wenn X mit Ys Eltern leben müsste?
-
Sind diese Eltern „stark“ oder „schwach“? „Gut“ oder „schlecht“?
-
Und: Falls Y tatsächlich „lügt, wo sie kann“, wie belastbar ist dann die Freundschaft zwischen X und Y?
.
Ich lese Bücher, um – in Ruhe, mit großer Konzentration, Intensität – einzelnen Erzählern, der Schönheit (oder: Absurdität) ihres Denkens zu folgen. Tolle Sprecher, tolle Stimmen, tolles Denken wie bei Ruth Klüger, Joan Didion, Marcel Proust, Nabokovs „Lolita“.
Doch sobald mehr als zwei Figuren im Zentrum stehen, sind Serien das reichere, besser entwickelte, erwachsenere Format: Sie haben…
-
Schauspieler (Charisma! Sex-Appeal! Nonverbale Kommunikation!).
-
eine Trickkiste aus Bildsprache, Schnitten, Ton, Musik.
- und, idealerweise: sechs, sieben, acht Jahre Zeit, Figuren aufzubauen, einem Publikum vorzustellen, sie wachsen zu lassen oder zu zerstören, korrumpieren.
Gemeinhin gelten Romane als bestes Medium für Empathie, Identifikation, Sich-selbst-im-Geschehen-Verlieren: Wer eine Hauptfigur nicht sehen muss, reicht ihr schnell zutraulich die Hand und lässt sich führen. Kinder-Helden wie Charlie Brown und Romance-Ich-Erzählerinnen wie Bella Swan sind absichtlich so offen, schlicht, neutral wie möglich gestaltet; und „Tim & Struppi“ lockt mit Hintergründen / Szenerien, detailverliebt und realistisch, doch die Figuren bleiben simple Chiffren:
Projektionsflächen, Identifikationsangebote, so offen, locker, harmlos, dass man – ohne Reibung, Widerstände, Entfremdungen, „Wie ist der denn drauf?“-Irritationen – in die Beobachter- und Heldenrolle schlüpfen, sich mitreißen lassen, staunen kann.
Vor allem Genre-Romane [und: Jugendbücher] laden ein, sich der Hauptfigur und / oder dem Erzähler gemein zu machen: Identifikation. Empathie. Katharsis, wie sie Aristoteles forderte.
Seit etwa 15 Jahren entwickeln Serien wie „Mad Men“ [gelungen, meiner Ansicht nach: „Six Feet Under“, „Weeds“, „Enlightened“, „Girls“] eine eigene, gegenläufige Tradition: abschreckende Hauptfiguren. Stolper-Sätze. Verfremdung. „Wie ist der denn drauf?“
„Im Juli 1993, in meinem letzten Sommer vor dem Gymnasium, besuchte ich alle Figuren meiner Grundschulklasse. Sogar die Türken und das Mädchen aus der DDR, das nur eine Dreizimmerwohnung hatte. Wir spielten Barbie oder Lego, ich fragte nach dem Weg zum Klo – und alle fanden mich erst später, im Hobbyraum oder Speicher. Doch niemand schien gekränkt. Einige Eltern wirkten fast… geschmeichelt, gaben eine Führung durch ihr Haus. Mehrere Kinder luden mich ein zweites Mal ein. Und mit zwei, dreien habe ich stundenlang gespielt – friedlich, in zwei getrennten Zimmern.“ [Zitat aus „Zimmer voller Freunde“]
Mögen muss man solche Protagonisten nicht.
Doch es macht Spaß, sie zu beobachten – in ihrer Hybris und ihren Balanceakten. In ihren Selbsttäuschungen. In ihrem Korsett. Ihrer verkrachten Sprache.
Dünnes Eis. Großes Risiko. „Wie sind die alle drauf?“
.
.
Stefan Mesch schreibt an “Zimmer voller Freunde”, seinem ersten Roman…
…und – hin und wieder – über Serien und Fernsehen, z.B. hier und hier.
- Poetik / persönlicher Text: „Beverly Hills, 90210“
- Poetik / persönlicher Text: Thomas Wolfe
- Poetik / persönlicher Text: „Dawson’s Creek“
- Poetik / persönlicher Text: „Willkommen im Leben“