Ich erzähle jetzt mal meine Quoten-Geschichten.
Also:
Ich habe mal eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte gemacht. Damals, mit 16 Jahren und Realschulabschluss.
Nach meiner Ausbildung wurde ich übernommen und wurde danach als erste Frau im Hauptamt eingesetzt, welches zuvor ein rein männerbeseztes Fachamt der Stadtverwaltung war. Im Hauptamt geht es inhaltlich um organisatorische Fragen einer Stadtverwaltung und genau darin bestand auch mein Job. Quasi ein interner Unternehmensberater. Juniorlevel natürlich.
Halt. Es gab eine Ausnahme. Die Sekretärin des Amtsleiters. Die war scheinbar heilfroh, das nun eine weitere Frau im Amt war und übertrug mir direkt die ehrenvolle Aufgabe, den Männern des Amtes die Essensmarken für die Kantine zu verkaufen (Ja, das gab es damals). Doch statt wie sie, von Büro zu Büro zu gehen, dachte ich mir “das ist doch bekloppt, ich hänge einen Zettel an schwarzen Brett, wer Marken haben will soll zu mir ins Büro kommen”. Keiner der Männer hat in dieser Woche in der Kantine gegessen. Und ich hatte mein erstes Personalgespräch. Ich könne mir das nicht erlauben. So als junge Frau. Aber die Idee sei ja nicht schlecht. Dies als Anekdote meiner ersten Arbeitswoche in einer Männerwelt.
Mein Job bestand damals darin, den zentralen Schreibdienst der Stadt mit EDV auszustatten und die elektronischen Schreibmaschinen abzulösen. Nach einem Jahr war mein Interesse an IT noch mehr entbrannt als vorher (Vorher: Mit dem ersten Freund am ZX81 rumgelötet). Daher habe ich mich bei der Stadtverwaltung beurlauben lassen (Gott sei Dank, geht das) und mein Fachabi nachgeholt. Dann habe ich meine Beurlaubung verlängert (nochmal dem Verwaltungsgott danken, für die Möglichkeit) und habe Wirtschaftsinformatik studiert. Aus der Not, da weder reine Informatik noch medizinische Informatik damals an einer FH möglich waren oder meine Abinote dem entgegenstand. *hust*
Während der ersten beiden Semester habe ich in den Semesterferien bei der Stadt gearbeitet. Natürlich in irgendeinem Amt, weil mein alter Job längst besetzt war. Am Ende sagte mir der Abteilungsleiter: “Tja, Frau Pickhardt, vielleicht haben Sie ja später mal über eine Frauenquote eine Chance auf eine qualifizierte Stelle”. Konnte ich nix drauf sagen, stand nur mein Mund offen. Später habe ich gedacht, das ist sicher ein sehr verbitterter Mensch.
Grundsätzlich kann ich sagen: Die Frauenquote in meinem Studienjahr war extrem hoch. Ich schätze zwischen 30-40 Prozent. Der prozentuale Anteil der Frauen, die wirklich den Abschluss gemacht haben, war (gefühlt) noch höher.
Mein erster Job war dann in einer kleinen Unternehmensberatung. Als erste Frau in einem Männerteam. Der Seniorchef musste lange überzeugt werden, es mal mit einer Frau zu versuchen. Und er hat mich im ersten Monat extrem in die Mangel genommen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, er war generell ein harter Knochen.
Dann kam ein Job in einem großen amerikanischen Softwareunternehmen. Dort habe ich durch viel Glück, den richtigen Zeitpunkt, die richtigen Projekte (die auch gut gelaufen sind) eine, man würde sagen, relativ steile Karriere gemacht. Ich fing an als Juniorberater und war nach knapp 5 Jahren für die strategischen Projekte eCommerce in Deutschland verantwortlich. Meine Vorgesetzten haben mich die ganzen 5 Jahre sehr gefördert. Ich muss allerdings auch sagen, das ich mich immer selbst darum gekümmert habe, wo ich wie arbeite. Die meisten anderen Consultants haben in der Regel darauf gewartet, das ihnen ihr Chef ein neues Projekt zuweist. Dies war bei mir exakt einmal der Fall, nämlich beim ersten Projekt, danach nicht mehr.
Im letzten Jahr bei dem Unternehmen war mein Büro in der Teppichetage. Die hieß nicht nur deshalb so, weil der Teppich besonders flauschig war, sondern auch weil die Geschäftsführung dort saß. Und dort habe ich entscheidende Erfahrungen gemacht. Es geht in Teppichetagen nicht mehr um inhaltliche Projektarbeit, sondern um Machtfragen, um die Sicherstellung der eigenen Vertriebsquoten, die Justierung des eigenen Sessels Richtung Karriere. Unnötig zu sagen, das ich die einzige Frau dort war, zusammen mit einer Assistentin (allerdings eine strategische). Nötig zu sagen, das ich auf verlorenem Posten stand, weil ich den Männersprech nicht gecheckt habe. Oft habe ich nach Meetings erst Stunden später begriffen, um was es *wirklich* ging und wie ich zwischen strategischen Verhandlungsmassen ausgespielt wurde. Ich habe in der Zeit verdammt viel gelernt.
Irgendwann kam der Punkt, an dem mein Job sozusagen offiziell in die Geschäftsführungsstruktur eingebettet werden sollte.
Ich habe das über einen Freund erfahren, den ein Headhunter kontaktiert hatte und der mich fragte, ob ich weggehe, oder warum mein Job frei wird. Nun. Eine Woche später kam der damalige Europachef und erklärte relativ unverblümt: “Sie sind zu jung, zu kurz beim Unternehmen und eine Frau. Deshalb werden wir eine Doppelspitze machen und Sie können mehr inhaltlich arbeiten”. Und da war er, der Kontakt mit der gläsernen Decke. Und was tut eine Frau? Sie ärgert sich und sagt nix. Ich hab mir gesagt: Guck mal, willst Du das denn überhaupt, diese ganze Unternehmenspolitik, die gar nicht mehr inhaltlich orientiert ist? Nee, wollte ich nicht. Nee, dachte ich, kann ich auch gar nicht, da geh ich ja total unter. Und ehrlich gesagt, wäre ich das auch. (typisch Frau, wa? Oder doch gute Selbsteinschätzung?)
Aber egal, ich wollte eh selber ein Unternehmen gründen und habe das dann ein paar Monate später auch gemacht. (mit viel Unterstützung meines alten Unternehmens)
Und ganz ehrlich: Ein weiblicher CEO mit IT Hintergrund in einem StartUP war in der New Economy eine hippe Sache und ließ sich auch sehr gut vermarkten. Meine Mitarbeiter habe ich immer nach Qualifikation eingestellt; habe aber Frauen manchmal bevorzugt, weil ich gemischte Teams besser finde. Einer meiner VCs hat mir mal einen Coach zur Seite gestellt. Nach einem 4-stündigen Gespräch mit mir, wurde mein 50zig Jahre alter Vertriebsleiter zwei Tage lang ausgefragt, ob er nicht in Wahrheit ein Problem damit habe, für eine 30jährige Chefin zu arbeiten. Hatte er aber nicht.
Ich habe in meinem Berufsleben überwiegend mit Männern zusammengearbeitet. (Allerallermeistens sehr erfolgreich, bzw. habe ich mir darüber in der Regel eh wenig Gedanken gemacht.)
Dabei sehr häufig auch mit Männern, die 20 Jahre und mehr älter waren als ich. Meine Erfahrung dabei: Männer (besonders die älteren) wissen meistens nicht, wie sie mit Frauen in Führungspositionen umgehen sollen. Der gelernte testosteron geprägte Männersprech, die Gesten und Sprüche funktionieren nämlich auf einmal nicht. Gerade den älteren Männern ist eine andere Umgangsform mit Frauen anerzogen worden, als die durchsetzungsgeprägte Umgangsform zwischen Männern. Nämlich ein sanfter Umgang, ein stets freundlicher, zuvorkommender Umgang. Das gelernte Muster zieht also nicht. Das macht viele Männer hilflos oder sogar aggressiv. Wohl bemerkt: Das betrifft überwiegend die älteren Semester.
Und ganz ehrlich? Wenn ein Muster nicht zieht, kann das für mich auch vorteilhafte Situationen erzeugen, z.B. Verhandlungen mit Charme zu führen. Stichwort: Charmeoffensive. Warum auch nicht? Wenn ich eines gecheckt hab: ja, natürlich ist es wichtig mit Kompetenz zu überzeugen, aber weibliche Verhaltensweisen deshalb bewußt zurückzunehmen, würde mir heutzutage im Traum nicht mehr einfallen. Aber das musste ich erst lernen.
Doch als mein damaliger Vorstandskollege in Rahmen des Niedergangs der NE unser Unternehmen verließ, bin ich zu meinem Aufsichtsratsvorsitzenden gefahren und habe nach 10 Minuten angefangen zu heulen. Als ich ihn kurz darauf ansah, habe ich gemerkt: Alles klar, dieser Mann wird dir nicht mehr zutrauen ein Unternehmen zu führen.
Kurz darauf, bin ich auch aus anderen Gründen, zurückgetreten. Wer die Geschichte lesen will, kann das hier tun. Meine Unternehmensanteile habe ich 2004 verkauft. Dem Unternehmen geht es heute gut.
Seitdem arbeite ich als freie Beraterin. Mein Tagessatz liegt oft etwas unter dem, was meine männlichen Kollegen bekommen. Natürlich auch deshalb, weil sie von vornherein andere Beträge aufrufen. Da gehöre ich, wie fast alle Frauen, die ich in vergleichbaren Jobs kenne, zu denen die eher “fair” verhandeln als “eigenoptimiert”. Aber ich lerne mit jeder Verhandlung.
So. Das wars erstmal. Sehr persönlich, viel zu lang, aber ich dachte, ich schreibs mal auf.
PS: Meine Meinung zur Frauenquote: Ich will sie nicht (Nachtrag: Ich will sie nicht für mich). Ich vertraue auf die nächsten Generationen von Männern, die mit anderen Rollenbildern aufgewachsen sind und die das nicht die Bohne interessiert.
PS2: Ich habe keine Kinder und kann den Aspekt der mangelnden Kinderbetreuungsmöglichkeiten der Unternehmen nur feststellen aber nicht aus persönlicher Erfahrung beurteilen.
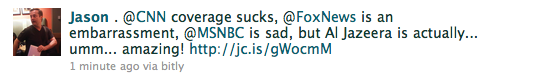
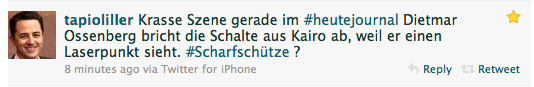




Letzte Kommentare