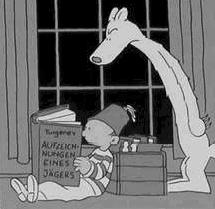 In einem Kinderbuch*, das ich genauso gut jedem Erwachsenen empfehlen möchte, findet sich eine Bildergeschichte mit durchaus literatur- theoretischem Anspruch.
In einem Kinderbuch*, das ich genauso gut jedem Erwachsenen empfehlen möchte, findet sich eine Bildergeschichte mit durchaus literatur- theoretischem Anspruch.
Ich zitiere hier eine Inhaltsangabe von einer einschlägigen Kinder- medienforschungsseite:
Fred findet auf dem Dachboden einen alten Hut (der ihm gut gefällt) und eine Kiste mit vielen alten Büchern (die ihm nicht alle gefallen). Seite um Seite liest er sich durch die verschiedenen Genres der Literatur: Krimis, Kinderbücher, Märchen, Tiergeschichten…. taucht jedesmal ganz ein in die phantastische Welt, die sich da vor ihm auftut – um sie dann für ein nächstes Buch wieder zu verlassen. Hintersinnig und skurril sind es vor allem die comicartigen Bilder, die in wechselnden Szenen von dieser turbulenten Reise quer durch alle Sparten der Literatur erzählen – und zum Selbererzählen anregen!
Fred wird hier als Leser vorgestellt, der eine enorme Reise durch die (Kinder- und Abenteuer-) Literaturgeschichte unternimmt, am Ende aber die Reise unterbricht, mit den Worten Nein danke (…) Jetzt reichts. Schluss, aus, Ende. Das wars., als er das Verfahren der Illusion oder Fiktion als zu billig entlarvt. Das ist aus meiner Sicht aber nur eine, sicher die offensichtlichste Ebene des Textes.
Unterschlagen wird in obiger Inhaltsangabe, dass schon im fünften Bild (!) ein Tier auftauchen wird, ein grosser, kupierter Hund?, ein Bär?, ein bald gefrässiges Ungeheuer, das fortan hinter Freds Rücken lauert und ihm ins Buch schaut, mitliest, und in den Abenteuern empathisch mitfiebert, ja gegenüber Fred, der sicherlich der analytische Leser der Bücher ist, eine starke Identifikation mit dem Geschehen eingeht, und daher völlig vergisst, über die Mahlzeit Fred herzufallen.
Dennoch ist von diesem Ungeheuer, das einer der ersten Lektüren Freds entsprang, nie die Rede (im Paralleltext also). Und trotzdem ist es am Ende das Ungeheuer, das sich Freds verlassene Bücherkiste aneignet, und sich mit dieser beglückt aus dem Staub macht.
Der Leser zweiter Ordnung also, hat bei diesem Plot das letzte Wort. Das wiederum weiss aber nur der Leser, die Leserin dritter Ordnung, also wir. Ein Vexierspiel wird hier aufgemacht, das man noch eingehender analysieren könnte.
Festzuhalten wäre allerdings hier eine (bewusst?) doppeldeutig angelegte Entwicklung, was den Status der Leserfiktionen angeht. Beispiel:
Text/Bild 34: Und dann, gerade an der spannendsten Stelle, als Fred unbedingt wissen wollte, wie es weitergehen würde … (mit der Bildreferenz: der lesende Fred, umringt von grossen, tanzenden Monstern)
Text/Bild 35: hörte die Geschichte auf, weil der kleine Junge alles nur geträumt hatte (mit der Bildreferenz: der vom Buch sich distanzierende Fred sitzt wieder alleine in einem Zimmer)
(Nachtrag zu Text/Bild 33, 41: Das mitlesende Ungeheuer wurde in diesem Bild (33) von den Monstern weggezaubert, taucht aber wieder in Bild 41 auf, um bald die Bücherkiste zu entwenden …)
Nach dieser Lesart hat sich Fred also die Literatur nur erträumt, das diesem Traum (der ersten Fiktion) entsprungene und mitlesende Ungeheuer erlebt diese Träume dagegen hautnah, wird sogar Mithandelnder in den jeweiligen Büchern und bleibt am Ende der Bildergeschichte als einziger übrig (nehmen wir uns einmal von dieser Anordnung aus). In anderen Worten: die vorgestellten Fiktionen werden von Fred als Träume erfahren, und das, obwohl Elemente der Träume/Fiktionen Fred als Lesefigur überleben. Oder kürzer: Die Fiktion integriert die vorgestellte Realität, dreht sogar dieses Verhältnis um, d.h. die Fiktion wird hier als Realität wirksam, sodass die gesamte Anordnung, das Erzählgerüst ins Wanken gerät, unter dem Vorzeichen: es gibt nur die Literatur, und wir als Teile von ihr.
Etwas schwieriger wird es freilich, wenn wir uns als Leser dritter Ordnung mit in dieser Konstruktion bewegen. Es gibt die Textebene (in der das lesende Ungeheuer, der empathische Leser zweiter Ordnung nicht auftaucht) und die Bildebene, in der die zwei Leser als Leser und Handelnde gezeigt werden, und wir uns als Leser dritter Ordnung, der der Zusammenschau nämlich, bewusst werden. Am Ende vielleicht sogar diese absurde Konstruktion versuchen zu beschreiben.
Eine logische Konsequenz, was das Übrigbleiben am Ende der Geschichte angeht (und das sind wir, die Leser dritter Ordnung, und unsere Ratlosigkeit, die sich spiegelnden Fiktionsebenen auseinanderzuhalten), wäre die Übertragung dieser Mechanismen auf uns. Wir entdecken die Unmöglichkeit diese Ebenen auseinanderzuhalten und haben die Wahl. Wir legen dieses Buch* zurück in eine Bücherkiste, betrachten alles bisher Gelesene als Traum und verschwinden für immer in unserem Bücherregal (Nein danke (…) Jetzt reichts. Schluss, aus, Ende. Das wars.). Oder wir betrachten uns als unsere eigene Fiktion, nehmen dieses Buch mit uns, und lesen es von Zeit zu Zeit gerne wieder. Ff.
* Könnecke, Ole: Fred und die Bücherkiste. Hamburg, 2002
Quellen (1) zu einer Poetologie der Reihe Die Träume meiner Frau