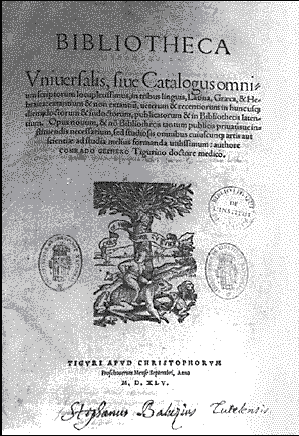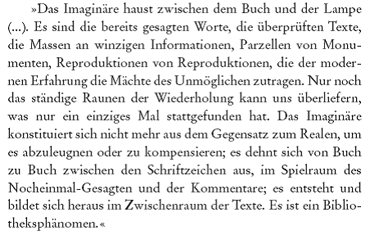(M52)
Das ist ja das Merkmal jenes Bruches, von dem Jedermann als von dem Urleiden der modernen Cultur zu reden pflegt, dass der theoretische Mensch vor seinen Consequenzen erschrickt und unbefriedigt es nicht mehr wagt sich dem furchtbaren Eisstrome des Daseins anzuvertrauen: ängstlich läuft er am Ufer auf und ab. Er will nichts mehr ganz haben, ganz auch mit aller der natürlichen Grausamkeit der Dinge. Soweit hat ihn das optimistische Betrachten verzärtelt. Dazu fühlt er, wie eine Cultur, die auf dem Princip der Wissenschaft aufgebaut ist, zu Grunde gehen muss, wenn sie anfängt, unlogisch zu werden d.h. vor ihren Consequenzen zurück zu fliehen. Unsere Kunst offenbart diese allgemeine Noth: umsonst dass man sich an alle grossen productiven Perioden und Naturen imitatorisch anlehnt, umsonst dass man die ganze “Weltlitteratur zum Troste des modernen Menschen um ihn versammelt und ihn mitten unter die Kunststile und Künstler aller Zeiten hinstellt, damit er ihnen, wie Adam den Thieren, einen Namen gebe: er bleibt doch der ewig Hungernde, der Kritiker ohne Lust und Kraft, der alexandrinische Mensch, der im Grunde Bibliothekar und Corrector ist und an Bücherstaub und Druckfehlern elend erblindet.
Aus: Friedrich Wilhelm Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, Kap.18