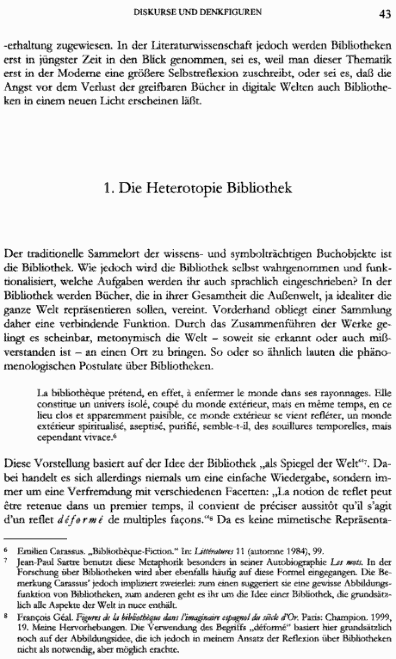(M19)
Die gezeigten Beispiele stammen allesamt aus den letzten zwei, drei Jahren. In den Spot für Knoppers und Pfanni (Freu Dich!) geht es lediglich um das sekundenkurze Zitieren unproblematischer Berufe und um die Nachvollziehbarkeit der Freude, die auch bei angenehmen Arbeitsbedingungen in Pausen und nach Feierabend durch die Belohnung mit kleinen Leckereien und schnelle Gerichte ausgelöst wird. Die jeweils gezeigten Bibliothekarinnen sind daher (gemessen an den gängigen Filmklischees), eher untypisch, jung und attraktiv. Wobei sie eben nicht bei der Arbeit, sondern bei deren Unterbrechung bzw. beim Beginn des Feierabends gezeigt werden. In der etwas längeren Werbung für Oil of Olaz (Diese Frau hat ein Geheimnis) übrigens ein Plot von erlesener Blödheit fungiert die gezeigte Uni-Bibliothek lediglich als Arbeits- und heterosexueller Begegnungsort für akademisches Jungvolk. (…)
aus: Manfred Nagl: Stille, Ordnung, Katastrophen. Bibliotheken im Film Bibliotheken aus männlichem Blick? In: Bibliotheken in der literarischen Darstellung = Libraries in literature : [Referate des Seminars “Bibliotheken in der literarischen Darstellung / Libraries in literature”, das vom 10. bis 11. Oktober 1994 in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel stattgefunden hat] / hrsg. von Peter Vodosek … [et al.]. – Wiesbaden : Harrassowitz, 1999. S.117f.